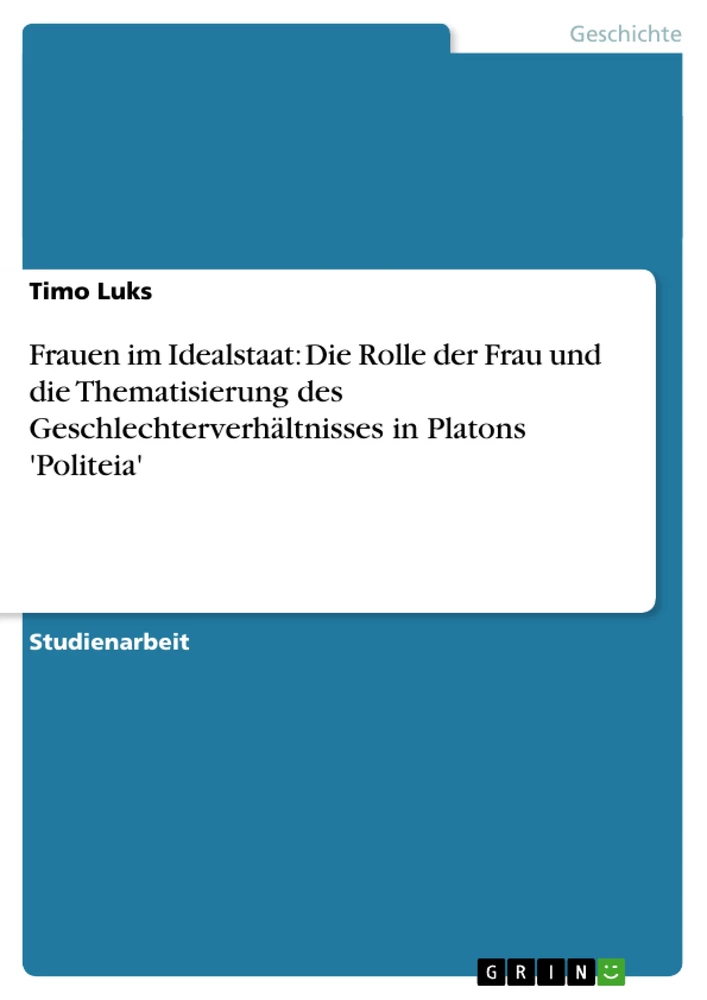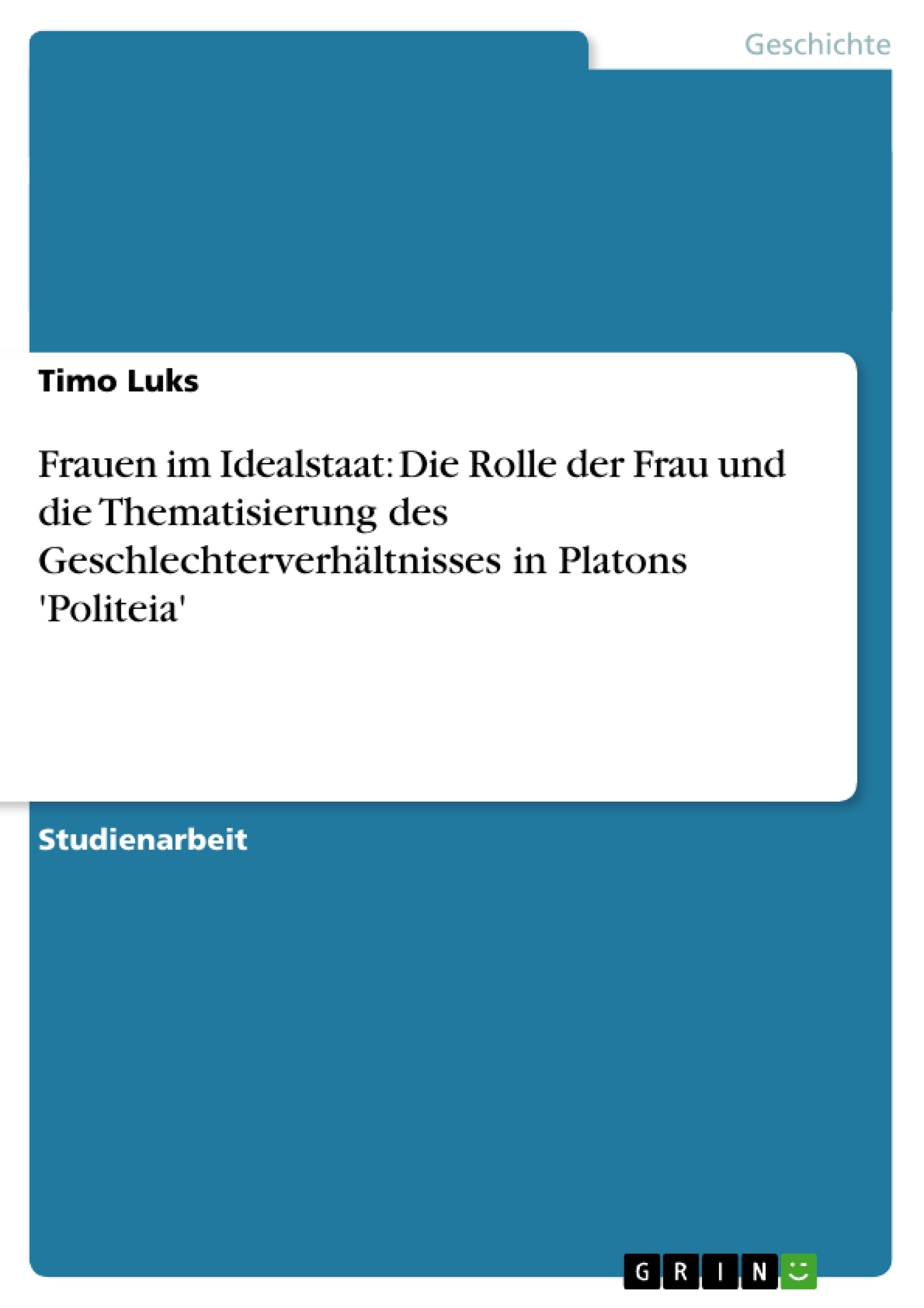Ich beschäftige mich in dieser Hausarbeit mit Platons Frauenbild, das heißt genauer mit der Stellung der Frau in der „Politeia“. Dabei sollen zwei Ebenen unterschieden werden. Erstens werden jene eher beiläufigen Äußerungen Platons dargestellt und zusammengefasst, die im Buch verstreut sind und sich auf viele voneinander unabhängige Einzelprobleme und Beispiele beziehen. Hierbei handelt es sich nicht um einen kohärenten Komplex, sondern um als selbstverständlich erscheinende, kaum oder gar nicht reflektierte Aussagen, in denen sich die alltäglichen Erfahrungen, gleichsam die Lebenswelt Platons widerspiegelt. Der zweite Bereich steht damit mitunter im Widerspruch. Hier handelt es sich um das theoretisch-philosophische Modell innerhalb Platons Idealstaat, das sich hauptsächlich mit dem Geschlechterverhältnis und der Rollen- bzw. Aufgabenverteilung in der Polis auseinandersetzt. Einen wesentlichen Teil dieser hauptsächlich im V. Buch der „Politeia“ entfalteten Gedanken bildet die sogenannte Weiber- und Kindergemeinschaft.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Frauen in Platons Staat
- 1. Allgemeines Frauenbild
- 2. Natur der Geschlechter
- 3. Aufgabenverteilung
- 4. Ausbildung und Erziehung
- 5. Weibergemeinschaft
- III. Einordnung und Bewertung der Theorie
- IV. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Platons Frauenbild in der „Politeia“, indem sie zwei Ebenen unterscheidet: die beiläufigen Äußerungen Platons über Frauen und das theoretisch-philosophische Modell des Geschlechterverhältnisses im Idealstaat, insbesondere die Weiber- und Kindergemeinschaft. Die Arbeit analysiert die Widersprüche zwischen dem alltäglichen Frauenbild Platons und seinem idealstaatlichen Modell.
- Das alltägliche Frauenbild Platons und seine gesellschaftlichen Kontexte
- Platons theoretisch-philosophisches Modell des Geschlechterverhältnisses im Idealstaat
- Die Rolle der Weiber- und Kindergemeinschaft in Platons „Politeia“
- Der Einfluss des Peloponnesischen Krieges auf Platons Denken
- Bewertung von Platons Theorie zur Rolle der Frau
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse des Frauenbildes in Platons „Politeia“ auf zwei Ebenen – die alltäglichen, oft abwertenden Äußerungen und das theoretisch-philosophische Modell im Idealstaat, inklusive der Weibergemeinschaft. Sie betont den Gegensatz zwischen diesen Ebenen und den Kontext von Platons Leben und der damaligen Gesellschaft, wo Frauenverachtung weit verbreitet war und Frauen kaum öffentliche Teilhabe hatten. Der Peloponnesische Krieg und seine Folgen werden als potenziell prägender Einfluss auf Platons Denken angesprochen.
II. Frauen in Platons Staat: Dieses Kapitel untersucht Platons Frauenbild in seiner „Politeia“. Der erste Teil analysiert das allgemeine Frauenbild, welches hauptsächlich durch negative und abwertende Darstellungen geprägt ist, die Frauen oft auf ihre funktionale Rolle als Ehegattin und Gebärmaschine reduzieren. Platon stellt negative Beispiele dar, wie etwa untreue Ehefrauen oder Mütter, die ihre Söhne falsch erziehen. Diese negativen Darstellungen spiegeln die gesellschaftliche Realität Platons Zeit wider. Der zweite Teil befasst sich mit dem theoretisch-philosophischen Modell im Idealstaat. Hier wird angedeutet, dass Platons Ansatz zwar wohlwollender erscheint, jedoch aus anderen Gründen als aus einem Streben nach Emanzipation resultiert. Die Weiber- und Kindergemeinschaft wird als zentrale Kategorie im Idealstaat hervorgehoben. Das Kapitel deutet an, dass der Peloponnesische Krieg und die damit verbundene Veränderung der Geschlechterrollen Platons Denken beeinflusst haben könnten.
Schlüsselwörter
Platon, Politeia, Frauenbild, Geschlechterverhältnis, Idealstaat, Weibergemeinschaft, Peloponnesischer Krieg, Athen, Antike, Emanzipation, Gesellschaft, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Platons Frauenbild in der Politeia
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Platons Frauenbild in der „Politeia“. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Platons alltäglichen Äußerungen über Frauen und seinem theoretisch-philosophischen Modell des Geschlechterverhältnisses im Idealstaat, insbesondere der Weiber- und Kindergemeinschaft. Die Arbeit untersucht die Widersprüche zwischen diesen beiden Ebenen.
Welche Ebenen des Frauenbildes werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet zwischen zwei Ebenen: den beiläufigen, oft abwertenden Äußerungen Platons über Frauen und dem theoretisch-philosophischen Modell des Geschlechterverhältnisses im Idealstaat. Diese beiden Ebenen werden verglichen und auf ihre Widersprüche hin untersucht.
Welche Rolle spielt die Weiber- und Kindergemeinschaft?
Die Weiber- und Kindergemeinschaft ist ein zentraler Bestandteil von Platons Idealstaat und wird in der Arbeit ausführlich untersucht. Ihre Rolle im Kontext des gesamten Geschlechterverhältnisses im Idealstaat wird analysiert.
Wie wird das alltägliche Frauenbild Platons beschrieben?
Das alltägliche Frauenbild Platons wird als hauptsächlich negativ und abwertend beschrieben. Frauen werden oft auf ihre funktionale Rolle als Ehegattin und Gebärmaschine reduziert. Negative Beispiele untreuer Ehefrauen oder Mütter, die ihre Söhne falsch erziehen, werden hervorgehoben. Diese Darstellungen spiegeln die gesellschaftliche Realität Platons Zeit wider.
Wie wird Platons theoretisch-philosophisches Modell des Geschlechterverhältnisses im Idealstaat dargestellt?
Platons theoretisch-philosophisches Modell im Idealstaat erscheint zwar wohlwollender als sein alltägliches Frauenbild, die Arbeit deutet jedoch an, dass dies nicht aus einem Streben nach Emanzipation resultiert, sondern aus anderen Gründen. Die Weiber- und Kindergemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt dieses Modells.
Welchen Einfluss hatte der Peloponnesische Krieg?
Der Peloponnesische Krieg und die damit verbundenen Veränderungen der Geschlechterrollen werden als potenziell prägender Einfluss auf Platons Denken angesprochen und im Kontext der Analyse diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Frauen in Platons Staat (mit Unterkapiteln zu Allgemeinem Frauenbild, Natur der Geschlechter, Aufgabenverteilung, Ausbildung und Erziehung sowie Weibergemeinschaft), Einordnung und Bewertung der Theorie und Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Platon, Politeia, Frauenbild, Geschlechterverhältnis, Idealstaat, Weibergemeinschaft, Peloponnesischer Krieg, Athen, Antike, Emanzipation, Gesellschaft, Philosophie.
- Quote paper
- Timo Luks (Author), 2000, Frauen im Idealstaat: Die Rolle der Frau und die Thematisierung des Geschlechterverhältnisses in Platons 'Politeia', Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12271