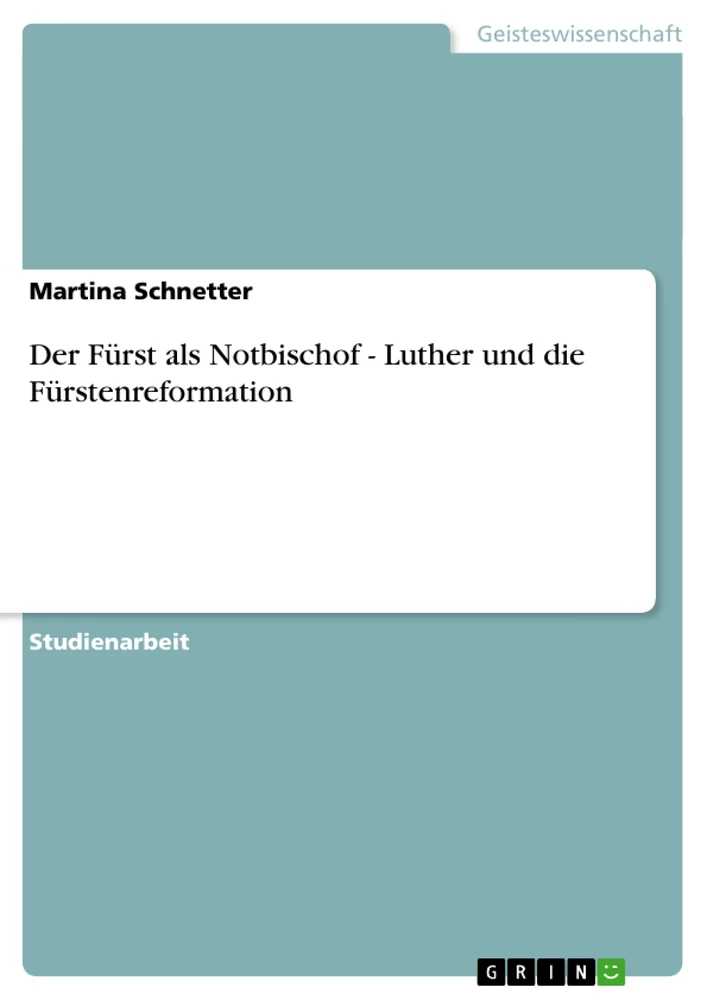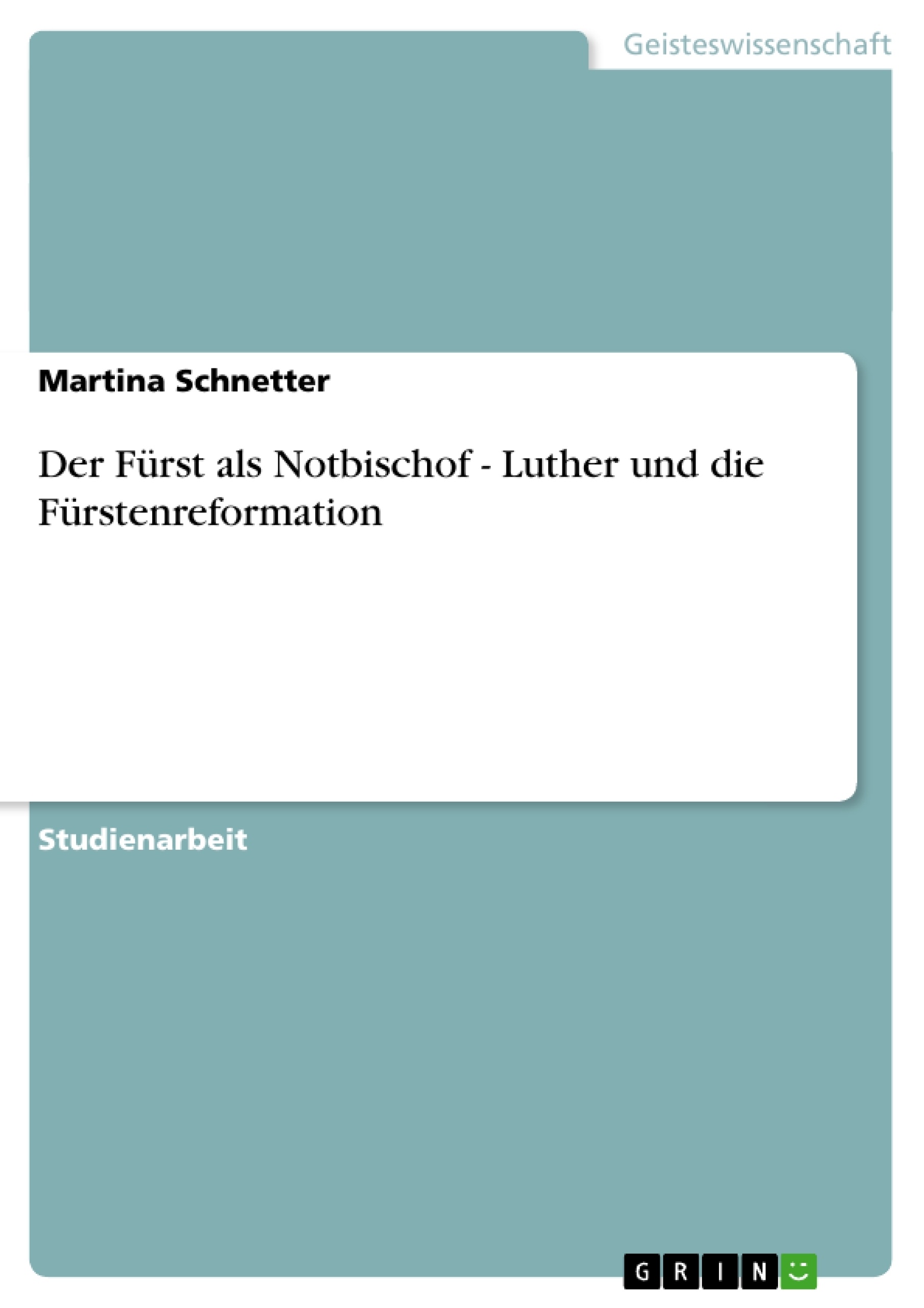1 Einleitung
Die Reformation ist wohl eines der bedeutsamsten Ereignisse der deutschen Geschichte und auch der Weltgeschichte, da mit ihr die sogenannte „Neuzeit“ eingeleitet wird. Die vormals selbstverständliche Einheit der Christenheit wurde zerstört und, ausgehend von der damals engen Verzahnung von Kirche, Gesellschaft und Staat, bedeutete die Reformation tiefe kirchliche, soziale und politische Einschnitte (vgl. u. a. BLICKLE 2000).
1.1 Zum Begriff der „Fürstenreformation“
Mit dem Begriff der „Fürstenreformation“ wird gemeinhin die Phase der Reformation bezeichnet, in der sich die „geplante, politisch zu vertretende Entscheidung für oder gegen die Reformation durchzusetzen begann“ (SCHORN-SCHÜTTE 2000, 72), im Gegensatz zur bäuerlichen und bürgerlichen Volks- oder Gemeindereformation bzw. Stadtreformation als spontane Bewegung (vgl. MAU 2000, 164; SCHORN-SCHÜTTE 2000, 72), auf die im Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher eingegangen werden soll.
Charakteristische Merkmale für die Fürstenreformation sind „die territoriale Festlegung des Bekenntnisses durch den Landesherrn und die hierarchisch-bürokratische Ausrichtung der Kirchenorganisation“ (BLICKLE 2000, 186). Im Zuge der Fürstenreformation kam es also zu einer territorialen Verfestigung der Reformation.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der „Fürstenreformation“
- Vorgehensweise und Quellen
- Der Reichstag zu Worms 1521
- Geschichtlicher Hintergrund: Von den Ablassthesen 1517 bis zur Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“ 1520
- Luthers Verhör und das „Wormser Edikt“
- Der Reichstag zu Speyer 1526
- Geschichtlicher Hintergrund: Die Veränderung der politisch-konfessionellen Landschaft im Reich zwischen 1524 und 1526
- Der Reichstagsabschied als Kompromiß zwischen dem Kaiser und den luthernahen Reichsständen
- Die Verstaatlichung der Reformation
- Der Fürst als „Notbischof“
- Die Kirchenvisitationen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Fürstenreformation, einem bedeutenden Abschnitt der Reformation, in dem die „geplante, politisch zu vertretende Entscheidung für oder gegen die Reformation“ durchgesetzt wurde. Im Fokus stehen die Entwicklungen zwischen Luthers Veröffentlichung der Ablassthesen 1517 und dem Reichstag zu Speyer 1526. Die Arbeit beleuchtet die Rolle Luthers und die Verstaatlichung der Reformation mit der Rolle des Fürsten als „Notbischof“ und den Kirchenvisitationen.
- Die Bedeutung des Reichstags zu Worms 1521 und das „Wormser Edikt“
- Die Rolle der Fürsten bei der Ausbreitung der Reformation
- Die Verstaatlichung der Reformation und die Einführung von Kirchenvisitationen
- Der Einfluss Luthers auf die Entwicklung der Fürstenreformation
- Die Bedeutung der Programmschriften Luthers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der „Fürstenreformation“ ein und erläutert den Unterschied zu anderen Formen der Reformation, wie der bäuerlichen und städtischen Reformation. Die Autorin erläutert die Vorgehensweise und die wichtigsten Quellen der Hausarbeit.
Der Reichstag zu Worms 1521
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe der „causa Lutheri“, ausgehend von den Ablassthesen bis zur Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“. Es wird Luthers Verhör und das „Wormser Edikt“ analysiert.
Der Reichstag zu Speyer 1526
Das Kapitel behandelt die politische und konfessionelle Landschaft im Reich zwischen 1524 und 1526 und analysiert den Reichstagsabschied als Kompromiss zwischen Kaiser und luthernahen Reichsständen.
Die Verstaatlichung der Reformation
Dieses Kapitel fokussiert auf die Rolle des Fürsten als „Notbischof“ und auf die Kirchenvisitationen. Es werden Luthers Schriften sowie Briefe und Dokumente aus der Zeit der Kirchenvisitationen in Sachsen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf Themen wie die „Fürstenreformation“, Luthers Thesen, die Ablassthesen, die Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“, die Reichstage zu Worms und Speyer, Kirchenvisitationen, das „Wormser Edikt“, der „Notbischof“ und die Programmschriften Luthers.
- Quote paper
- Martina Schnetter (Author), 2002, Der Fürst als Notbischof - Luther und die Fürstenreformation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12260