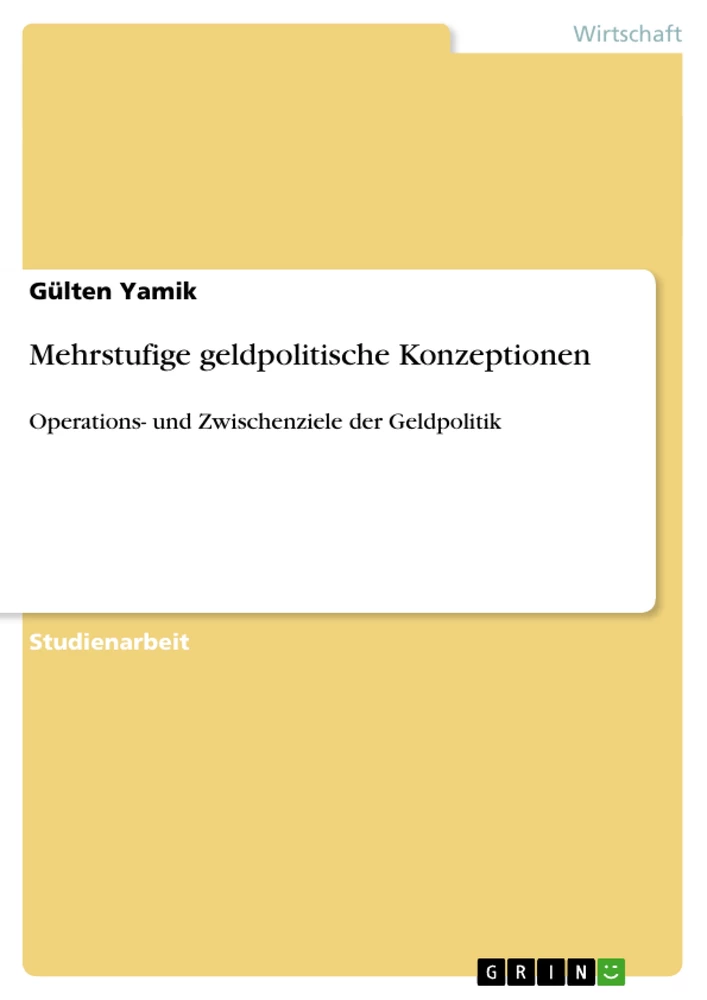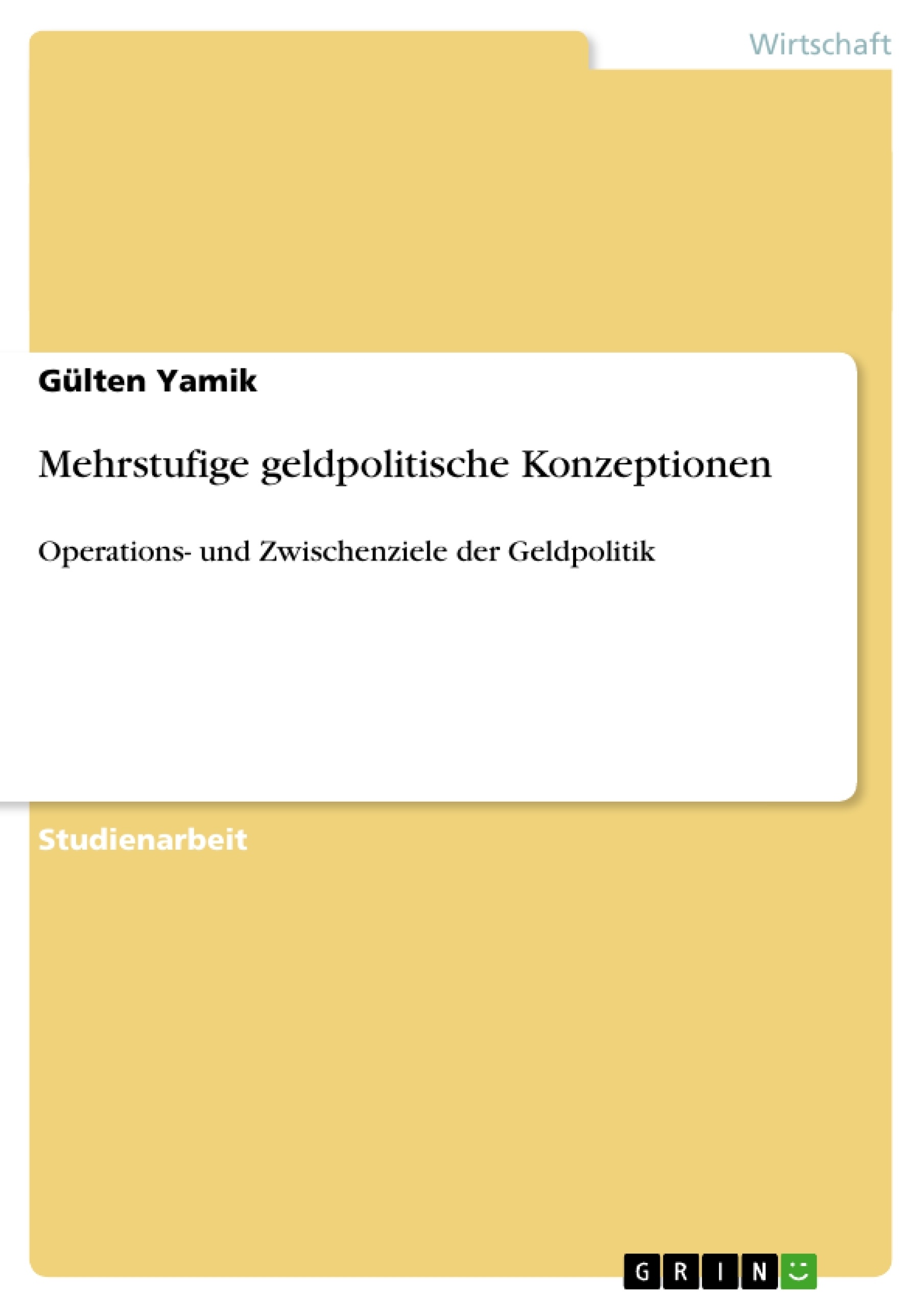Die Zentralbanken streben danach, bestimmte Endziele zu erreichen, die für die
Allgemeinheit von hoher Bedeutung sind.
Zu diesen Endzielen der Geldpolitik zählen unter anderem hohe Beschäftigung,
Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, Zinssatzstabilität, Stabilität der Devisenmärkte und
Finanzmarktstabilität. Das Problem, dass für die Zentralbank daraus erwächst, ist jener, dass
solche Endziele nicht direkt, sondern durch sogenannte Operations- und Zwischenziele
erreicht werden können.
Gegenstand dieser Hausarbeit ist nun die Analyse, wie Zentralbanken mit ihren Instrumenten
ihre Endziele erreichen und an welchen Indikatoren sie sich orientieren sollen, wenn sie
bestimmte Entscheidungen treffen.1
Als Einstieg in diese Arbeit wird ein Überblick über das Wesen der ESZB gegeben und dabei
dessen Aufgabenfeld vorgestellt. Im Anschluss wird eine Gegenüberstellung von der
diskretionären und der regelgebundenen Geldpolitik durchgeführt. Folglich wird auf das
Problem der indirekten und unsicheren Verzögerung auf die Endziele eingegangen.
Thematisiert werden dabei, die generellen Anforderungen an die Zwischen- und
Operationsziele und die Endziele der Zentralbanken (mehrstufige geldpolitische Konzeption).
In den nächsten Schritten werden die geldpolitischen Instrumente der Zentralbanken, die
einzelnen geldpolitischen Strategien und die Erfahrungen der Industrienationen mit der
Geldmengensteuerung beschrieben. Im letzten Teil erfolgt eine Schlussbetrachtung über die
gesamte Arbeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Wesen der ESZB
- 2.1 Aufgaben der ESZB
- 2.2 Ziele und Aufgaben der EZB
- 3. Regelgebundene vs. Diskretionäre Geldpolitik
- 4. Mehrstufige geldpolitische Konzeptionen
- 4.1 Anforderungen an Zwischenziele
- 4.2 Endziele der Geldpolitik
- 5. Instrumente und Endziele der Zentralbank
- 5.1 Das geldpolitische Instrumentarium
- 5.1.1 Offenmarktgeschäfte
- 5.1.2 Fazilitätenpolitik
- 5.1.3 Mindestreservepolitik
- 5.1 Das geldpolitische Instrumentarium
- 6. Die Zentralbankstrategie
- 6.1 Auswahl der Ziele: Geldmengensteuerung bzw. Geldmengenziel
- 6.1.1 Zinspolitik
- 6.2 Direkte Inflationssteuerungen
- 6.3 Der Wechselkurs als Zwischenzielgröße
- 6.1 Auswahl der Ziele: Geldmengensteuerung bzw. Geldmengenziel
- 7. Erfahrungen der Industrienationen mit der Geldmengensteuerung
- 7.1 Die Deutsche Bundesbank
- 7.2 Die US-amerikanische Fed
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Strategien von Zentralbanken zur Erreichung ihrer geldpolitischen Endziele. Sie untersucht, wie Zentralbanken durch Operations- und Zwischenziele indirekte Einflüsse auf Größen wie Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Preisstabilität ausüben. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Unsicherheiten dieses mehrstufigen Prozesses.
- Mehrstufige geldpolitische Konzeptionen und die Rolle von Zwischenzielen
- Vergleich regelgebundener und diskretionärer Geldpolitik
- Analyse geldpolitischer Instrumente (Offenmarktgeschäfte, Fazilitätenpolitik, Mindestreservepolitik)
- Untersuchung verschiedener geldpolitischer Strategien (Geldmengensteuerung, Zinspolitik, Inflationssteuerung)
- Erfahrungen verschiedener Industrienationen mit Geldmengensteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das zentrale Problem der Arbeit: Zentralbanken können ihre geldpolitischen Endziele (hohe Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität etc.) nicht direkt beeinflussen, sondern benötigen Operations- und Zwischenziele. Die Arbeit analysiert, wie Zentralbanken ihre Instrumente einsetzen und welche Indikatoren sie zur Entscheidungsfindung heranziehen. Es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben, welche die Analyse des Wesens der ESZB, einen Vergleich diskretionärer und regelgebundener Geldpolitik, die Anforderungen an Zwischen- und Operationsziele und eine Beschreibung der geldpolitischen Instrumente umfasst.
2. Das Wesen der ESZB: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Struktur des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kontext der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Es beleuchtet die Aufgaben und die Verantwortung der EZB für die Geldpolitik der Eurozone. Die Interaktion zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken wird erklärt und die Rolle des EZB-Rats bei der Festlegung der geldpolitischen Strategie hervorgehoben.
3. Regelgebundene vs. Diskretionäre Geldpolitik: Hier wird ein Vergleich zwischen regelgebundener und diskretionärer Geldpolitik angestellt. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze werden diskutiert, wobei der Fokus auf den Auswirkungen auf die Effektivität der Geldpolitik und die Glaubwürdigkeit der Zentralbank liegt. Der Vergleich beinhaltet die Analyse der unterschiedlichen Entscheidungsfindungsprozesse und ihrer Folgen für die Stabilität des Wirtschaftssystems. Die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Erwartungsbildung der Marktteilnehmer werden ebenfalls beleuchtet.
4. Mehrstufige geldpolitische Konzeptionen: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit dem Konzept mehrstufiger geldpolitischer Konzeptionen. Es beschreibt die Anforderungen an Zwischenziele und die Bedeutung der Endziele der Geldpolitik. Die Komplexität der Übertragung geldpolitischer Impulse auf die Realwirtschaft wird erläutert, inklusive der Herausforderungen bei der Wahl geeigneter Zwischenziele und der Berücksichtigung von Zeitverzögerungen. Die Interdependenzen zwischen verschiedenen Zielen werden analysiert und Strategien zur effizienten Zielerreichung diskutiert.
5. Instrumente und Endziele der Zentralbank: In diesem Kapitel werden die geldpolitischen Instrumente der Zentralbanken im Detail beschrieben, darunter Offenmarktgeschäfte, Fazilitätenpolitik und Mindestreservepolitik. Der Wirkungsmechanismus jedes Instruments wird erläutert und der Zusammenhang zwischen den Instrumenten und den angestrebten Endzielen wird hergestellt. Die Wahl der Instrumente in Abhängigkeit von der jeweiligen geldpolitischen Strategie wird diskutiert und die möglichen Grenzen und Risiken des Instrumenteneinsatzes werden beleuchtet.
6. Die Zentralbankstrategie: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene geldpolitische Strategien, insbesondere die Geldmengensteuerung und die Zinspolitik, sowie die direkte Inflationssteuerung und die Rolle des Wechselkurses als Zwischenziel. Die Vor- und Nachteile jeder Strategie werden gewichtet und die Komplexität der Auswahl der richtigen Strategie in Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird herausgestellt. Die Bedeutung der Transparenz und Kommunikation der gewählten Strategie für die Effektivität der Geldpolitik wird ebenfalls hervorgehoben.
7. Erfahrungen der Industrienationen mit der Geldmengensteuerung: Dieses Kapitel analysiert die Erfahrungen der Deutschen Bundesbank und der US-amerikanischen Federal Reserve (Fed) mit der Geldmengensteuerung. Die Erfolge und Misserfolge der jeweiligen Strategien werden im Detail untersucht und die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden für die Gestaltung aktueller geldpolitischer Strategien bewertet. Die Bedeutung von institutionellen und konjunkturellen Faktoren für den Erfolg der Geldmengensteuerung wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Geldpolitik, Zentralbanken, EZB, ESZB, mehrstufige geldpolitische Konzeptionen, Zwischenziele, Endziele, regelgebundene Geldpolitik, diskretionäre Geldpolitik, geldpolitische Instrumente, Offenmarktgeschäfte, Fazilitätenpolitik, Mindestreservepolitik, Geldmengensteuerung, Zinspolitik, Inflationssteuerung, Wechselkurs, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Strategien von Zentralbanken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Strategien von Zentralbanken, um ihre geldpolitischen Endziele (wie Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Preisstabilität) zu erreichen. Sie untersucht, wie Zentralbanken mittels Operations- und Zwischenziele indirekt auf diese Größen Einfluss nehmen und beleuchtet die Herausforderungen und Unsicherheiten dieses mehrstufigen Prozesses.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt mehrstufige geldpolitische Konzeptionen und die Rolle von Zwischenzielen, vergleicht regelgebundene und diskretionäre Geldpolitik, analysiert geldpolitische Instrumente (Offenmarktgeschäfte, Fazilitätenpolitik, Mindestreservepolitik), untersucht verschiedene geldpolitische Strategien (Geldmengensteuerung, Zinspolitik, Inflationssteuerung) und analysiert die Erfahrungen verschiedener Industrienationen mit Geldmengensteuerung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das zentrale Problem – die indirekte Beeinflussung der Endziele durch Zentralbanken – beschreibt und einen Überblick über die Struktur der Arbeit gibt. Es folgen Kapitel zum Wesen der ESZB (Europäisches System der Zentralbanken) und EZB (Europäische Zentralbank), zum Vergleich regelgebundener und diskretionärer Geldpolitik, zu mehrstufigen geldpolitischen Konzeptionen, zu den Instrumenten und Endzielen der Zentralbank, zu verschiedenen Zentralbankstrategien und schließlich zu den Erfahrungen von Industrienationen (Deutschland und USA) mit der Geldmengensteuerung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was ist das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)?
Das Kapitel über das Wesen der ESZB beschreibt die Entstehung und Struktur des ESZB und der EZB im Kontext der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Es beleuchtet die Aufgaben und die Verantwortung der EZB für die Geldpolitik der Eurozone und die Interaktion zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken.
Was ist der Unterschied zwischen regelgebundener und diskretionärer Geldpolitik?
Dieser Abschnitt vergleicht die Vor- und Nachteile regelgebundener und diskretionärer Geldpolitik bezüglich Effektivität und Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Er analysiert die unterschiedlichen Entscheidungsfindungsprozesse und deren Auswirkungen auf die Stabilität des Wirtschaftssystems und die Erwartungsbildung der Marktteilnehmer.
Wie funktionieren mehrstufige geldpolitische Konzeptionen?
Das Kapitel zu mehrstufigen Konzeptionen beschreibt die Anforderungen an Zwischenziele und die Bedeutung der Endziele. Es erläutert die Komplexität der Übertragung geldpolitischer Impulse auf die Realwirtschaft, inklusive der Herausforderungen bei der Wahl geeigneter Zwischenziele und der Berücksichtigung von Zeitverzögerungen. Die Interdependenzen zwischen verschiedenen Zielen und Strategien zur effizienten Zielerreichung werden analysiert.
Welche geldpolitischen Instrumente werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Instrumente Offenmarktgeschäfte, Fazilitätenpolitik und Mindestreservepolitik. Der Wirkungsmechanismus jedes Instruments und der Zusammenhang zwischen Instrumenten und Endzielen werden erläutert. Die Wahl der Instrumente in Abhängigkeit von der geldpolitischen Strategie und mögliche Grenzen/Risiken werden diskutiert.
Welche Zentralbankstrategien werden untersucht?
Verschiedene Strategien werden beleuchtet, darunter Geldmengensteuerung, Zinspolitik, direkte Inflationssteuerung und die Rolle des Wechselkurses als Zwischenziel. Die Vor- und Nachteile jeder Strategie und die Komplexität der Strategiewahl werden hervorgehoben. Die Bedeutung der Transparenz und Kommunikation wird ebenfalls betont.
Welche Erfahrungen mit Geldmengensteuerung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Erfahrungen der Deutschen Bundesbank und der US-amerikanischen Federal Reserve (Fed) mit der Geldmengensteuerung. Erfolge und Misserfolge werden untersucht und die Erkenntnisse für aktuelle Strategien bewertet. Der Einfluss institutioneller und konjunktureller Faktoren wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Geldpolitik, Zentralbanken, EZB, ESZB, mehrstufige geldpolitische Konzeptionen, Zwischenziele, Endziele, regelgebundene Geldpolitik, diskretionäre Geldpolitik, geldpolitische Instrumente, Offenmarktgeschäfte, Fazilitätenpolitik, Mindestreservepolitik, Geldmengensteuerung, Zinspolitik, Inflationssteuerung, Wechselkurs, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität.
- Quote paper
- Gülten Yamik (Author), 2007, Mehrstufige geldpolitische Konzeptionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/122583