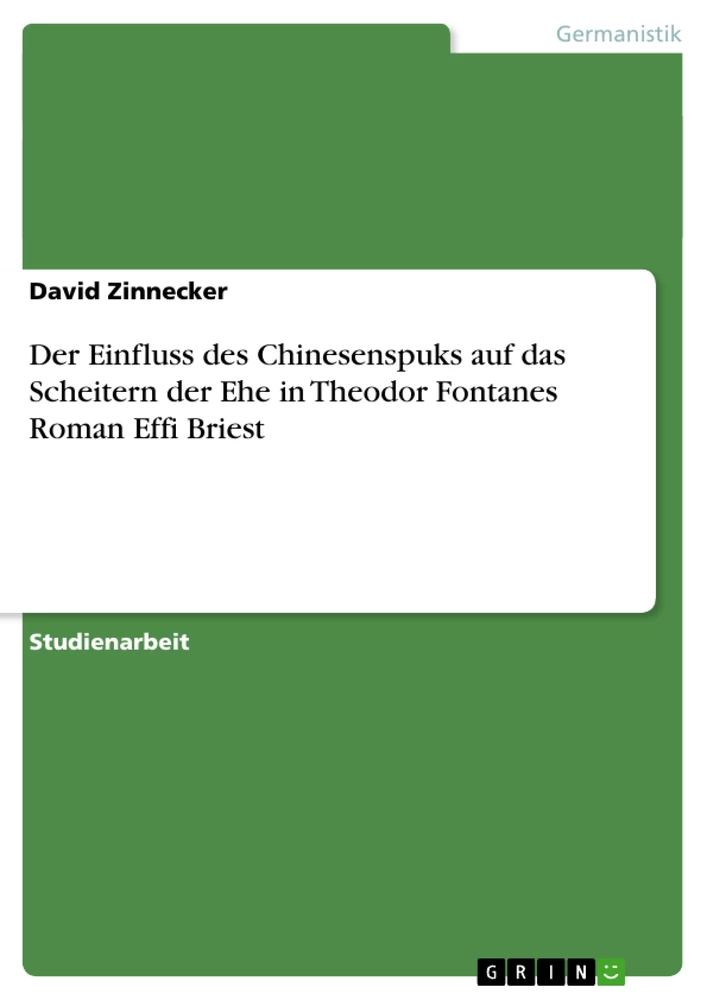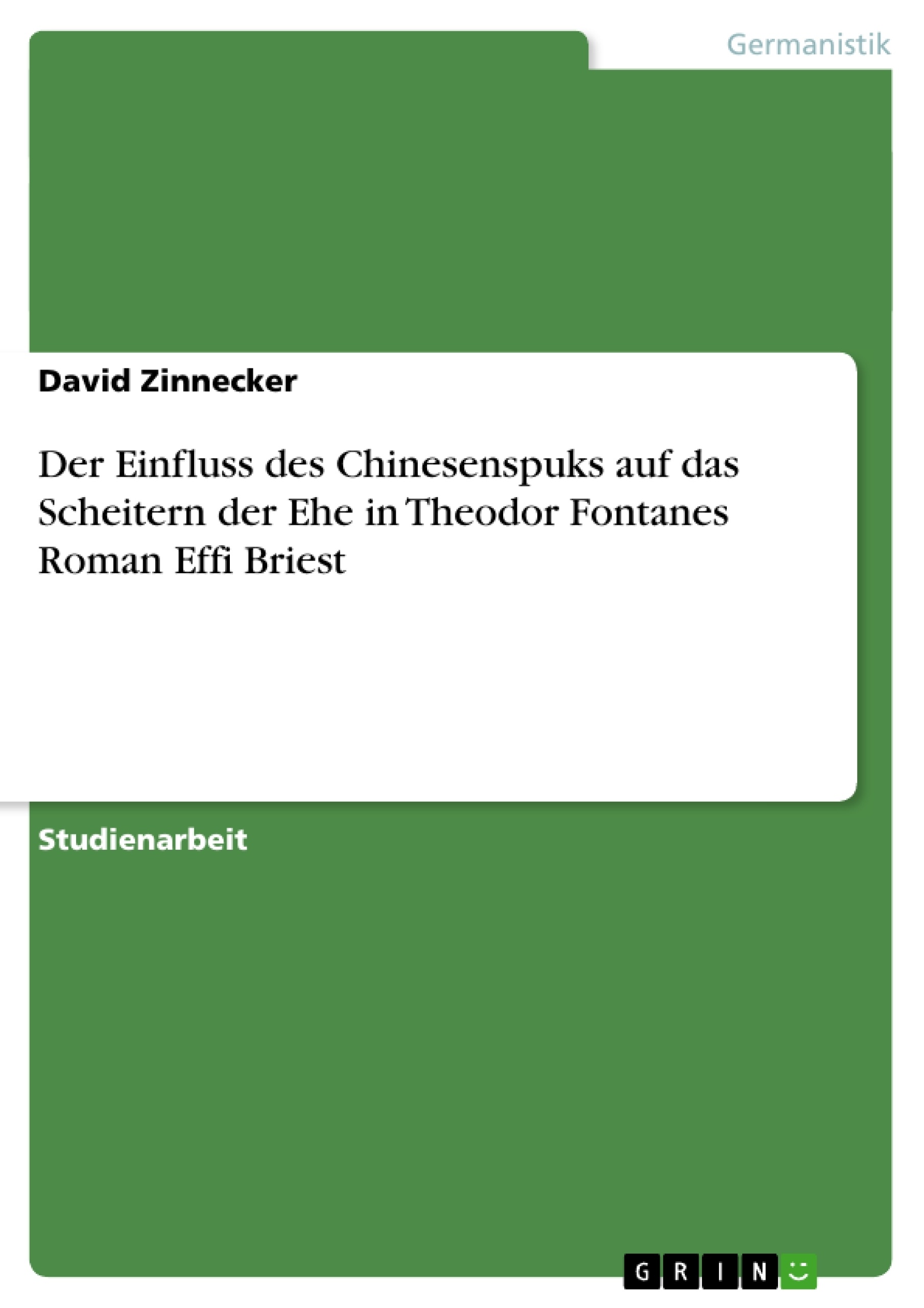Theodor Fontane schrieb seinen Roman Effi Briest mit Unterbrechungen in den Jahren von 1889 bis 1894. Der Vorabdruck erschien von Oktober 1894 bis zum März 1895 in der Deutschen Rundschau, ebenfalls im Jahr 1895 folgte die Buchausgabe des Romans, der bei Lesern und Kritikern eine hohe Gunst gewann.
Stofflich beruht der Roman auf einer wahren Ehebruchsgeschichte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Damals beging Elisabeth von Ardenne, die Gattin des Freiherren Armand von Ardenne, einen Ehebruch mit dem Düsseldorfer Amtsrichter Emil Hartwich, woraufhin dieser im Duell mit Ardenne fiel.
Der Roman handelt von der jungen adeligen Effi von Briest, die sich mit 17 Jahren mit dem ebenfalls adeligen 38jährigen Jugendfreund ihrer Mutter, Geert von Innstetten, verheiratet. Ihr Leben in der preußischen Provinz mit dem Landrat ist geprägt von Langeweile und Vernachlässigung durch ihren Ehemann. Das Fehlen von Intimität und Sinnlichkeit sowie das Nichtzustandekommen menschlicher Beziehungen führen schließlich, gepaart mit einem von Innstetten inszenierten Spuk, zum Ehebruch Effis mit Major Crampas. Die Konsequenz dieser Tat, die nach über sechs Jahren ans Licht kommt, ist die Scheidung von Innstetten und die Verbannung aus der Gesellschaft. Crampas stirbt im Duell mit Innstetten. Effi erkrankt schließlich schwer und stirbt im Alter von 29 Jahren auf dem Anwesen ihrer Eltern.
In meiner Arbeit möchte ich die Gründe für das Scheitern der Ehe zwischen Effi und Innstetten genauer beleuchten. Dabei werde ich besonders auf die Bedeutung des Chinesenspuks eingehen, die meiner Meinung nach einen Drehpunkt des Romans darstellt und somit auch großen Einfluss auf den Fehltritt Effis hat. Fontane selber hat in einem Brief an Viktor Widmann die wichtige Bedeutung des Chinesen im Roman herausgestellt:
„Sie sind der erste, der auf das Spukhaus und den Chinesen hinweißt; ich begreife nicht, wie man daran vorbeisehen kann, denn erstlich ist dieser Spuk, so bilde ich mir wenigstens ein, an und für sich interessant, und zweitens, wie Sie hervorgehoben haben, steht die Sache nicht zum Spaß da, sondern ist Drehpunkt für die ganze Geschichte.“
Zwar relativiert Fontane selber die Bedeutung des Spuks zuerst dadurch, dass er ihn nur als interessant erachtet. Das Motiv des spukenden Chinesen zieht sich jedoch durch den gesamten Roman und offenbart ein dichtes Verweisungsnetz, weshalb ich es als zentral ansehe und die Verstrickung der Romanfiguren mit dem Spuk genauer untersuchen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Chinesenspuk
- Das Chinesenbild in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts
- Der Chinese als Angstbild Effis
- Der Chinese als Symbol der Begierde
- Ursachen für das Scheitern der Ehe
- Verzahnung der Ehebruchsgeschichte mit dem Chinesenmotiv
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für das Scheitern der Ehe zwischen Effi und Innstetten in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest". Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle des "Chinesenspuks" als zentralen Motiv. Die Arbeit analysiert, wie Fontane dieses Motiv einsetzt, um die Konflikte und das Schicksal der Protagonistin zu beleuchten.
- Die Darstellung des Chinesen als Symbol für das Fremde, Exotische und Unheimliche
- Der Einfluss des "Chinesenspuks" auf Effis Psyche und ihr Handeln
- Die gesellschaftlichen Konventionen und die Ehe als einengendes Korsett
- Die Langeweile und Vernachlässigung in Effis Ehe
- Die Verbindung zwischen dem Chinesenmotiv und dem Ehebruch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in den Roman "Effi Briest" von Theodor Fontane ein, beleuchtet den historischen Hintergrund der Handlung und die reale Begebenheit, auf der der Roman basiert. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für das Scheitern der Ehe zwischen Effi und Innstetten und hebt die Bedeutung des Chinesenspuks als Dreh- und Angelpunkt der Erzählung hervor, wobei Fontanes eigene Einschätzung zu diesem Motiv zitiert wird.
Der Chinesenspuk: Dieses Kapitel analysiert das Motiv des Chinesen im Roman. Es beginnt mit der ersten Erwähnung des Chinesen und dem Kontrast zwischen dem idyllischen Grab und dem Schauerlichen, das damit verbunden ist. Effis ambivalente Reaktion – Faszination und Angst zugleich – wird detailliert beschrieben und im Kontext des damaligen chinesischen Bildes in Deutschland interpretiert. Die Kapitel analysiert weiter die widersprüchliche Wahrnehmung des Chinesen als fleißig und hinterlistig, und wie diese Ambivalenz Effis emotionale Verfassung beeinflusst.
Ursachen für das Scheitern der Ehe: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den komplexen Ursachen des Ehebruchs und des Scheiterns der Ehe zwischen Effi und Innstetten. Es untersucht, wie das Motiv des Chinesenspuks mit der Geschichte des Ehebruchs verwoben ist und wie es die Handlung vorantreibt und Effis Handlungen beeinflusst. Es geht über eine einfache Kausalität hinaus und beleuchtet die vielschichtigen sozialen, psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zum Scheitern der Ehe beitragen.
Schlüsselwörter
Effi Briest, Theodor Fontane, Chinesenspuk, Ehebruch, Gesellschaftliche Konventionen, Prussianismus, Exotik, Angst, Langeweile, Vernachlässigung, Psychologie, Romananalyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Chinesenspuk in Fontanes Effi Briest"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Ursachen für das Scheitern der Ehe zwischen Effi und Innstetten in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest", wobei besonderes Augenmerk auf die Rolle des "Chinesenspuks" als zentrales Motiv gelegt wird. Es wird untersucht, wie Fontane dieses Motiv einsetzt, um die Konflikte und das Schicksal der Protagonistin zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung des Chinesen als Symbol für das Fremde, Exotische und Unheimliche, den Einfluss des "Chinesenspuks" auf Effis Psyche und ihr Handeln, die gesellschaftlichen Konventionen und die Ehe als einengendes Korsett, die Langeweile und Vernachlässigung in Effis Ehe sowie die Verbindung zwischen dem Chinesenmotiv und dem Ehebruch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum "Chinesenspuk", ein Kapitel zu den Ursachen des Ehebruchs und ein Fazit. Die Einleitung führt in den Roman und die Forschungsfrage ein. Das Kapitel zum "Chinesenspuk" analysiert das Motiv im Detail, während das Kapitel zu den Ursachen des Ehebruchs die komplexen Hintergründe des Ehe-Scheiterns beleuchtet. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt der "Chinesenspuk" im Roman?
Der "Chinesenspuk" ist ein zentrales Motiv im Roman, das die Konflikte und das Schicksal Effis widerspiegelt. Er symbolisiert das Fremde, Exotische und Unheimliche und beeinflusst Effis Psyche und ihr Handeln. Die Arbeit analysiert die ambivalente Wahrnehmung des Chinesen – als faszinierend und angsteinflößend zugleich – und seine Verbindung zum Ehebruch.
Welche Ursachen für das Scheitern der Ehe werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die komplexen Ursachen des Ehebruchs und des Scheiterns der Ehe zwischen Effi und Innstetten. Sie betrachtet nicht nur eine einfache Kausalität, sondern beleuchtet die vielschichtigen sozialen, psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zum Scheitern der Ehe beitragen, wie z.B. gesellschaftliche Konventionen, Langeweile, Vernachlässigung und die Verknüpfung dieser Faktoren mit dem "Chinesenspuk".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Effi Briest, Theodor Fontane, Chinesenspuk, Ehebruch, Gesellschaftliche Konventionen, Prussianismus, Exotik, Angst, Langeweile, Vernachlässigung, Psychologie, Romananalyse.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit zitiert Fontanes eigene Einschätzung zum Motiv des Chinesenspuks und bezieht sich auf den Roman "Effi Briest" selbst sowie den historischen Kontext der Handlung. Weitere Quellen werden im Text selbst benannt (obwohl diese im gegebenen Auszug nicht explizit aufgeführt sind).
- Quote paper
- David Zinnecker (Author), 2006, Der Einfluss des Chinesenspuks auf das Scheitern der Ehe in Theodor Fontanes Roman Effi Briest, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/122487