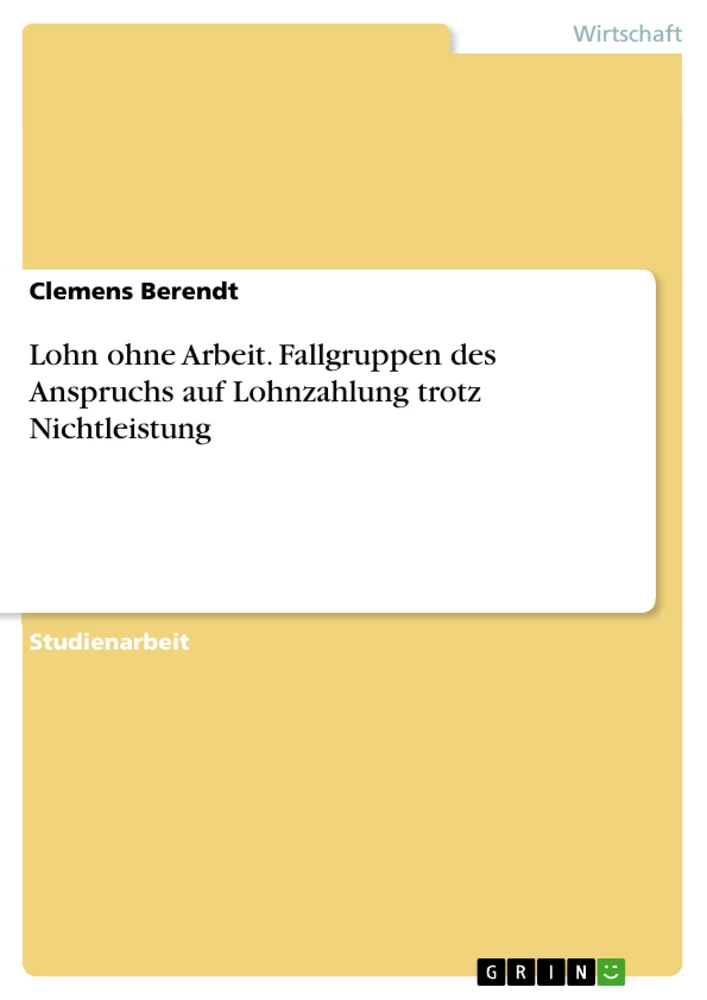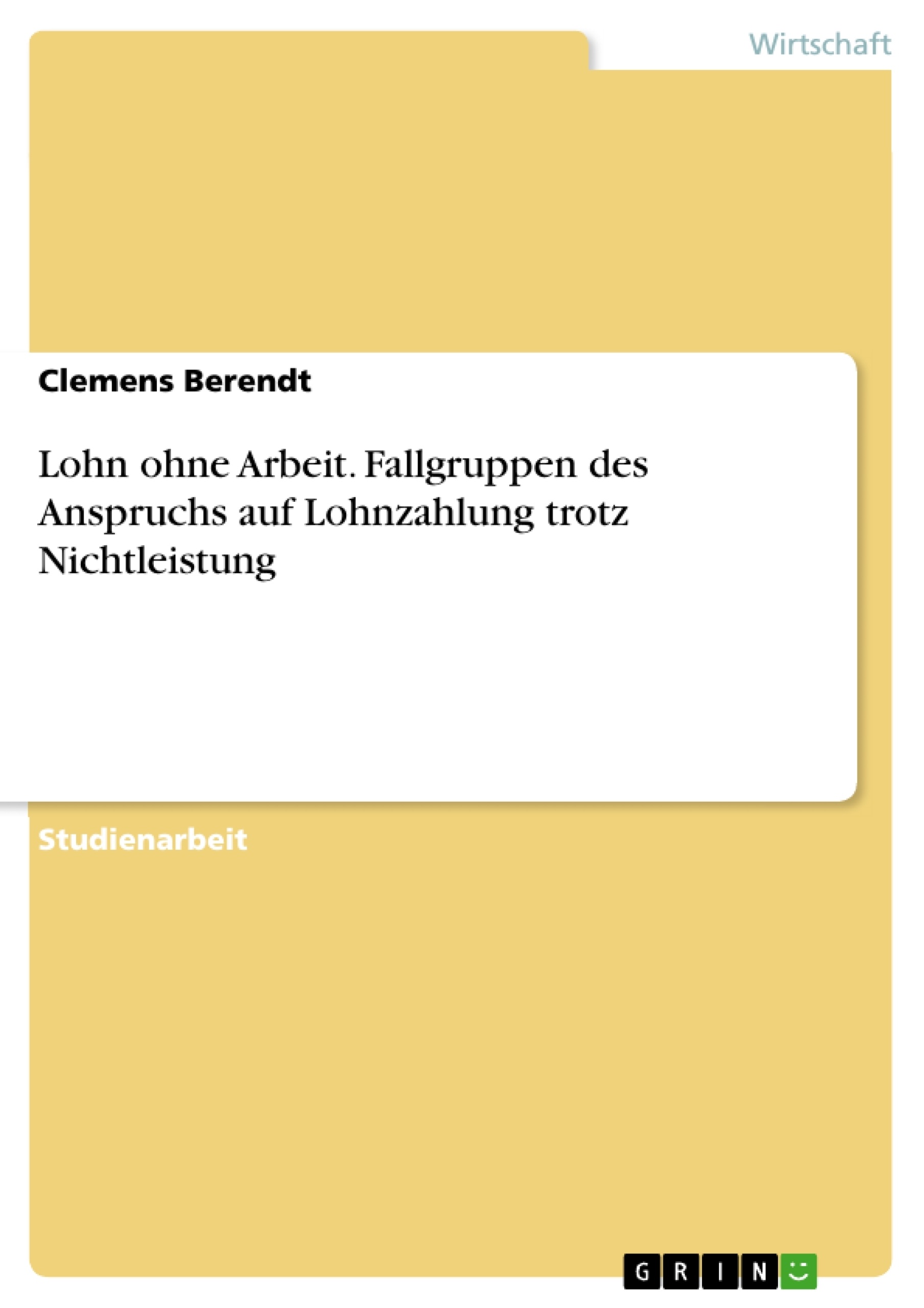Aus einem gegenseitigen Arbeitsvertrag ergibt sich nach § 611 Abs. 1 BGB die Pflicht des Arbeitnehmers zur Erbringung der Arbeitsleistung und die Pflicht des Arbeitgebers zur Gewährung der Vergütung in synallagmatischer Beziehung gem. § 320 BGB. Fraglich ist, ob der Anspruch auf Lohnzahlung seitens des Arbeitnehmers und die Vergütungspflicht des Arbeitgebers bestehen bleiben, wenn die Arbeitsleistung aufgrund von Hindernissen vom Arbeitnehmer nicht erbracht werden kann.
Der Arbeitspflicht wird Fixschuldcharakter zugemessen, was bedeutet, dass diese zeitlich gebunden ist und bei Nichtleistung auch nicht nachholbar ist, so dass gem. § 275 Abs. 1 BGB aufgrund von Unmöglichkeit die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers entfällt. Aus der synallagmatischen Verknüpfung der beiderseitigen Erfüllungsansprüche in Form des § 326 Abs. 1 BGB folgt, dass im Gegenzug der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Lohnzahlung verliert. Ferner ist die Fälligkeit des Arbeitsentgeltes gem. § 614 BGB grundsätzlich erst nach Vorleistung durch den Arbeitnehmer gegeben. Es ergibt sich demzufolge der Grundsatz: "Ohne Arbeit kein Lohn".
Im Arbeitsrecht gibt es jedoch eine große Anzahl von Ausnahmen, die diese Regel durchbrechen und eine Vergütungspflicht bzw. ein Lohnanspruch trotz Nichtleistung von Arbeit besteht. Dies wird innerhalb der vorliegenden Arbeit anhand der wichtigsten Fallgruppen dargestellt, wobei zunächst auf den Annahmeverzug des Arbeitgebers sowie die Lehre vom Betriebsrisiko eingegangen wird und darauf folgend Fälle der vorübergehenden persönlichen Verhinderung behandelt werden. Schwerpunktmäßig wird die Fallgruppe der Krankheit des Arbeitnehmers betrachtet. Abschließend erfolgt eine kurze Darstellung weiterer Fälle, in denen der Arbeitnehmer unter Beibehaltung des Lohnanspruches kraft Gesetzes von der Arbeitspflicht freigestellt ist, ohne dass die Darstellung einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung – Gang der Darstellung
- B. Fallgruppen des Anspruchs auf Lohnzahlung trotz Nichtleistung
- § 1 Annahmeverzug des Arbeitgebers
- 1. Allgemein: § 615 BGB
- 2. Abgrenzung von Verzug und Unmöglichkeit
- 3. Anwendungsbereich und Voraussetzungen
- 4. Rechtsfolge: Vergütungsanspruch
- § 2 Betriebs- und Wirtschaftsrisiko
- 1. Lehre durch das BAG
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Arbeitskampf
- § 3 Vorübergehende Arbeitsverhinderung aus persönlichen Gründen
- 1. Allgemein: § 616 S. 1 BGB
- 2. Anwendungsbereich
- 3. Bedeutung des „Neuen Schuldrechts“
- § 4 Krankheit des Arbeitnehmers
- 1. Anspruchsnorm: § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG
- 2. Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
- 3. Kausalität zwischen Krankheit und Arbeitsverhinderung
- 4. Kein Verschulden des Arbeitnehmers
- 5. Rechtsfolge: Entgeltfortzahlungsanspruch
- § 5 Entgeltzahlung an Feiertagen
- § 6 Urlaub des Arbeitnehmers
- 1. Erholungsurlaub
- 2. Bildungsurlaub
- § 7 Weitere Einzelfälle
- 1. Schwangerschaft / Mutterschutz
- 2. Regelungen des BetrVG
- § 1 Annahmeverzug des Arbeitgebers
- C. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht den Anspruch auf Lohnzahlung trotz Nichtleistung der Arbeitskraft. Es beleuchtet verschiedene rechtliche Konstellationen, in denen ein Arbeitnehmer trotz Ausbleibens der Arbeitsleistung Anspruch auf Lohnzahlung hat. Die Arbeit analysiert die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die dazugehörige Rechtsprechung.
- Annahmeverzug des Arbeitgebers
- Betriebs- und Wirtschaftsrisiko
- Arbeitsverhinderung aus persönlichen Gründen (inkl. Krankheit)
- Entgeltfortzahlung bei Krankheit und an Feiertagen
- Urlaubsansprüche
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung – Gang der Darstellung: Dieses einleitende Kapitel skizziert den Aufbau und die Methodik des Referats. Es beschreibt den systematischen Ablauf der Analyse von Lohnansprüchen trotz Nichtleistung der Arbeitskraft, wobei die verschiedenen Fallgruppen und relevanten Gesetzesparagrafen vorgestellt werden. Die Einführung dient als Orientierungshilfe und schafft eine Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel.
B. Fallgruppen des Anspruchs auf Lohnzahlung trotz Nichtleistung: Dieses zentrale Kapitel untersucht verschiedene Szenarien, in denen ein Arbeitnehmer trotz Nichtleistung seiner Arbeit Anspruch auf Lohnzahlung hat. Es werden dabei die juristischen Grundlagen und die dazugehörige Rechtsprechung detailliert analysiert. Die verschiedenen Paragrafen (§ 1-7) beleuchten dabei spezifische Situationen wie Annahmeverzug des Arbeitgebers, Betriebs- und Wirtschaftsrisiken, Arbeitsverhinderung durch Krankheit oder persönliche Gründe, sowie die Entgeltzahlung an Feiertagen und die Ansprüche auf Urlaub (Erholungsurlaub und Bildungsurlaub). Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung der jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen und den daraus resultierenden Rechtsfolgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das Kapitel vermittelt ein umfassendes Verständnis der komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen im Arbeitsrecht.
C. Zusammenfassung: (Diese Zusammenfassung wird aufgrund der Anweisungen ausgelassen, da sie am Ende des Dokuments steht und potenziell Spoiler enthalten könnte.)
Schlüsselwörter
Lohnzahlung, Nichtleistung, Annahmeverzug, Betriebsrisiko, Arbeitsverhinderung, Krankheit, Urlaub, Entgeltfortzahlung, Arbeitsrecht, BGB, EFZG, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Referat: Lohnzahlung trotz Nichtleistung
Was ist der Gegenstand des Referats?
Das Referat untersucht den Anspruch auf Lohnzahlung, obwohl der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht erbringt. Es analysiert verschiedene rechtliche Konstellationen und die dazugehörige Rechtsprechung.
Welche Fallgruppen werden im Referat behandelt?
Das Referat behandelt folgende Fallgruppen: Annahmeverzug des Arbeitgebers, Betriebs- und Wirtschaftsrisiko, vorübergehende Arbeitsverhinderung aus persönlichen Gründen (einschließlich Krankheit), Entgeltzahlung an Feiertagen, Urlaub des Arbeitnehmers (Erholungsurlaub und Bildungsurlaub) und weitere Einzelfälle wie Schwangerschaft/Mutterschutz und Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG).
Welche gesetzlichen Bestimmungen sind relevant?
Die relevanten gesetzlichen Bestimmungen umfassen § 615 BGB (Annahmeverzug), § 616 S. 1 BGB (vorübergehende Arbeitsverhinderung), § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) und weitere Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG).
Wie ist das Referat strukturiert?
Das Referat ist in drei Hauptteile gegliedert: Eine Einführung, die den Aufbau und die Methodik beschreibt; einen Hauptteil, der die verschiedenen Fallgruppen detailliert analysiert; und eine Zusammenfassung (die im bereitgestellten Auszug fehlt).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Referats?
Schlüsselwörter sind: Lohnzahlung, Nichtleistung, Annahmeverzug, Betriebsrisiko, Arbeitsverhinderung, Krankheit, Urlaub, Entgeltfortzahlung, Arbeitsrecht, BGB, EFZG, Rechtsprechung.
Welche Kapitel beinhaltet das Referat?
Das Referat umfasst die Kapitel: A. Einführung – Gang der Darstellung; B. Fallgruppen des Anspruchs auf Lohnzahlung trotz Nichtleistung (unterteilt in mehrere Paragraphen zu den einzelnen Fallgruppen); C. Zusammenfassung.
Wo liegt der Schwerpunkt der Analyse?
Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der juristischen Grundlagen und der Rechtsprechung zu den einzelnen Fallgruppen. Es werden die Voraussetzungen für einen Lohnanspruch trotz Nichtleistung detailliert untersucht und die jeweiligen Rechtsfolgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erläutert.
Für wen ist dieses Referat relevant?
Das Referat ist relevant für Studierende des Arbeitsrechts, Juristen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich mit Fragen der Lohnzahlung bei Nichtleistung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Clemens Berendt (Author), 2003, Lohn ohne Arbeit. Fallgruppen des Anspruchs auf Lohnzahlung trotz Nichtleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12214