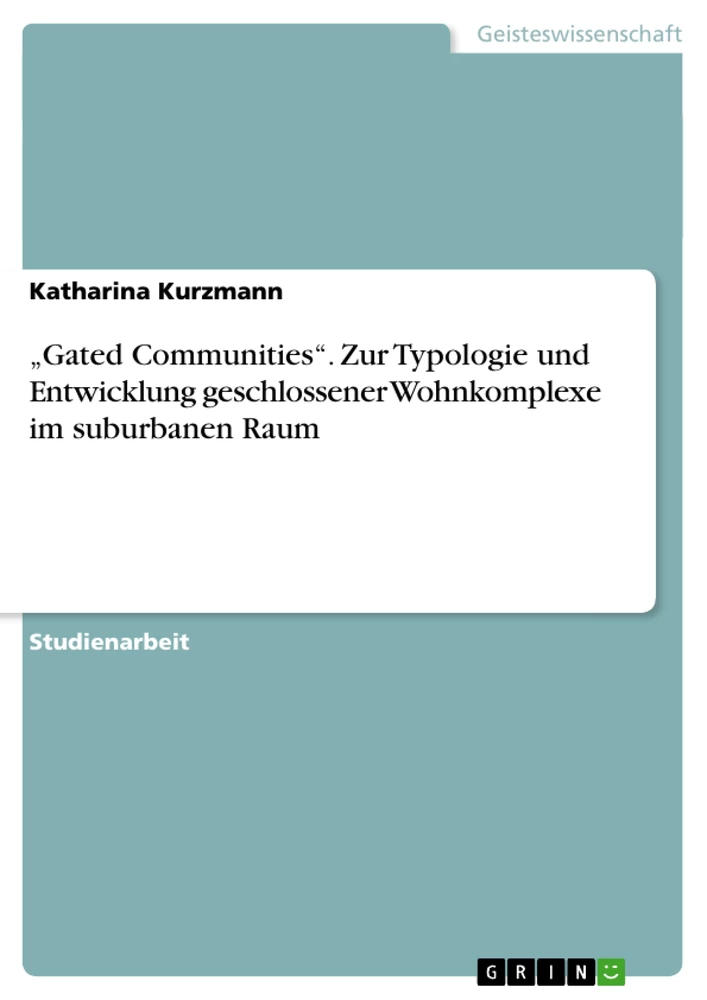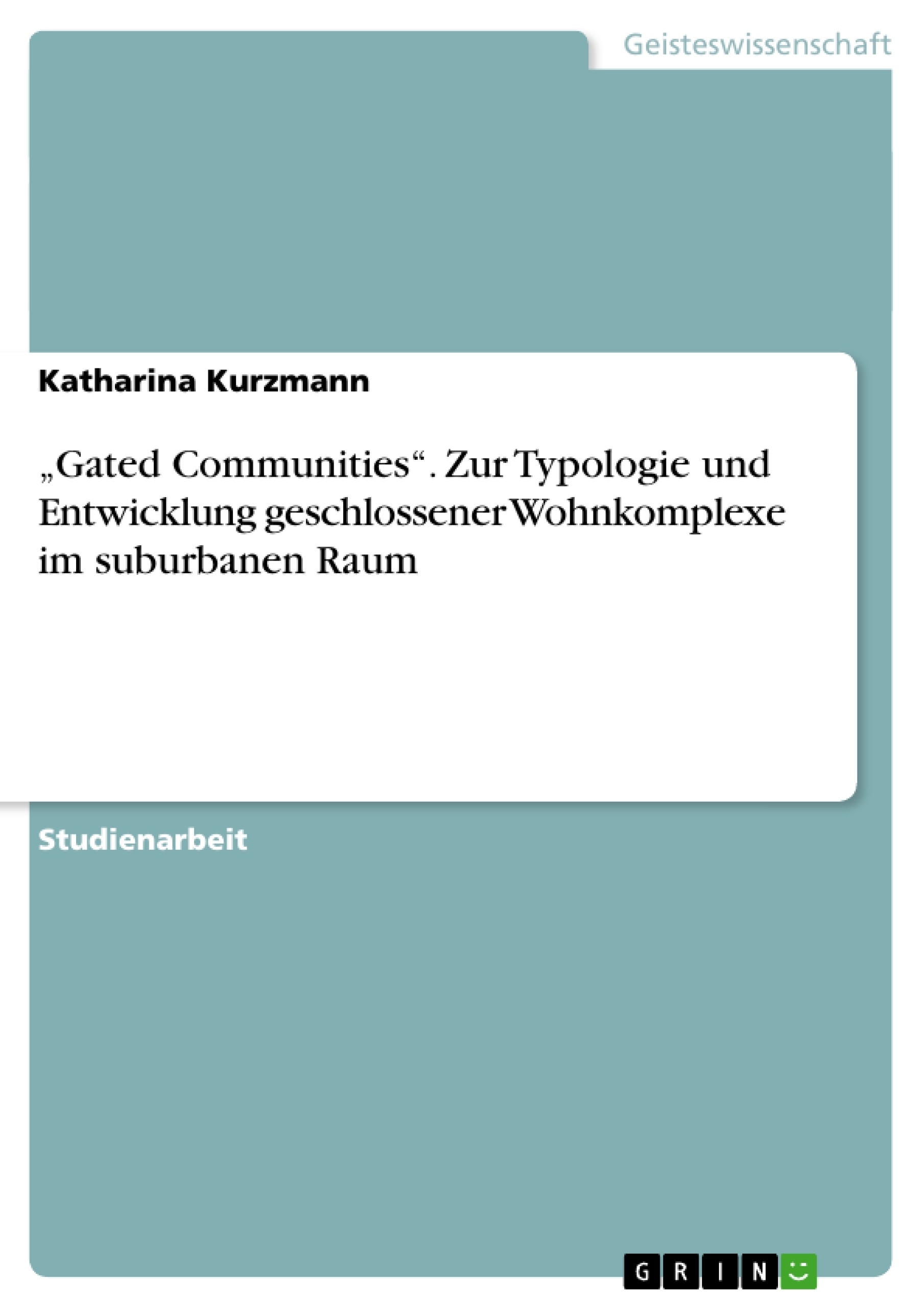Um den Einstieg in diese Thematik zu erleichtern, soll zu Anfang der Begriff „Gated Community“ in Kapitel 2. definiert werden. In Kapitel 2.1 soll diese Definition um die Aspekte der Segregation und des räumlichen Ausschlusses erweitert werden.
Im Vordergrund dieser Arbeit steht neben der Entwicklung und den Gründen für die Entstehung geschlossener Wohnkomplexe die Typologie dieser. Dazu werden die Klassifikationen drei bzw. vier verschiedener Autoren in Kapitel 3. vorgestellt. Die Autoren Glasze, Blakely/Snyder und Wehrheim ordnen und klassifizieren die verschiedenen Arten dieser Wohnform anhand sehr unterschiedlicher Aspekte. Doch erscheint es wichtig, die verschiedenen Blickwinkel zu erfassen, um zu einem, alle Sichtweisen einbeziehenden, Ergebnis zu gelangen.
Kapitel 4. ist dem zweiten Hauptaspekt dieser Arbeit gewidmet. Darin soll zunächst in Kapitel 4.1 der historische Aspekt geschlossener Wohnkomplexe dargestellt und die Frage geklärt werden, ob geschlossene Wohnkomplexe tatsächlich so neu sind, wie es zunächst den Anschein erweckt, ob sie ihren Ursprung in den USA haben oder es möglicherweise städtebauliche Vorläufer gibt, die sich mit Gated Communities in Verbindung setzen lassen und ob diese Wohnform eine „Bedrohung“ für Städte und öffentliche Haushalte werden.
Daran schließen sich in Kapitel 4.2 die Ausführungen über die Entwicklung und die Hintergründe geschlossener Wohnkomplexe an, die vor allem in den USA zu einer ubiquitären Erscheinung geworden sind.
Kapitel 4.3 wird dazu dienen, die Frage zu beantworten, ob geschlossene Wohnkomplexe ein Modell für die Zukunft sind oder ob sich der momentane „Boom“ nicht als Trend erweist. Da diese Wohnform erst in den 1990er Jahren in den Blickwinkel von Medien und Forschung gerückt ist und Autoren mittlerweile eben von einem „Boom“ dieser Wohnform in vielen Teilen der Welt sprechen, erscheint es gerade sinnvoll den Aspekt der Entstehung von Gated Communities zu beleuchten. Dieser Gesichtspunkt soll deshalb innerhalb dieser Arbeit im Blick behalten und mit einem Ausblick in die Zukunft der Gated Communities verbunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition - Gated Community
- 2.1 Kriterien der Segregation und des räumlichen Ausschlusses
- 3. Zur Typologie geschlossener Wohnkomplexe
- 3.1 Bauliche und funktionale Unterscheidung bei Glasze
- 3.2 Lifestyle-, Prestige- und Security Zone Communities bei Blakely/Snyder
- 3.3 Neu und bereits bestehende Siedlungen und Gebäudekomplexe bei Wehrheim
- 4. Zur Entwicklung geschlossener Wohnkomplexe
- 4.1 Vorläufer geschlossenen Wohnkomplexe - Von Villenkolonien und Gartenstädten
- 4.2 Gründe für die Entstehung geschlossener Wohnkomplexe
- 4.3 Ein Modell der Zukunft?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der „Gated Communities“, ihrer Typologie und Entwicklung im suburbanen Raum. Die Arbeit analysiert verschiedene Klassifikationen geschlossener Wohnkomplexe und beleuchtet deren historische Vorläufer. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Gründen für die Entstehung und der Frage nach ihrer Zukunftsfähigkeit.
- Definition und Abgrenzung von Gated Communities
- Typologisierung geschlossener Wohnkomplexe anhand verschiedener Autoren
- Historische Entwicklung und Vorläufer von Gated Communities
- Gründe für die Entstehung von Gated Communities
- Zukunftsperspektiven von Gated Communities
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Gated Communities ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die bevorstehende Definition des Begriffs „Gated Community“, die Erweiterung um Aspekte der Segregation und des räumlichen Ausschlusses, sowie die Vorstellung verschiedener Typologien geschlossener Wohnkomplexe. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und den Gründen für die Entstehung dieser Wohnform, mit einem Ausblick auf die Frage nach ihrer Zukunftsfähigkeit als Modell.
2. Definition-Gated Community: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Gated Community“ und den verwandten Begriff „Geschlossener Wohnkomplex“, wobei auf die Uneinigkeit in der Literatur bezüglich der Terminologie hingewiesen wird. Es wird eine Minimaldefinition nach Wehrhahn (2003) vorgestellt, ergänzt um weitere Kriterien von Glasze (2003). Diese Kriterien umfassen die Abgeschlossenheit durch physische Barrieren und Zugangsbeschränkungen, die private Infrastruktur und die Existenz einer Gemeinschaft mit Selbstverwaltung. Verschiedene Organisationsformen der Selbstverwaltung werden diskutiert, sowie deren demokratische Legitimität kritisch hinterfragt.
2.1 Kriterien der Segregation und des räumlichen Ausschlusses: Dieses Kapitel erweitert die Definition von Gated Communities um Aspekte der Segregation und des räumlichen Ausschlusses, mit Schlagworten wie Isolation, Separation und Ausgrenzung. Es wird erläutert, wie Gated Communities Bewohner sortieren und disziplinieren, um sie in die „Gemeinschaft“ zu integrieren. Wehrheims sieben Kriterien des räumlichen Ausschlusses (kategorische, moralische, ökonomische, temporäre, latente Ausschließung, physische Distanz und Ausschließungsmechanismen durch Technik, Recht, Personal und Architektur) werden kurz vorgestellt, ohne detaillierte Erläuterung.
3. Zur Typologie geschlossener Wohnkomplexe: Kapitel 3 präsentiert verschiedene Klassifikationen geschlossener Wohnkomplexe von Glasze, Blakely/Snyder und Wehrheim. Die Autoren verwenden unterschiedliche Aspekte zur Ordnung und Klassifizierung dieser Wohnform. Die Darstellung der verschiedenen Blickwinkel soll zu einem Ergebnis führen, das alle Sichtweisen einbezieht.
4. Zur Entwicklung geschlossener Wohnkomplexe: Kapitel 4 befasst sich mit der historischen Entwicklung geschlossener Wohnkomplexe. Es untersucht, ob es städtebauliche Vorläufer gibt und ob Gated Communities eine „Bedrohung“ für Städte und öffentliche Haushalte darstellen. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die Entwicklung und die Hintergründe, insbesondere im Hinblick auf die Verbreitung in den USA. Der „Boom“ dieser Wohnform in den 1990er Jahren wird als Anlass für eine detaillierte Betrachtung der Entstehung und die Zukunftsperspektiven von Gated Communities genannt.
Schlüsselwörter
Gated Communities, geschlossene Wohnkomplexe, Segregation, räumlicher Ausschluss, Typologie, Entwicklung, Villenkolonien, Gartenstädte, urbane Inszenierungen, soziale Distanz, Selbstverwaltung, private Infrastruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gated Communities - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Phänomen der „Gated Communities“, ihrer Typologie und Entwicklung im suburbanen Raum. Sie untersucht verschiedene Klassifikationen geschlossener Wohnkomplexe, beleuchtet deren historische Vorläufer und befasst sich mit den Gründen für ihre Entstehung und ihrer Zukunftsfähigkeit.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Gated Communities; Typologisierung geschlossener Wohnkomplexe anhand verschiedener Autoren (Glasze, Blakely/Snyder, Wehrheim); Historische Entwicklung und Vorläufer (Villenkolonien, Gartenstädte); Gründe für die Entstehung; Zukunftsperspektiven von Gated Communities; Kriterien der Segregation und des räumlichen Ausschlusses.
Wie wird der Begriff „Gated Community“ definiert?
Die Arbeit präsentiert eine Minimaldefinition nach Wehrhahn (2003), erweitert um Kriterien von Glasze (2003). Diese umfassen Abgeschlossenheit durch physische Barrieren und Zugangsbeschränkungen, private Infrastruktur und die Existenz einer Gemeinschaft mit Selbstverwaltung. Die kritische Auseinandersetzung mit der demokratischen Legitimität verschiedener Organisationsformen der Selbstverwaltung wird ebenfalls thematisiert.
Welche Aspekte der Segregation und des räumlichen Ausschlusses werden berücksichtigt?
Die Definition von Gated Communities wird um Aspekte der Segregation und des räumlichen Ausschlusses erweitert (Isolation, Separation, Ausgrenzung). Es wird untersucht, wie Gated Communities Bewohner sortieren und disziplinieren, um sie in die „Gemeinschaft“ zu integrieren. Wehrheims sieben Kriterien des räumlichen Ausschlusses werden kurz vorgestellt.
Welche Typologien geschlossener Wohnkomplexe werden vorgestellt?
Kapitel 3 vergleicht verschiedene Klassifikationen geschlossener Wohnkomplexe von Glasze, Blakely/Snyder und Wehrheim, die unterschiedliche Aspekte zur Ordnung und Klassifizierung verwenden. Ziel ist es, alle Sichtweisen in einem Ergebnis zusammenzuführen.
Wie wird die historische Entwicklung dargestellt?
Kapitel 4 untersucht die historische Entwicklung, mögliche städtebauliche Vorläufer (Villenkolonien, Gartenstädte) und die Frage, ob Gated Communities eine „Bedrohung“ für Städte und öffentliche Haushalte darstellen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung in den USA und dem „Boom“ der 1990er Jahre.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 5) wird im vorliegenden Textzusammenfassung nicht explizit dargestellt, aber es ist zu erwarten, dass es die Ergebnisse der Analyse der Definition, Typologie, Entwicklung und Zukunftsperspektiven von Gated Communities zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gated Communities, geschlossene Wohnkomplexe, Segregation, räumlicher Ausschluss, Typologie, Entwicklung, Villenkolonien, Gartenstädte, urbane Inszenierungen, soziale Distanz, Selbstverwaltung, private Infrastruktur.
- Quote paper
- Katharina Kurzmann (Author), 2008, „Gated Communities“. Zur Typologie und Entwicklung geschlossener Wohnkomplexe im suburbanen Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/120974