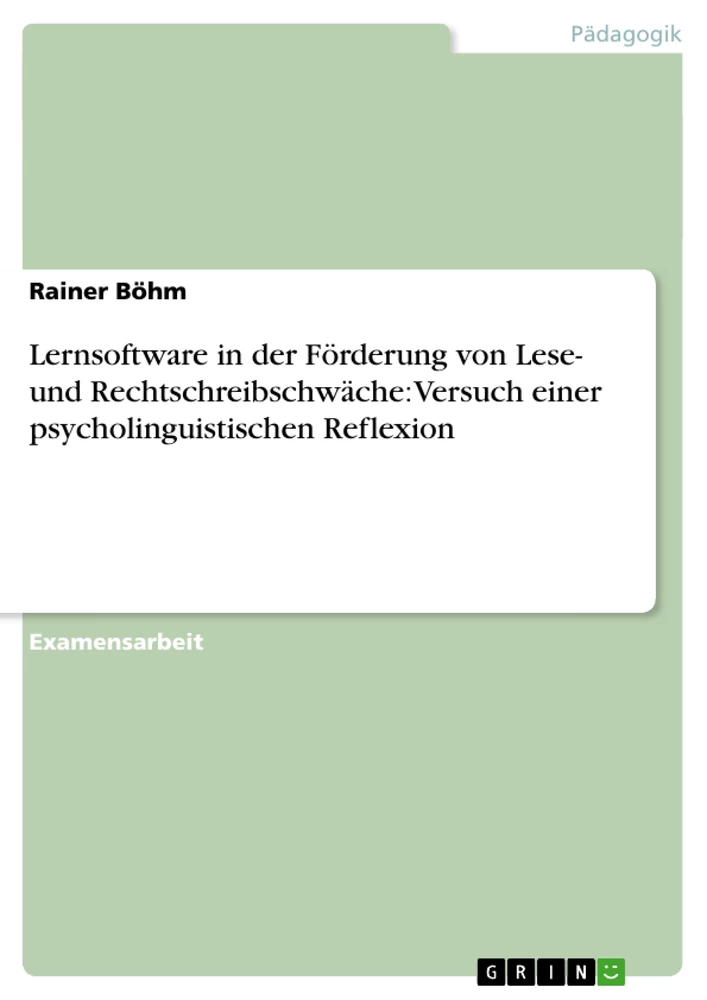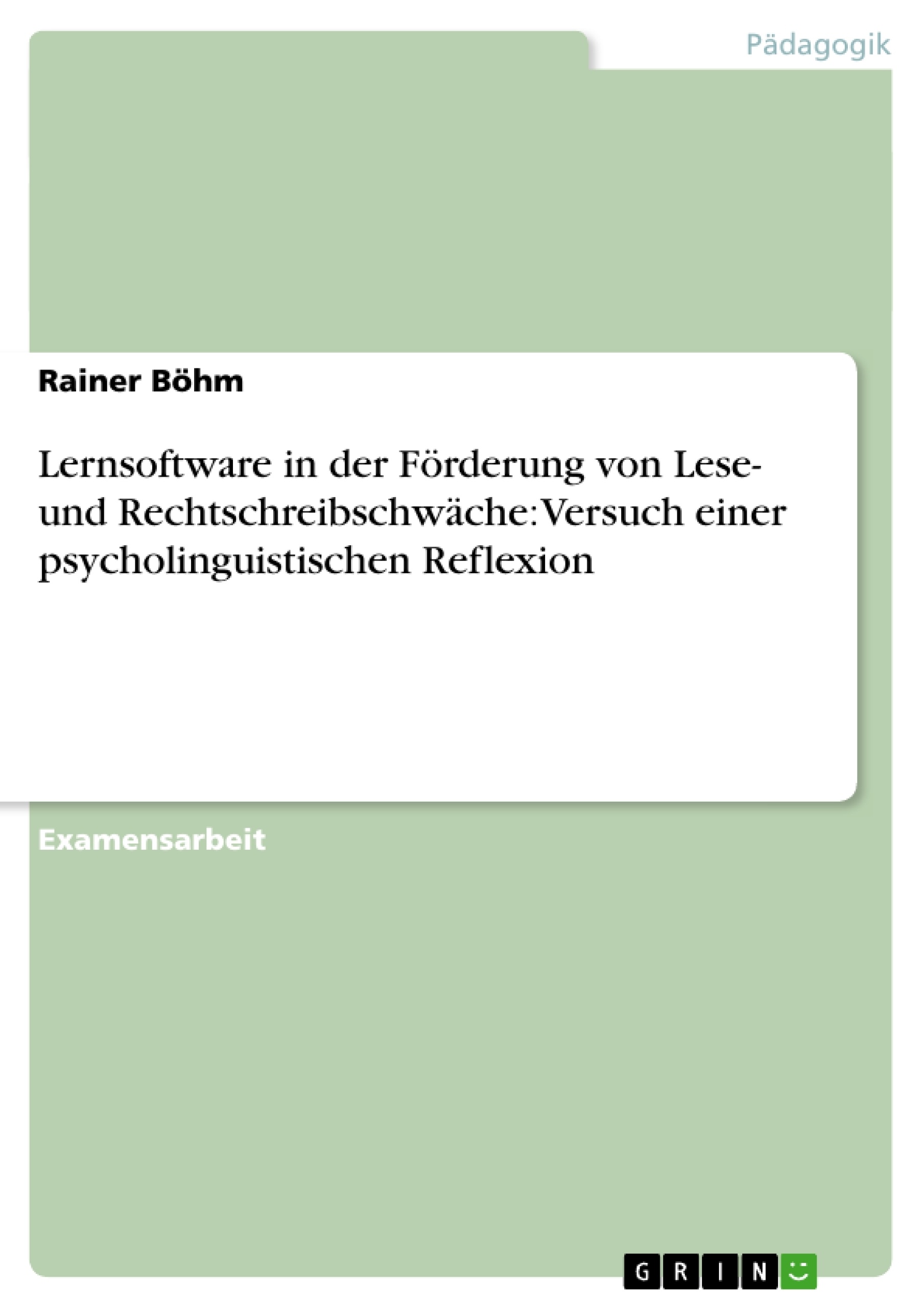In den letzten Jahren sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bei Kindern im
Grundschulalter in zunehmendem Maße als Problem identifiziert worden. Eine
Aussage über die Häufigkeit zu treffen ist ohne Bezugnahme auf operationalisierte
Kriterien schwierig. Man geht jedoch davon aus, dass ca. 10-15% der deutschen
Grundschulkinder deutliche Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben.1
Bedenkt man, dass z.B. die Stadt Heidelberg die Folgekosten von Therapie- und
Fördermaßnahmen für lese- und rechtschreibschwache Kinder kaum noch tragen
kann und deshalb verstärkt bereits in Kindergarten und Vorschule auf
Präventionsmaßnahmen setzt, wird die Tragweite des Problems Lese- und
Rechtschreibschwäche bei Kindern bewusst.2
Seit einigen Jahren greifen Lehrer und Therapeuten als Ergänzung zu
konventionellen Fördermaßnahmen im Rahmen der Gruppen- oder Einzelförderung
vermehrt auf Lernsoftware zum Lesen und Schreiben zurück. Auch die Eltern sind
bemüht, durch den Einsatz dieser Programme ihre möglicherweise betroffenen
Kinder zu fördern, bzw. die Software als Präventivmaßnahme einzusetzen.
Dementsprechend unübersichtlich ist der Markt für diese Programme inzwischen
geworden und die Grundlagen, auf denen die dort angebotenen Übungen basieren,
ebenso wie deren Qualität oder Erfolgsgarantie, bleiben oft fragwürdig.3
Auf der Seite der Forschung hat die Psycholinguistik in jüngerer Zeit ihre
Erkenntnisse und Modelle zum Lesen und Schreiben, zum Schriftspracherwerb und
somit auch zur Ermittlung von Ursachen für Lese-Rechtschreibschwäche stetig
erweitert. Die Frage nach der tatsächlichen Wirksamkeit solcher Fördersoftware kann im
Rahmen dieser Arbeit zwar nicht geklärt werden, vielmehr unternimmt sie den
Versuch, drei exemplarisch ausgesuchte Software-Programme auf Basis dieser
psycholinguistischen Erkenntnisse zu beleuchten, um deren theoretisches
Fundament abzuklopfen. [...]
1 KLICPERA & GASTEIGER-KLICPERA (1995, 227-228)
2 http://www.ph-heidelberg.de/wp/schoeler/EVES_Nr1.pdf/
3 Einen Überblick über neue Medien im Unterricht versucht die Datenbank SODIS http://www.sodis.de/ zu geben.
Hier im speziellen http://www.leu.bw.schule.de/allg/mmsoft/index.htm/
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gesprochene und geschriebene Sprache
- 2.1 Das Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache
- 2.2 Nicht-phonologische und phonologische Schriftsysteme
- 2.3 Die deutsche Sprache und ihre Verschriftungsprinzipien
- 2.4 Schlussbemerkung
- 3 Kognitive Modelle zur Schriftsprachverarbeitung
- 3.1 Vorbemerkung
- 3.2 Das Logogenmodell von Morton
- 3.3 Das interaktive Modell des Worterkennens
- 3.4 Gemeinsames Modell für das Lesen und Schreiben
- 3.4.1 Vorbemerkung
- 3.4.2 Lesen
- 3.4.3 Schreiben
- 3.5 Zur Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses
- 3.6 Schlussbemerkung
- 4 Entwicklungmodelle des Schriftspracherwerbs
- 4.1 Vorbemerkung
- 4.2 Das sechsphasenmodell des Lesen- und Schreibenlernens nach Frith
- 4.3 Der Ansatz von Ehri
- 4.4 Das Orthographic Framework Model
- 4.5 Schlussbemerkung
- 5 Die phonologische Bewusstheit
- 5.1 Vorbemerkung
- 5.2 Definitionen
- 5.3 Rolle der phonologischen Bewusstheit beim Schriftspracherwerb
- 5.4 Schlussbemerkung
- 6 Störungen des Lesens und Schreibens
- 6.1 Definitionen
- 6.2 Betrachtung von Störungen auf Basis der vorgestellten Theorien und Modelle
- 6.2.1 Visuell-perzeptuelle Aspekte
- 6.2.2 Phonologische Verarbeitungsschwächen
- 6.2.3 Schwierigkeiten bei der Ausnutzung von Informationen hinsichtlich orthographischer Regelmäßigkeiten, Morphemaufbau und Silbenunterteilung
- 6.3 Erklärung der Lese-Rechtschreibschwäche anhand des Entwicklungsmodells des Schriftspracherwerbs von Frith
- 6.4 Lese-Rechtschreibschwäche im Kontext des Prozessmodells
- 6.5 Implikationen für die Betrachtung von Lernsoftware
- 7 Versuch der psycholinguistischen Reflexion ausgewählter Lernsoftware
- 7.1 Vorbemerkung
- 7.2 CESAR LESEN 1.0 - Zur Unterstützung der Legasthenie-Therapie
- 7.2.1 Vorbemerkung
- 7.2.2 Beschreibung und psycholinguistische Betrachtung
- 7.2.3 Zusammenfassende Bemerkung zur CD-ROM CESAR LESEN
- 7.3 Duden-Lernsoftware Ich lerne Lesen 1&2
- 7.3.1 Vorbemerkung
- 7.3.2 Beschreibung und psycholinguistische Betrachtung
- 7.3.3 Zusammenfassende Bemerkung zur Duden-Lernsoftware Ich lerne Lesen 1&2
- 7.4 Die Software „Lese-Zeile“
- 8 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Lernsoftware zur Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Ziel ist es, ausgewählte Softwareprogramme anhand psycholinguistischer Erkenntnisse zu analysieren und deren theoretisches Fundament zu bewerten. Die Arbeit trägt damit zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Markt der Lernsoftware bei.
- Kognitive Modelle der Schriftsprachverarbeitung
- Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs
- Rolle der phonologischen Bewusstheit
- Störungen des Lesens und Schreibens
- Psycholinguistische Analyse von Lernsoftware
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt das zunehmende Problem von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bei Grundschulkindern und den damit verbundenen hohen Folgekosten. Sie erläutert den wachsenden Einsatz von Lernsoftware als Fördermaßnahme und die damit verbundene Notwendigkeit einer kritischen Beurteilung der angebotenen Programme aufgrund der oft fragwürdigen Grundlagen und Qualität. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, ausgewählte Lernsoftware anhand psycholinguistischer Erkenntnisse zu analysieren.
2 Gesprochene und geschriebene Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet das Verhältnis zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, unterscheidet zwischen phonologischen und nicht-phonologischen Schriftsystemen und analysiert die Prinzipien der deutschen Verschriftung. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der kognitiven Prozesse beim Lesen und Schreiben.
3 Kognitive Modelle zur Schriftsprachverarbeitung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene kognitive Modelle, wie das Logogenmodell und das interaktive Modell des Worterkennens, um die Prozesse des Lesens und Schreibens zu erklären. Es wird ein gemeinsames Modell für Lesen und Schreiben vorgestellt, wobei die Rolle des Arbeitsgedächtnisses hervorgehoben wird. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Lese- und Rechtschreibstörungen.
4 Entwicklungmodelle des Schriftspracherwerbs: Hier werden verschiedene Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs, wie das sechsphasige Modell von Frith und der Ansatz von Ehri, diskutiert. Diese Modelle beschreiben die Stufen des Schriftspracherwerbs und bieten einen Rahmen zum Verständnis der Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten sowie deren Störungen. Das Orthographic Framework Model wird ebenfalls erläutert.
5 Die phonologische Bewusstheit: Dieses Kapitel definiert die phonologische Bewusstheit und untersucht deren Rolle beim Schriftspracherwerb. Es wird die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für das Verständnis und die Behandlung von Lese- und Rechtschreibstörungen hervorgehoben.
6 Störungen des Lesens und Schreibens: Dieses Kapitel definiert Lese- und Rechtschreibstörungen und analysiert sie auf Basis der zuvor vorgestellten Modelle. Es werden verschiedene Aspekte wie visuell-perzeptuelle Schwierigkeiten, phonologische Verarbeitungsschwächen und Probleme mit orthographischen Regelmäßigkeiten betrachtet. Die Erklärung von Lese-Rechtschreibschwäche anhand der Entwicklungsmodelle von Frith und im Kontext des Prozessmodells wird detailliert behandelt, um die Implikationen für die Betrachtung von Lernsoftware abzuleiten.
7 Versuch der psycholinguistischen Reflexion ausgewählter Lernsoftware: In diesem Kapitel werden exemplarisch drei Lernsoftware-Programme (CESAR LESEN 1.0, Duden-Lernsoftware Ich lerne Lesen 1&2 und Lese-Zeile) vorgestellt und unter Berücksichtigung der vorherigen Kapitel kritisch anhand ihrer psycholinguistischen Grundlagen bewertet. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Beschreibung und einer psycholinguistischen Betrachtung jeder Software.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwäche, Lernsoftware, Psycholinguistik, Kognitive Modelle, Entwicklung des Schriftspracherwerbs, Phonologische Bewusstheit, Schriftsprachverarbeitung, Legasthenie, Fördermaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Lernsoftware zur Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Der Hauptfokus dieser Arbeit liegt auf der Analyse von Lernsoftware, die zur Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche eingesetzt wird. Die Analyse erfolgt unter Berücksichtigung psycholinguistischer Erkenntnisse, um die theoretischen Grundlagen der Software zu bewerten und deren Einsatz kritisch zu hinterfragen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Schriftsprachverarbeitung und des Schriftspracherwerbs. Dazu gehören kognitive Modelle der Schriftsprachverarbeitung, Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs, die Rolle der phonologischen Bewusstheit, Störungen des Lesens und Schreibens (inkl. Legasthenie) und eine detaillierte psycholinguistische Analyse ausgewählter Lernsoftware-Programme.
Welche kognitiven Modelle werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene kognitive Modelle zur Schriftsprachverarbeitung vor, darunter das Logogenmodell von Morton und das interaktive Modell des Worterkennens. Ein besonderes Augenmerk liegt auf einem gemeinsamen Modell für Lesen und Schreiben, wobei die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses hervorgehoben wird.
Welche Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs, wie das sechsphasige Modell von Frith, den Ansatz von Ehri und das Orthographic Framework Model. Diese Modelle dienen als Grundlage zum Verständnis der Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten und deren Störungen.
Welche Rolle spielt die phonologische Bewusstheit?
Die Arbeit betont die wichtige Rolle der phonologischen Bewusstheit beim Schriftspracherwerb und bei der Behandlung von Lese- und Rechtschreibstörungen. Die Definition und Bedeutung der phonologischen Bewusstheit wird ausführlich erläutert.
Wie werden Lese- und Rechtschreibstörungen definiert und analysiert?
Lese- und Rechtschreibstörungen werden definiert und anhand der vorgestellten kognitiven und Entwicklungsmodelle analysiert. Es werden verschiedene Aspekte wie visuell-perzeptuelle Schwierigkeiten, phonologische Verarbeitungsschwächen und Probleme mit orthographischen Regelmäßigkeiten betrachtet. Die Analyse erfolgt unter Einbezug der Modelle von Frith und dem Prozessmodell.
Welche Lernsoftware-Programme werden analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch drei Lernsoftware-Programme: CESAR LESEN 1.0, die Duden-Lernsoftware "Ich lerne Lesen 1&2" und die Software "Lese-Zeile". Die Analyse beinhaltet eine detaillierte Beschreibung und eine kritische psycholinguistische Bewertung jedes Programms.
Wie wird die Lernsoftware psycholinguistisch bewertet?
Die psycholinguistische Bewertung der Lernsoftware basiert auf den in der Arbeit vorgestellten theoretischen Modellen und Erkenntnissen. Es wird geprüft, inwieweit die Software den Prinzipien der Schriftsprachverarbeitung und des Schriftspracherwerbs entspricht und ob sie den Bedürfnissen von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche gerecht wird.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit und Eignung der untersuchten Lernsoftware-Programme zur Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Sie trägt damit zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Markt der Lernsoftware bei und liefert Empfehlungen für die Auswahl und den Einsatz von Fördermaßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Lese-Rechtschreibschwäche, Lernsoftware, Psycholinguistik, Kognitive Modelle, Entwicklung des Schriftspracherwerbs, Phonologische Bewusstheit, Schriftsprachverarbeitung, Legasthenie, Fördermaßnahmen.
- Quote paper
- Rainer Böhm (Author), 2003, Lernsoftware in der Förderung von Lese- und Rechtschreibschwäche: Versuch einer psycholinguistischen Reflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12087