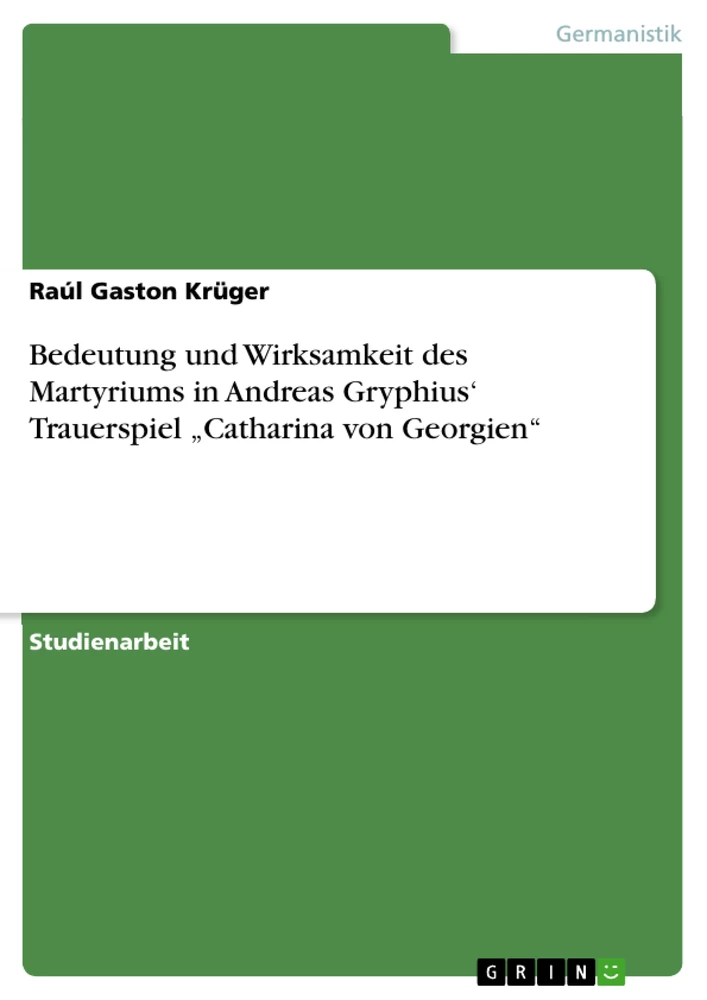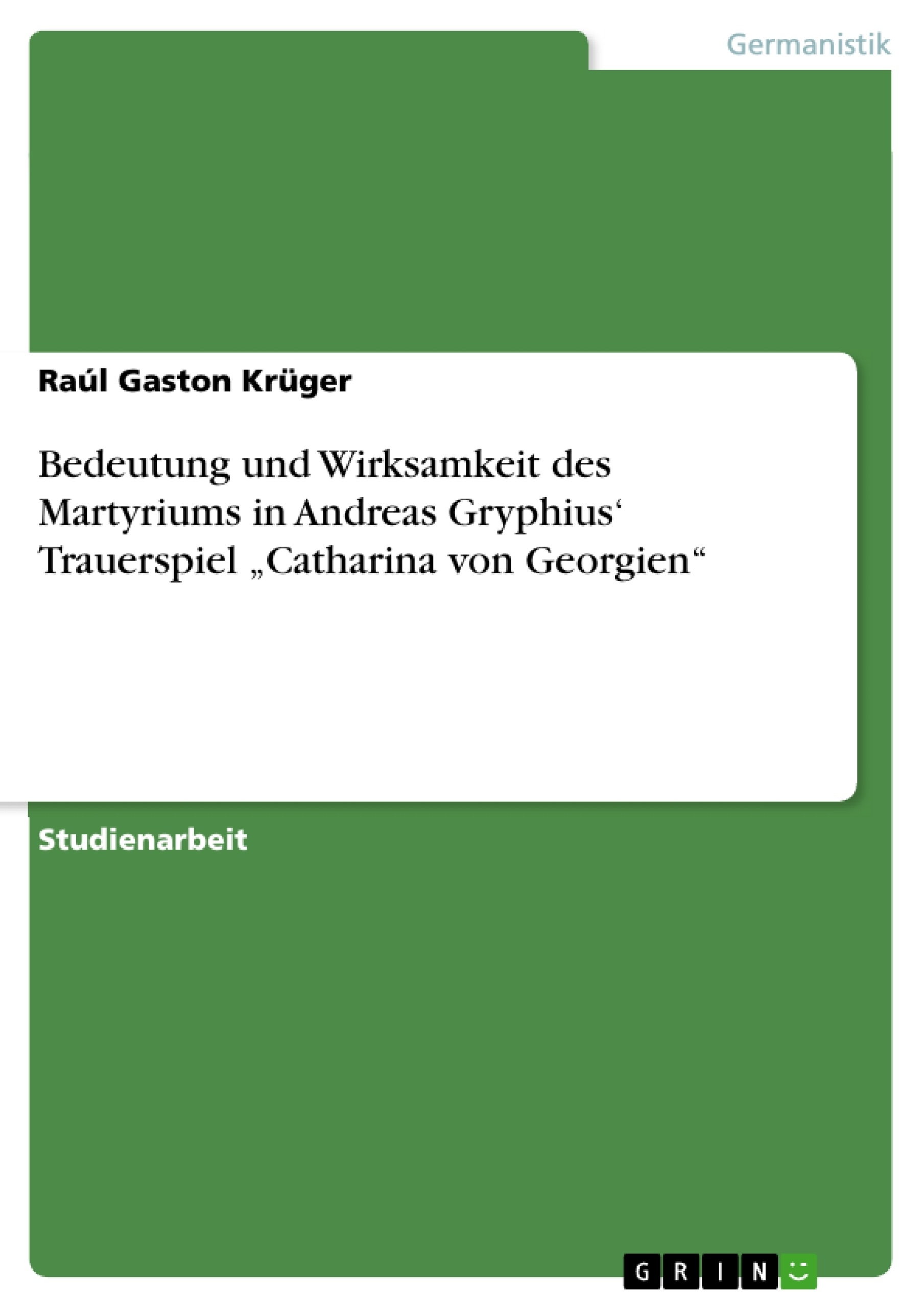In seinem Trauerspiel Catharina von Georgien. Oder Bewehrete Beständigkeit. stellt Andreas Gryphius den letzten Lebenstag seiner Heldin nach, der bei Verfassung des Dramas 1647 nur 23 Jahre zurücklag. Die Herrscherin des kleinen, unbedeutenden – wie Heselhaus feststellt, mit Gryphius‘ Schlesien vergleich¬baren – Landes wird bei Verhandlungen hinterhältig vom mächtigen persischen Herrscher Chach Abas festgesetzt. Nachdem der Tyrann jahrelang vergeblich versucht hat, Catharina zur Abkehr von ihrem Glauben und zur Hochzeit mit ihm zu bewegen, beschließt er, völlig von seinen Affekten beherrscht, die Hinrichtung seiner Gefangenen.
Die Allegorie der Ewigkeit fordert eingangs vom Zuschauer: „Vnd lebt vnd sterbt getrost für Gott vnd Ehr vnd Land“ (I, 88). Der „Märtyrer ist deshalb die angemessenste Figur, die Forderungen […] einzulösen, weil er – im christlichen Kontext, der auch und vor allem für Gryphius bindend ist – den absoluten Ernstfall des Glaubens darstellt.“ Mit Chachs Befehl zu ihrer Ermordung erhält Catharina noch einmal die Gelegenheit, sich in ihrem Glauben zu bewähren und die Märtyrerfigur zu verkörpern, nach der die Ewigkeit so sehr verlangt.
Den Stoff für das Drama fand Gryphius bei dem französischen Historiker Claude Malingre, Sieur de Saint-Lazare. Das scheint jedoch nicht die einzige Verbindung der Tragödie zum Französischen zu sein, denn wie Elida Maria Szarota feststellt, konzipiert Gryphius Catharina als deutsches Gegenstück zum fran¬zösischen Märtyrerdrama. Die Polyeucte von Corneille wird in der Vorrede an den Leser in seinem Leo Armenius – in der Catharina erstmal Erwähnung findet – von Gryphius stark kritisiert. Seine beständige Heldin setzt er Corneilles Titelfigur entgegen, die sich – obschon beide das Martyrium gemeinsam haben – moralisch nicht mit ihr messen kann.
Wenn zwei Märtyrerfiguren so gegensätzlich sein können wie Catharina und Polyeucte, muss ihre Eigenart in der Begründung und der Bedeutung ihres Martyriums liegen; diese für die Catharina von Georgien darzustellen ist Anliegen dieser Arbeit. Darüber hinaus will sie klären, inwiefern ihr Martyrium wirksam ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Märtyrerdrama
- 3. Catharina als Märtyrerin
- 3.1. Catharina als politische Märtyrerin
- 3.2. Catharina als christliche Märtyrerin
- 4. Bedeutung des Martyriums
- 4.1. Die Herrschaft der Moral
- 4.2. Die Gegenposition des Meurab
- 4.3. Körperlichkeit, Affekte und Hinrichtung
- 4.4. Catharinas Wiederauferstehung - Der Rachegeist
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und Wirksamkeit des Martyriums in Andreas Gryphius' Trauerspiel „Catharina von Georgien“. Die Hauptziele sind die Darstellung der Eigenart Catharinas als Märtyrerfigur und die Klärung der Wirksamkeit ihres Martyriums im Kontext des Stückes.
- Catharina als politische und christliche Märtyrerin
- Das barocke Märtyrerdrama und seine Konventionen
- Die Bedeutung des Martyriums für die moralische Ordnung im Stück
- Die Gegenüberstellung Catharinas und des Tyrannen Chach Abas
- Die Rolle von Körperlichkeit, Affekten und der Hinrichtung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Trauerspiel „Catharina von Georgien“ von Andreas Gryphius ein und stellt den historischen Kontext sowie die Forschungslage dar. Sie beschreibt Catharina als Herrscherin, die durch hinterhältige Machenschaften des persischen Herrschers Chach Abas gefangen genommen wird und ihrem Glauben treu bleibt, bis zum Martyrium. Der Bezug zu anderen Werken Gryphius' und die gegensätzliche Darstellung des Martyriums im Vergleich zu Corneilles „Polyeucte“ werden als Hintergrund der Analyse genannt. Die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung und Wirksamkeit von Catharinas Martyrium wird formuliert.
2. Das Märtyrerdrama: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Märtyrers und des Märtyrerdramas. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Motivs von der Antike bis zum Barock und untersucht die spezifischen Charakteristika des barocken Märtyrerdramas. Der Märtyrer wird als Zeuge und Bekenner dargestellt, der durch sein Leiden und seinen Tod eine höhere Wahrheit bezeugt. Die Gegenüberstellung des Märtyrers zum Souverän und die Konzeption des Martyriums als Akt der Entscheidung und Machtdemonstration unter Bedingungen der Unterwerfung werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Abwesenheit göttlichen Eingreifens und der Betonung des Leidens und des Duldens als zentrale Elemente des barocken Märtyrerdramas.
3. Catharina als Märtyrerin: Dieses Kapitel analysiert Catharinas Rolle als Märtyrerin, differenziert zwischen ihrer politischen und christlichen Dimension. Catharina wird als politische und christliche Märtyrerin dargestellt. Ihre politische Verantwortung als Herrscherin Georgiens und ihr Engagement im Versuch, den Frieden zu sichern, werden hervorgehoben. Das Kapitel zeigt, wie Gryphius die Figur Catharinas als Gegenbild zu anderen Märtyrerfiguren der Literatur, insbesondere zu Corneilles Polyeucte, konzipiert hat. Die spezifischen Herausforderungen und die politischen und religiösen Aspekte ihres Martyriums werden detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Catharina von Georgien, Märtyrerdrama, Barock, Martyrium, christlicher Glaube, politische Verantwortung, Chach Abas, Tyrannei, Widerstand, Moral, Affekte, Körperlichkeit, Gegenreformation.
Häufig gestellte Fragen zu Andreas Gryphius' "Catharina von Georgien"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Andreas Gryphius' Trauerspiel „Catharina von Georgien“ mit Fokus auf die Bedeutung und Wirksamkeit des Martyriums der Titelfigur. Es werden Catharinas Rolle als politische und christliche Märtyrerin untersucht und die Auswirkungen ihres Martyriums auf die moralische Ordnung des Stücks beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Catharina als politische und christliche Märtyrerin; das barocke Märtyrerdrama und seine Konventionen; die Bedeutung des Martyriums für die moralische Ordnung im Stück; den Vergleich Catharinas mit dem Tyrannen Chach Abas; die Rolle von Körperlichkeit, Affekten und der Hinrichtung im Kontext des Martyriums.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Märtyrerdrama, Catharina als Märtyrerin (unterteilt in Catharina als politische und christliche Märtyrerin), Bedeutung des Martyriums (unterteilt in Die Herrschaft der Moral, Die Gegenposition des Meurab, Körperlichkeit, Affekte und Hinrichtung, Catharinas Wiederauferstehung - Der Rachegeist) und Fazit.
Was wird in der Einleitung dargestellt?
Die Einleitung führt in das Stück ein, stellt den historischen Kontext und die Forschungslage dar, beschreibt Catharina als Herrscherin und ihren Glauben bis zum Martyrium. Der Bezug zu anderen Werken Gryphius' und Corneilles „Polyeucte“ wird hergestellt, und die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung und Wirksamkeit von Catharinas Martyrium wird formuliert.
Was wird im Kapitel "Das Märtyrerdrama" behandelt?
Dieses Kapitel definiert den Begriff des Märtyrerdramas, beleuchtet seine historische Entwicklung und untersucht die spezifischen Charakteristika des barocken Märtyrerdramas. Es wird der Märtyrer als Zeuge und Bekenner dargestellt, der durch Leiden und Tod eine höhere Wahrheit bezeugt. Die Gegenüberstellung des Märtyrers zum Souverän und das Martyrium als Akt der Entscheidung und Machtdemonstration werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Abwesenheit göttlichen Eingreifens und der Betonung des Leidens.
Was wird im Kapitel "Catharina als Märtyrerin" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert Catharinas Rolle als politische und christliche Märtyrerin. Ihre politische Verantwortung als Herrscherin und ihr Engagement für den Frieden werden hervorgehoben. Der Vergleich mit anderen Märtyrerfiguren, insbesondere Corneilles Polyeucte, wird gezogen. Die politischen und religiösen Aspekte ihres Martyriums werden detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Andreas Gryphius, Catharina von Georgien, Märtyrerdrama, Barock, Martyrium, christlicher Glaube, politische Verantwortung, Chach Abas, Tyrannei, Widerstand, Moral, Affekte, Körperlichkeit, Gegenreformation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Hauptziele der Arbeit sind die Darstellung der Eigenart Catharinas als Märtyrerfigur und die Klärung der Wirksamkeit ihres Martyriums im Kontext des Stücks.
- Quote paper
- Raúl Gaston Krüger (Author), 2008, Bedeutung und Wirksamkeit des Martyriums in Andreas Gryphius‘ Trauerspiel „Catharina von Georgien“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/120124