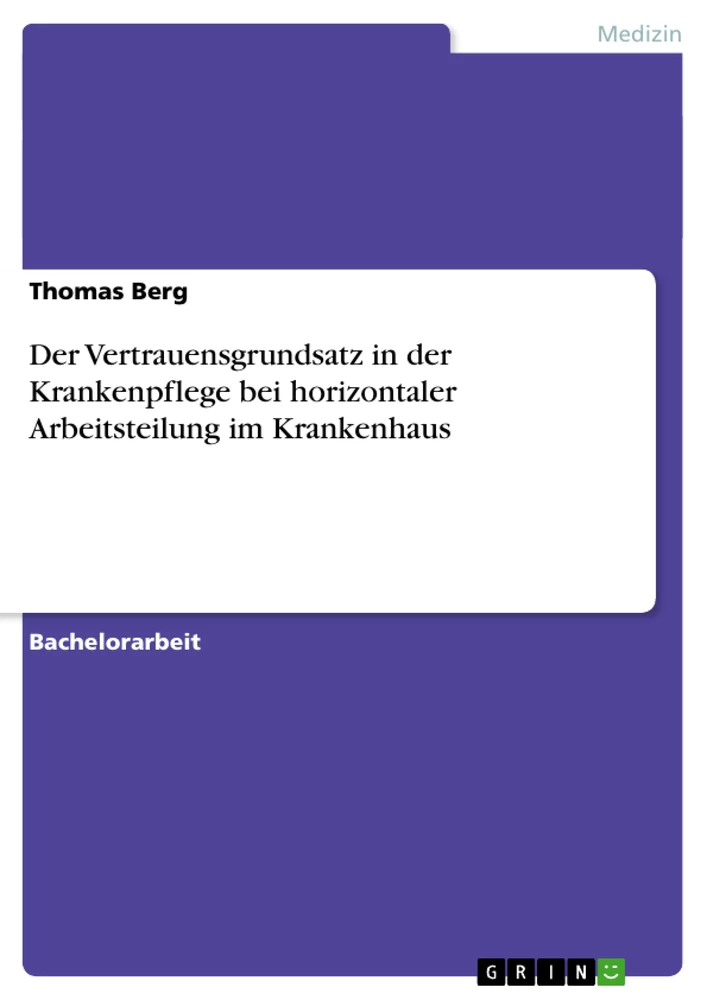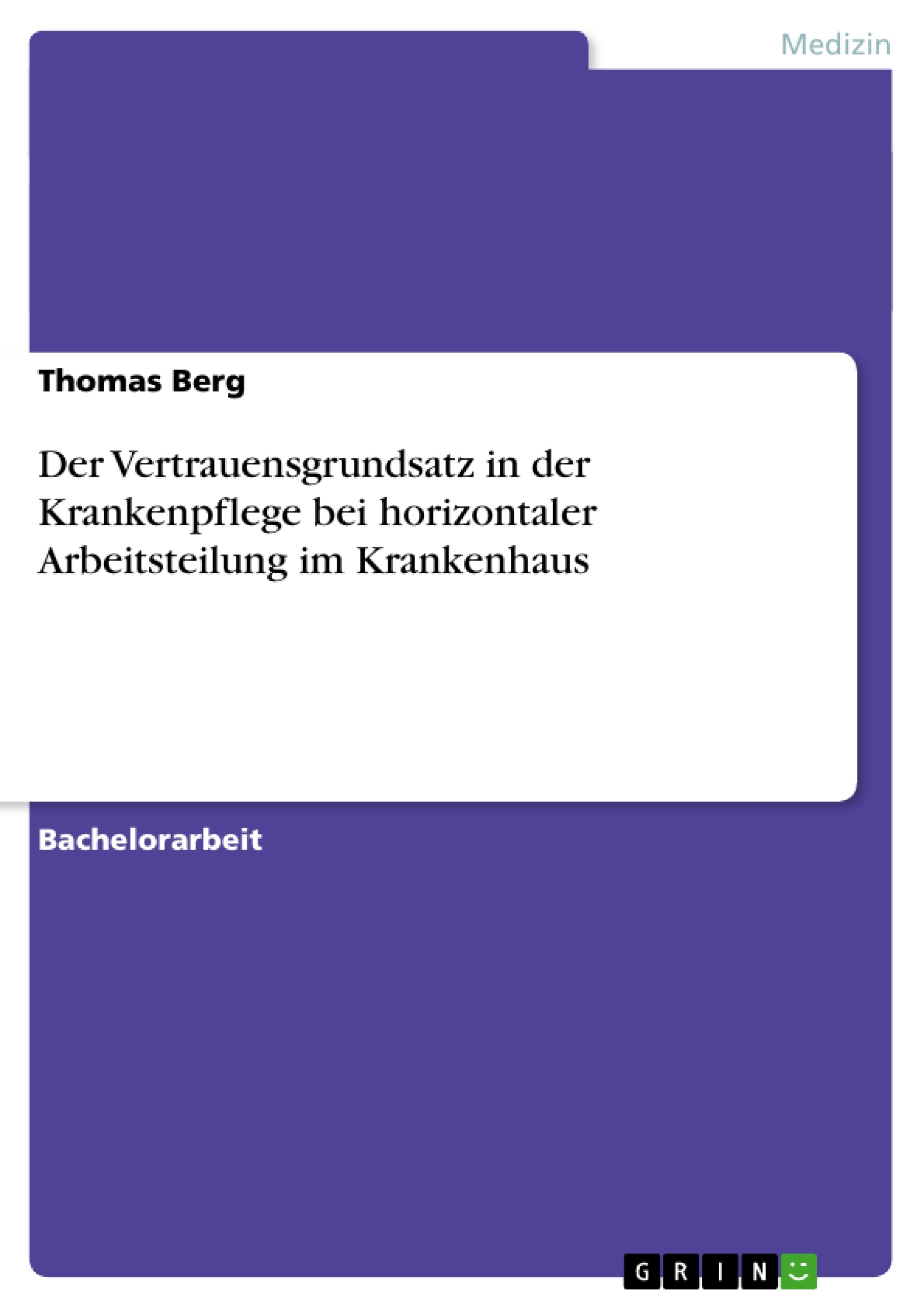„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“
Wladimir Iljitsch Uljanow
Diese Redewendung stammt angeblich von Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt unter seinem Pseudonym „Lenin“. In seinen offiziellen Werken ist sie in dieser Form allerdings nicht vermerkt. Denkbar ist, dass eine abgewandelte Fassung des häufig von Lenin benutzten russischen Sprichworts „Vertraue, aber prüfe nach“ (russisch: „Dowerjai, no prowerjai“) Eingang in den Sprichwortschatz unseres Sprachkreises gefunden hat .
Im Zusammenhang mit Vertrauen und Kontrolle im täglichen Arbeiten hat vermut-lich jeder Mensch auf die eine oder andere Art seine Erfahrungen gesammelt. Es wurde entweder zuwenig kontrolliert und zuviel vertraut oder eben umgekehrt, so dass durch ein überbordendes Kontrollsystem mangelndes Vertrauen deutlich wurde.
Im Krankenhaus steht natürlich der Anspruch der Fehlervermeidung zum Wohl des Patienten an vorderster Stelle, wobei wahrscheinlich fast jeder seine Erfah-rungen mit zuviel oder zuwenig Vertrauen und Kontrolle gemacht hat.
Um Antworten auf die Fragen nach „Kontrollieren müssen?“ oder „Vertrauen dürfen“ zu finden, wird in der vorliegenden Arbeit versucht, speziell aus der Sicht der Pflegenden einen Weg darzustellen, wie die Pflege sich - unter der Bedingung, die Grundvoraussetzungen stimmen überein - eine in der Medizin anerkannte Rechtsfigur, den sogenannten Vertrauensgrundsatz, zunutze machen könnte.
Zunächst wird eine Darstellung der verkehrsrechtlichen Ursprünge des Vertrau-ensgrundsatzes gegeben, gefolgt von einem Überblick über dessen Implementierung in das Medizinrecht. Anschließend wird die Vergleichbarkeit der Situationen von Medizin und Pflege im Krankenhaus diskutiert, woraus sich dann eine Übertragbarkeit der Prinzipien des Vertrauensgrundsatzes aus dem ärztlichen in den pflegerischen Bereich ableiten lassen soll.
Die rechtlichen Konsequenzen einer Anwendung des Vertrauensgrundsatzes auf die Pflege anhand eines praktischen Beispiels folgen dem nach, ehe zum Schluss die Meinung des Verfassers dieser Arbeit formuliert werden wird.
Zur besseren Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit versucht, möglichst auf geschlechtsneutrale Formulierungen zurückzugreifen, bspw. wird statt „die Krankenschwester / der Krankenpfleger“ die Formulierung „Pflegekraft“ verwendet. Dort, wo das nicht geschehen ist, ist selbstverständlich auch das jeweilige andere Geschlecht gemeint.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Vertrauensgrundsatz
- 2.1 Herkunft
- 2.2 Funktion und Grenze des Vertrauensgrundsatzes im Verkehr
- 3. Der Vertrauensgrundsatz und seine Grenzen in der Medizin
- 3.1 Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes
- 3.2 Die einzelnen Voraussetzungen des Vertrauensgrundsatzes
- 3.2.1 Arbeitsteilung
- 3.2.2 Der Vertrauensgrundsatz
- 3.2.3 Grenze des Vertrauensgrundsatzes
- 4. Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in die Pflege
- 4.1 Arbeitsteilung im Pflegebereich im Krankenhaus
- 4.1.1 Vertikale Arbeitsteilung
- 4.1.2 Horizontale Arbeitsteilung
- 4.2 Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in die Pflege
- 4.2.1 Zuständigkeitsbereich
- 4.2.2 Pflegefehler
- 4.2.3 Sorgfaltspflichtverletzung
- 4.2.4 Spezifische Gefahren der Arbeitsteilung
- 4.3 Zusammenfassung
- 4.3.1 Zweck der Vorbildnorm
- 4.3.2 Vergleichbarkeit des ungeregelten Sachverhalts
- 4.3.3 Zutreffen des Normzwecks auf den ungeregelten Sachverhalt
- 4.4 Ergebnis
- 4.1 Arbeitsteilung im Pflegebereich im Krankenhaus
- 5. Folgen der Anwendung
- 5.1 Dogmatische Grundlagen
- 5.1.1 Vorhersehbarkeit
- 5.1.2 Prinzip der Eigenverantwortlichkeit
- 5.1.3 Objektive Sorgfaltswidrigkeit
- 5.2 Anwendung
- 5.1 Dogmatische Grundlagen
- 6. Anwendung des Vertrauensgrundsatzes am konkreten Beispiel
- 6.1 Sachverhalt
- 6.1.1 Variante 1
- 6.1.2 Variante 2
- 6.2 Strafrechtliche Konsequenzen der Anwendung
- 6.2.1 § 229 StGB: Fahrlässige Körperverletzung
- 6.2.2 Ergebnis
- 6.3 Zivilrechtliche Konsequenzen
- 6.3.1 Vertragliche Ansprüche
- 6.3.2 Ergebnis
- 6.1 Sachverhalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Arbeitsteilung in der Krankenpflege. Ziel ist es, die Anwendbarkeit und die Grenzen dieses Grundsatzes im Kontext horizontaler und vertikaler Arbeitsteilung zu analysieren und mögliche Konsequenzen (zivil- und strafrechtlich) aufzuzeigen.
- Der Vertrauensgrundsatz im Recht und seine allgemeine Funktion
- Arbeitsteilung in der Krankenpflege (horizontal und vertikal)
- Anwendbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Pflegepraxis
- Rechtliche Folgen bei Verletzung des Vertrauensgrundsatzes
- Konkrete Fallbeispiele und deren juristische Bewertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Relevanz des Vertrauensgrundsatzes im Kontext der Arbeitsteilung im Krankenhaus. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die Forschungsfrage.
2. Der Vertrauensgrundsatz: Dieses Kapitel beschreibt den Vertrauensgrundsatz, seine Herkunft und seine allgemeine Funktion im Rechtsverkehr. Es werden die Grenzen des Vertrauensgrundsatzes im Allgemeinen erläutert.
3. Der Vertrauensgrundsatz und seine Grenzen in der Medizin: Hier wird der Vertrauensgrundsatz auf den medizinischen Kontext übertragen. Es wird diskutiert, inwieweit der Grundsatz in der Medizin anwendbar ist und welche Grenzen ihm gesetzt sind. Die Voraussetzungen für die Anwendung des Vertrauensgrundsatzes werden im Detail analysiert.
4. Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in die Pflege: Dieses Kapitel untersucht die Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Arbeitsteilung im Pflegebereich. Es wird zwischen vertikaler und horizontaler Arbeitsteilung unterschieden und die spezifischen Herausforderungen und Gefahren der Arbeitsteilung in der Pflege beleuchtet. Die Anwendbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in verschiedenen Situationen wird analysiert.
5. Folgen der Anwendung: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Folgen, die sich aus der Anwendung des Vertrauensgrundsatzes in der Pflege ergeben. Es werden die dogmatischen Grundlagen und die praktische Anwendung im Detail erläutert. Die Aspekte der Vorhersehbarkeit und Eigenverantwortlichkeit werden dabei besonders berücksichtigt.
6. Anwendung des Vertrauensgrundsatzes am konkreten Beispiel: Anhand eines konkreten Beispiels mit verschiedenen Varianten wird die Anwendung des Vertrauensgrundsatzes in der Praxis veranschaulicht. Die straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen werden ausführlich dargestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Vertrauensgrundsatz, Krankenpflege, Arbeitsteilung, Krankenhaus, horizontale Arbeitsteilung, vertikale Arbeitsteilung, Pflegefehler, Sorgfaltspflicht, zivilrechtliche Konsequenzen, strafrechtliche Konsequenzen, Rechtliche Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Arbeitsteilung in der Krankenpflege
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Arbeitsteilung in der Krankenpflege. Sie analysiert die Anwendbarkeit und Grenzen dieses Grundsatzes im Kontext horizontaler und vertikaler Arbeitsteilung und zeigt mögliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vertrauensgrundsatz im Recht, seine allgemeine Funktion und seine Grenzen. Sie analysiert die Arbeitsteilung in der Krankenpflege (horizontal und vertikal), die Anwendbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Pflegepraxis und die rechtlichen Folgen bei dessen Verletzung. Konkrete Fallbeispiele und deren juristische Bewertung werden ebenfalls behandelt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der Vertrauensgrundsatz, Der Vertrauensgrundsatz und seine Grenzen in der Medizin, Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in die Pflege, Folgen der Anwendung und Anwendung des Vertrauensgrundsatzes am konkreten Beispiel. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird im Kapitel "Der Vertrauensgrundsatz" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Vertrauensgrundsatz, seine Herkunft und seine allgemeine Funktion im Rechtsverkehr. Die Grenzen des Vertrauensgrundsatzes im Allgemeinen werden erläutert.
Was wird im Kapitel "Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in die Pflege" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Arbeitsteilung im Pflegebereich. Es unterscheidet zwischen vertikaler und horizontaler Arbeitsteilung und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Gefahren der Arbeitsteilung in der Pflege. Die Anwendbarkeit des Vertrauensgrundsatzes in verschiedenen Situationen wird analysiert.
Welche Folgen werden im Zusammenhang mit der Anwendung des Vertrauensgrundsatzes behandelt?
Das Kapitel "Folgen der Anwendung" befasst sich mit den rechtlichen Folgen der Anwendung des Vertrauensgrundsatzes in der Pflege. Es erläutert die dogmatischen Grundlagen und die praktische Anwendung im Detail, wobei die Aspekte der Vorhersehbarkeit und Eigenverantwortlichkeit besonders berücksichtigt werden.
Wie werden konkrete Beispiele behandelt?
Das letzte Kapitel veranschaulicht die Anwendung des Vertrauensgrundsatzes anhand eines konkreten Beispiels mit verschiedenen Varianten. Die straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen werden ausführlich dargestellt und analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vertrauensgrundsatz, Krankenpflege, Arbeitsteilung, Krankenhaus, horizontale Arbeitsteilung, vertikale Arbeitsteilung, Pflegefehler, Sorgfaltspflicht, zivilrechtliche Konsequenzen, strafrechtliche Konsequenzen, Rechtliche Verantwortung.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Übertragbarkeit des Vertrauensgrundsatzes auf die Arbeitsteilung in der Krankenpflege und die damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen.
- Arbeit zitieren
- B. Sc. Thomas Berg (Autor:in), 2008, Der Vertrauensgrundsatz in der Krankenpflege bei horizontaler Arbeitsteilung im Krankenhaus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/120122