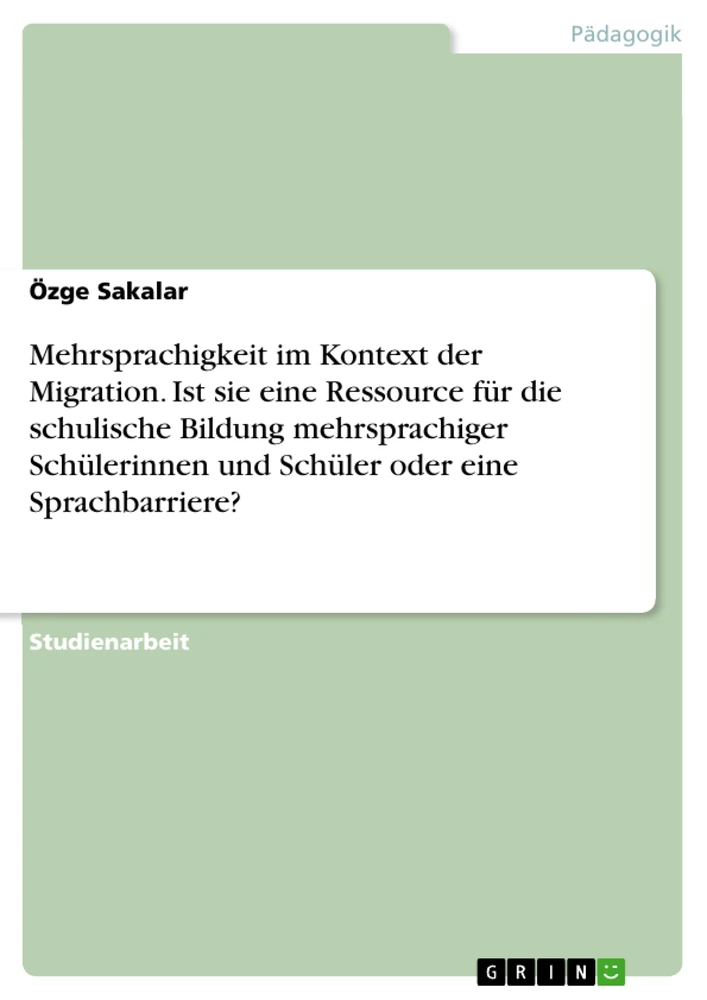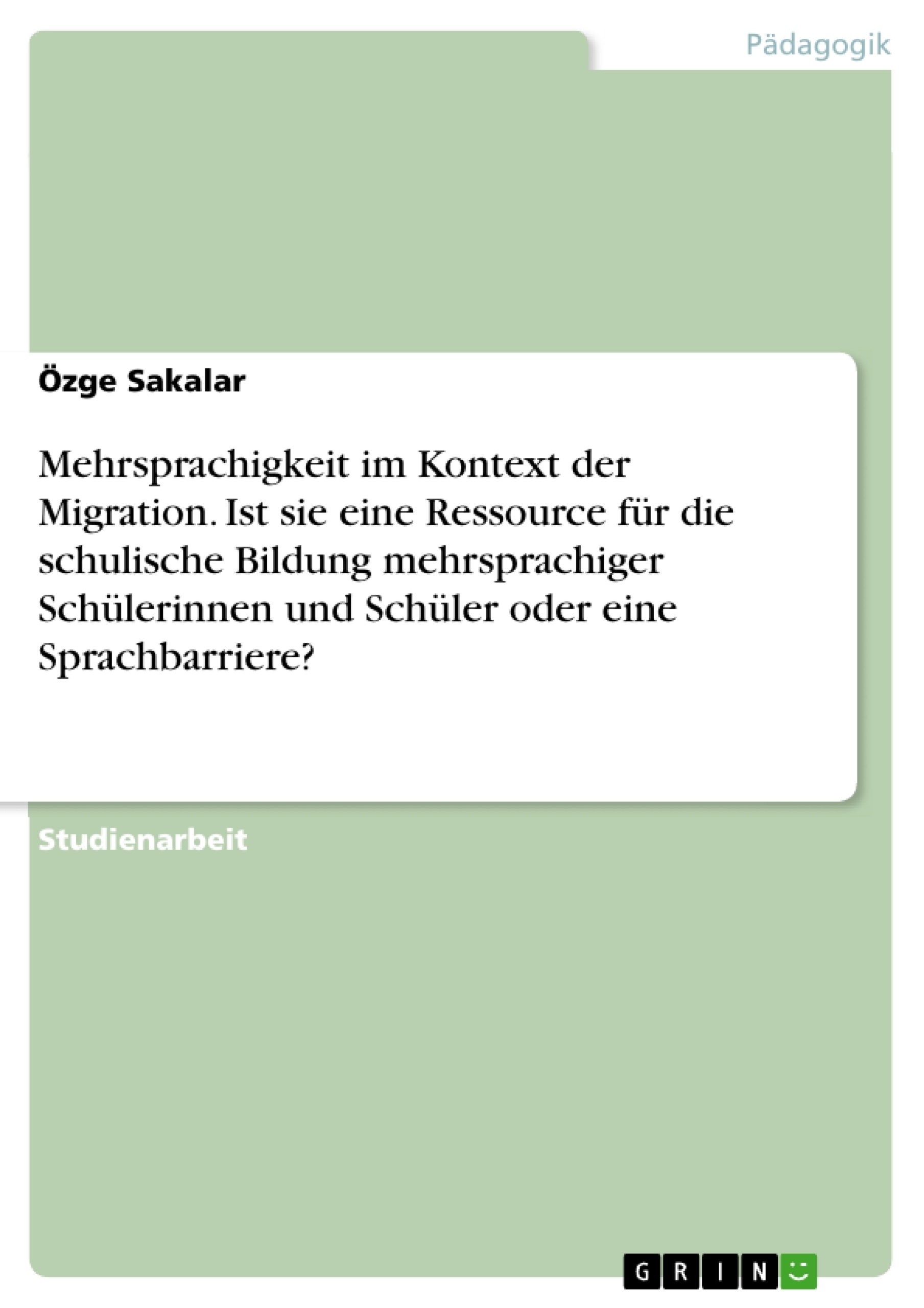Die vorliegende Arbeit, welche im Rahmen des Seminars "Koordinierte Alphabetisierung im Anfangsunterricht (KOALA)" verfasst wird, bearbeitet die Thematik der Mehrsprachigkeit und ihre Entwicklung im Kontext der deutschen Migrationsgeschichte. Zuerst soll der facettenreiche Begriff der Mehrsprachigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Für die Fragestellung der Arbeit ist sodann zu klären, auf welche Art und Weise die Zweitsprache (L2) Deutsch von mehrsprachigen Kindern überhaupt erworben wird. Hierfür dienen drei Theorieansätze als Grundlage, wobei eine für die Arbeit relevante näher ausgeführt wird: die Interdependenzhypothese. Die Beantwortung der Fragestellung, ob die Mehrsprachigkeit endgültig eine Ressource für die gesamte Gesellschaft darstellt, hängt davon ab, welche Methode der Sprachförderung angewandt wird. An dieser Stelle werden drei essentielle Säulen der Sprachförderung mit dem Fokus auf Schulen mit koordiniertem Lernen am Beispiel von KOALA erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Diskurs über Mehrsprachigkeit
- Was bezeichnet „Mehrsprachigkeit“?
- Abgrenzung von „doppelter Ein- bzw. Halbsprachigkeit“
- Idee des sprachlichen Repertoires
- Der Zweitspracherwerb
- Theorien des Zweitspracherwerbs
- Faktoren der Beeinflussung
- Stellenwert der Erstsprache
- Die assimilationsorientierte Perspektive: Mehrsprachigkeit als Sprachbarriere
- (Institutionelle) Diskriminierung: Begriffsklärung und Vorkommen
- Erwartungseffekte
- Auswirkungen auf die Persönlichkeit
- Vorzüge der Mehrsprachigkeit
- Ergebnisse der Spracherwerbsforschung
- Modelle zur Sprachförderung
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit im Kontext der deutschen Migrationsgeschichte. Sie untersucht die Frage, ob Mehrsprachigkeit eine Ressource oder ein Stolperstein für die schulische Bildung mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler (SuS) darstellt.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Mehrsprachigkeit“
- Theorien und Faktoren des Zweitspracherwerbs
- Die Rolle der Erstsprache im Bildungsprozess
- Die assimilationsorientierte Perspektive auf Mehrsprachigkeit
- Vorzüge der Mehrsprachigkeit und Modelle zur Sprachförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Mehrsprachigkeit im Kontext der deutschen Migrationsgeschichte vor und formuliert die Forschungsfrage, ob Mehrsprachigkeit eine Ressource oder eine Sprachbarriere für mehrsprachige SuS ist. Sie skizziert die Gliederung der Arbeit.
- Der Diskurs über Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem vielschichtigen Begriff „Mehrsprachigkeit“ aus verschiedenen Perspektiven. Es wird auf die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in heutigen Lebenswelten hingewiesen und die Abgrenzung von „doppelter Einsprachigkeit“ und „doppelter Halbsprachigkeit“ vorgenommen. Die Idee des sprachlichen Repertoires wird als positive Perspektive auf Mehrsprachigkeit in der Einwanderungsgesellschaft vorgestellt.
- Der Zweitspracherwerb: Dieses Kapitel behandelt den Erwerb der Zweitsprache (L2) Deutsch von mehrsprachigen Kindern. Es werden drei Theorien des Zweitspracherwerbs erläutert, wobei die Interdependenzhypothese näher ausgeführt wird. Die Arbeit beleuchtet die individuellen Voraussetzungen, die den Erwerbsprozess beeinflussen, und hebt den Stellenwert der Erstsprache (L1) eines mehrsprachigen Kindes hervor.
- Die assimilationsorientierte Perspektive: Mehrsprachigkeit als Sprachbarriere: Dieses Kapitel präsentiert die kritische Perspektive auf Mehrsprachigkeit aus einer assimilationsorientierten Sichtweise. Es werden die Diskrepanzen zwischen der Herkunftssprache und der Mehrheits-sprache Deutsch beleuchtet, die mehrsprachige SuS in pädagogischen Institutionen erleben können. Die Arbeit beleuchtet die (institutionelle) Diskriminierung, die aus dieser Heterogenität resultieren kann, und die Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Kinder.
- Vorzüge der Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die positive Wirkung der Mehrsprachigkeit auf die schulische Bildung. Es werden Ergebnisse der Spracherwerbsforschung vorgestellt, die die Vorzüge der Mehrsprachigkeit belegen. Des Weiteren werden drei essentielle Säulen der Sprachförderung mit dem Fokus auf Schulen mit koordiniertem Lernen am Beispiel von KOALA erläutert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Migrationsgeschichte, Zweitspracherwerb, Interdependenzhypothese, Erstsprache, Zweitsprache, Assimilation, (Institutionelle) Diskriminierung, Sprachförderung, KOALA.
- Quote paper
- Özge Sakalar (Author), 2017, Mehrsprachigkeit im Kontext der Migration. Ist sie eine Ressource für die schulische Bildung mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler oder eine Sprachbarriere?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1194631