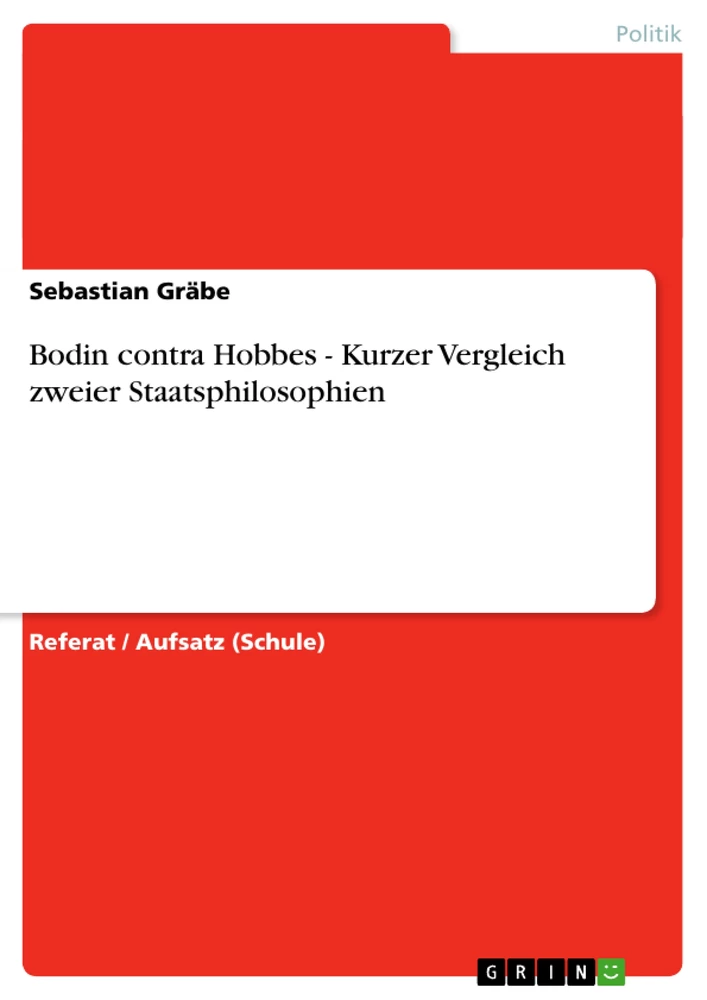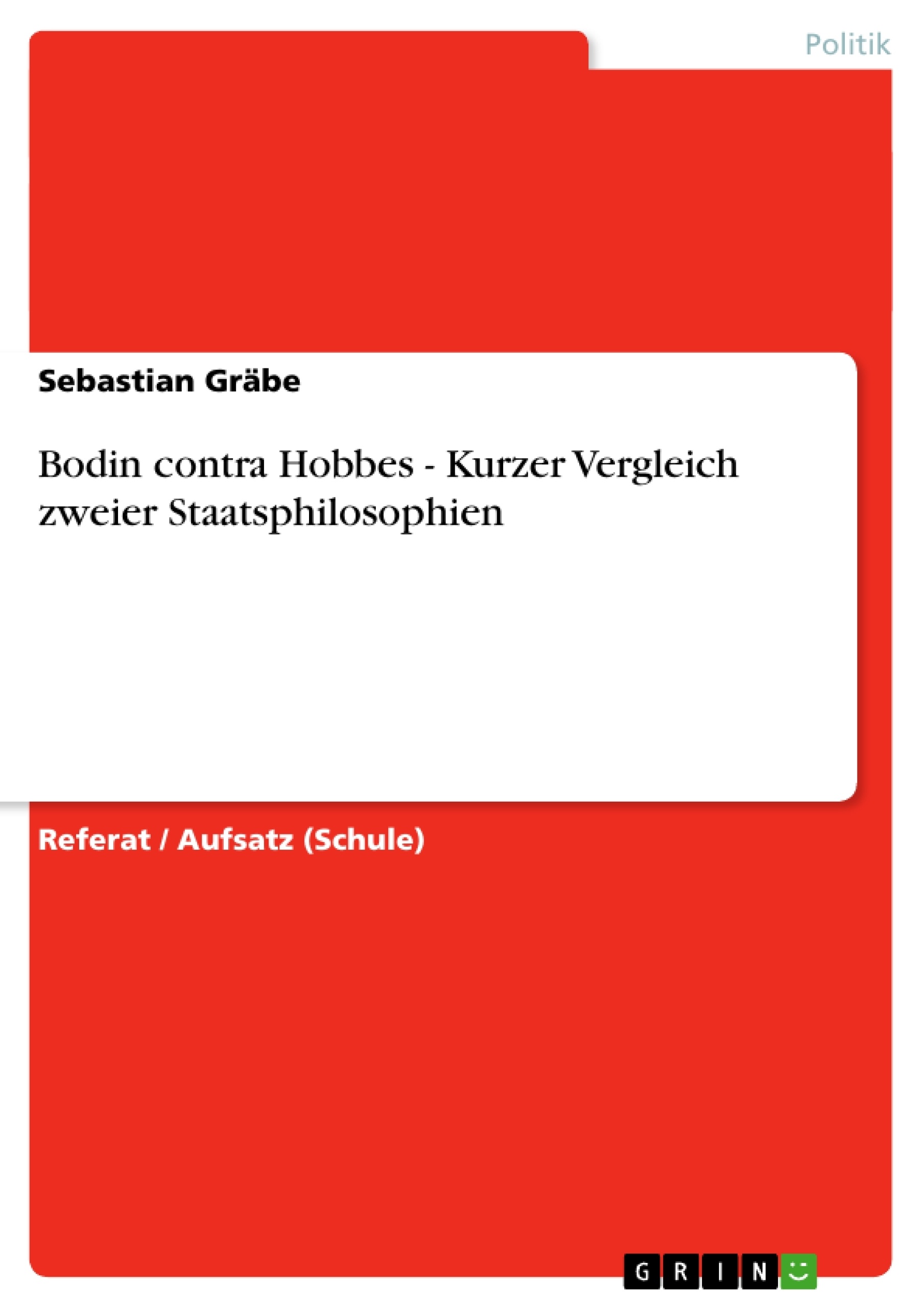Bei diesem kurzen Aufsatz im Fach Gemeinschftskunde (Wirtschaft und Politik) werden die Staatsphilosophen Hobbes und Bodin kurz verglichen. Dabei werden insbesondere die Begründungen und Basis ihrer Philosophie beleuchtet.
Bodin contra Hobbes
Sebastian Gräbe
2002
Sowohl Hobbes als auch Bodin entfalten philosophische Konstrukte von idealpolitischer Natur. Sie beschreiben beide das jeweilige Idealbild des absolutistischen Staates, wobei notwendigerweise der Schwerpunkt auf der Legitimation des Regenten liegt. In eben dieser Legitimation findet sich auch der stärkste Gegensatz zwischen beiden Theoretikern.
Bodin erweitert in seinen Werken das mittelalterliche Bild eines Herrschers durch Gottes Gnaden zu einem Ebenbild Gottes, das den Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden verdrängt und nur unmittelbar den Gesetzen Gottes unterworfen ist.
Hobbes hingegen geht bei seiner Legitimation von einer Notwendigkeit durch gesellschaftliche Entwicklungen aus und vertritt somit bis dato einen ungewöhnlichen Standpunkt. Er definiert den Monarchen nicht als einen von Gott eingesetzten Regenten, sondern als eine unumgängliche und notwendige Institution des Staatswesens, die in der Natur des Menschen begründet ist. Es ergibt sich bei Hobbes folgende logische Verkettung: Aus der Notwendigkeit heraus sich und seinen Besitz vor Raub und Krieg zu schützen, bilden Menschen Gemeinschaften. Um diese zu stabilisieren innergemeinschaftliche Machtfehden nach dem Prinzip homo homini lupus est vor zu beugen, übertragen die Individuen der Gemeinschaft ihre gesamte Macht und Freiheit auf eine Person, den Regenten , der alle drei Gewalten, Legislative, Exekutive, Judikative, als absoluter Herrscher in sich vereint und somit eine feste Gliederung und allgemeingültige Rechtsnorm vorgibt. Auf diese Weise werden alle Einzelnen eine Person, indem sie nach dem Willen einer Person handeln und heißen Staat oder Gemeinwesen. Auf diese Weise entsteht der Leviathan oder sterbliche Gott, der seine Macht nicht durch Gott sondern durch das Vertrauen des Volkes erhält und somit eine ein größere Gewalt und Macht hervorbringt.
Der Herrscher als Joch Gottes wird bei Hobbes gegen einen Herrscher, der durch das Vertrauen des Volkes legitimiert wird, ausgetauscht. Das Selbstverständnis des Volkes ist also ein neues, selbstbewusstes. Das Menschenbild bei Hobbes ist grundliegend positiv dahingehend, dass der Mensch grundsätzlich zur Vernunft und Einsicht fähig ist und so die Notwendigkeit des Leviathans erkennt.
Die Aufgabe des Herrschers sehen beide Philosophen nicht nur in der Gesetzgebung und Führung des Staates sondern in der Verbreitung von Gerechtigkeit auf sie zielen alle Gesetze ab. Bodin sieht die Gerechtigkeit des Regenten als eine vollendete Tatsache an, da er als Gottes Ebenbild unfehlbar ist und somit auch nicht gegen Gottes Gerechtigkeit handeln kann. Daraus leiten sich für die Untertan gewisse Rechte wie zum Beispiel das Recht auf Eigentum ab.
Hobbes der das Herrscherbild auf das eines sterblichen, durch das Volk legitimierten Gott reduziert hat, geht zwar nicht von einer Unfehlbarkeit des Regenten aus, sieht seinen Machtanspruch jedoch gleichermaßen unantastbar, so dass dieser selbst bei schlechter Verwaltung des Staates unangetastet bleibt. Rechte für die Untertan existieren in Form eines theoretischen Vertrages zwischen Untertan und Regent. Aus diesem entspringt jedoch kein Rechtsanspruch im modernen Sinne. Es geht vielmehr um ein Vorbeugen von allgemeiner Willkür und Rechtssicherheit „von oben“ durch den Regenten.
Dennoch skizziert Hobbes die Grundzüge eines Rechtstaates in seinen Werken.
Bei Bodin tritt ein weiterer Aspekt hinzu, die mittelalterliche Ständeordnung. Weil die Stände, genau wie der Monarch, seit fast 5 Jahrhunderten kirchlich begründet waren, stellte ihre Aufrechterhaltung eine Notwendigkeit für eine kirchliche Legitimierung des Monarchen dar. Die Stände erhalten das Bild einer vermeintlich von Gott gegliederten Gesellschaft aufrecht. Gleichzeitig wiegen sie den weltlichen Adel, der Macht zu Gunsten des absolutistischen Herrschers abgeben muss, in der Sicherheit, genügend Distanz zur Unterschicht zu haben um die eigene gesellschaftliche Stellung zu behaupten. Eine Diffusion in den Ständen geschieht nur vereinzelt, da nun der Regent, der nicht mehr auf die Legitimierung durch die Fürsten angewiesen ist, Ämter nach Verdienst und Qualität der Person, unabhängig vom Stand vergeben kann.
Hobbes greift den Gedanken der Stände bewusst nicht auf, da sein ideologisches Staatsgebilde auf dem Gedanken des gemeinschaftlichen Rechtabtritts an den Regenten beruht. Das Verständnis des Volkes ist also das von gleichberechtigten Bürgern unter der Regenschaft des Monarchen. Dies greift implizit den Gedanken Bodins des Verdienstes nach Qualität und Person auf, da sich in der von Hobbes konstruierten Gesellschaft mit Ausnahme des Regenten die Individuen sich ausschließlich durch Verdienst und Qualität ihrer Person differenzieren.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Bodin contra Hobbes"?
Der Text vergleicht die philosophischen Konstrukte von Jean Bodin und Thomas Hobbes bezüglich ihrer idealpolitischen Vorstellungen vom absolutistischen Staat. Beide Theoretiker legen den Schwerpunkt auf die Legitimation des Regenten, wobei sich hier der größte Gegensatz zwischen ihnen zeigt.
Wie legitimiert Bodin den Herrscher?
Bodin erweitert das mittelalterliche Bild eines Herrschers durch Gottes Gnaden zu einem Ebenbild Gottes, das den Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden verdrängt und nur unmittelbar den Gesetzen Gottes unterworfen ist.
Wie legitimiert Hobbes den Herrscher?
Hobbes legitimiert den Monarchen nicht durch Gott, sondern durch die Notwendigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen. Er sieht den Monarchen als eine unumgängliche Institution, die in der Natur des Menschen begründet ist. Menschen bilden Gemeinschaften zum Schutz, übertragen ihre Macht auf den Regenten (Leviathan), der durch das Vertrauen des Volkes legitimiert wird.
Was ist der Hauptunterschied in der Legitimation des Herrschers bei Bodin und Hobbes?
Bodin legitimiert den Herrscher theologisch als Ebenbild Gottes, während Hobbes ihn rechtsphilosophisch durch einen gegenseitigen, gemeinschaftlichen und rechtskräftigen Vertrag legitimiert.
Welche Rolle spielt Gerechtigkeit bei Bodin und Hobbes?
Beide Philosophen sehen die Aufgabe des Herrschers in der Gesetzgebung und Führung des Staates, wobei alle Gesetze auf die Verbreitung von Gerechtigkeit abzielen. Bodin sieht die Gerechtigkeit des Regenten als eine vollendete Tatsache, während Hobbes nicht von der Unfehlbarkeit des Regenten ausgeht, seinen Machtanspruch aber gleichermaßen unantastbar sieht.
Welche Rolle spielt die Ständeordnung bei Bodin?
Bodin hält an der mittelalterlichen Ständeordnung fest, da sie kirchlich begründet war und somit eine Notwendigkeit für die kirchliche Legitimierung des Monarchen darstellte. Die Stände spiegeln eine vermeintlich von Gott gegliederte Gesellschaft wider.
Wie steht Hobbes zur Ständeordnung?
Hobbes greift den Gedanken der Stände nicht auf, da sein Staatsgebilde auf dem Gedanken des gemeinschaftlichen Rechtabtritts an den Regenten beruht. Das Volk versteht sich als Gemeinschaft gleichberechtigter Bürger unter der Herrschaft des Monarchen.
Welche Staatsform befürworten Bodin und Hobbes?
Beide Theoretiker befürworten grundsätzlich den Absolutismus als Staatsform und wollen ihn konservieren bzw. kreieren.
Was ist das Fazit des Textes?
Bodin und Hobbes entwarfen ideologische Gesellschafts- und Staatsformen mit einem Herrscherbild, das mit den Gerechtigkeitsansprüchen in der Geschichte keinen Widerhall fand. Der Hauptunterschied liegt in der Frage der Legitimation, die bei Bodin theologisch und bei Hobbes rechtsphilosophisch formuliert ist.
- Quote paper
- Sebastian Gräbe (Author), 2002, Bodin contra Hobbes - Kurzer Vergleich zweier Staatsphilosophien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/119268