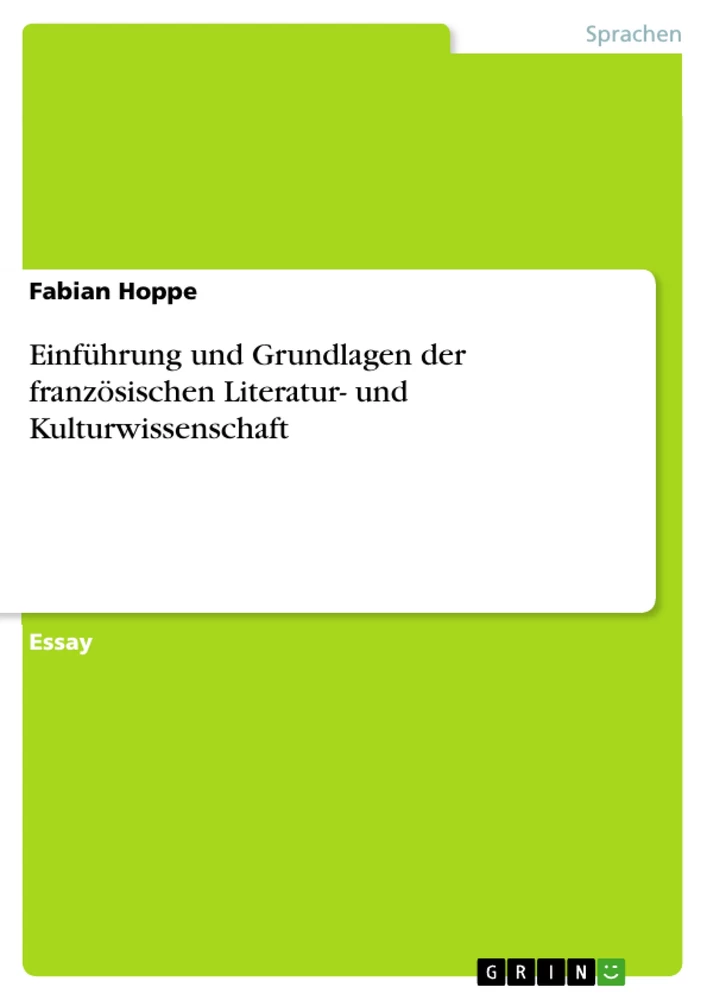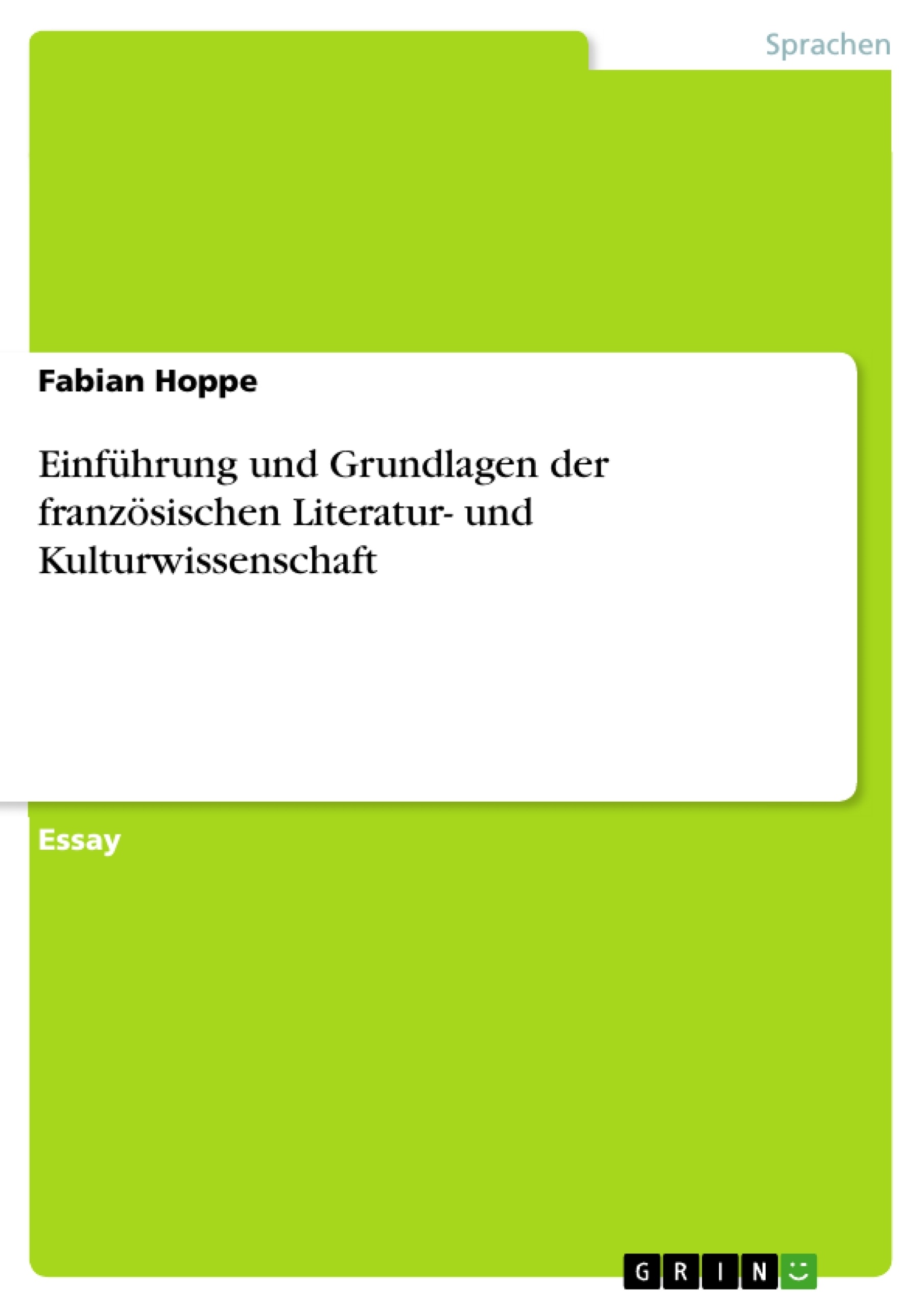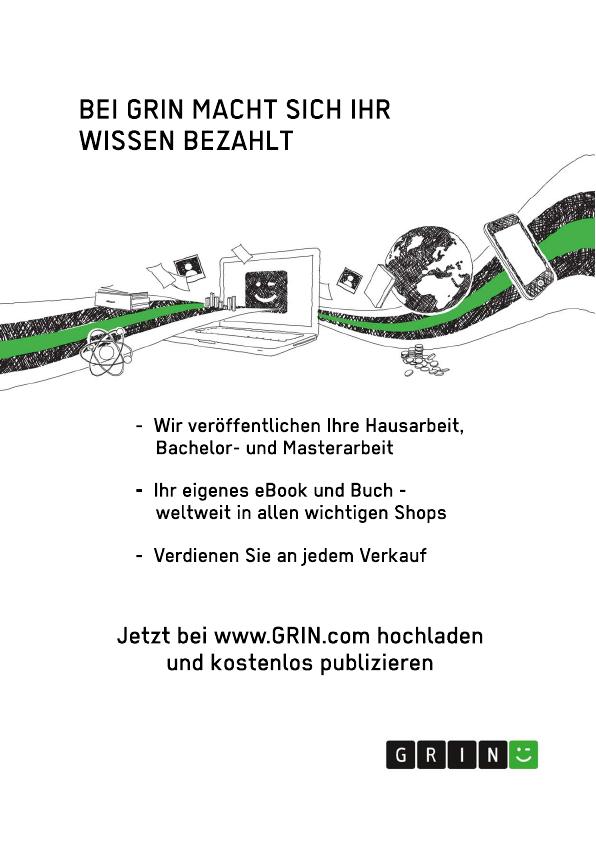Die vorliegende Arbeit beinhaltet zwei kurze Essays zur Thematik zur Einführung und Grundlagen der französischen
Literatur- und Kulturwissenschaft.
Flauberts Forderung nach der gottgleichen Präsenz des Autors („présent partout“), der als Erschaffer eines Textes alle Fäden in der Hand hält, lässt sich also über den oben beschriebenen, damals herrschenden Zeitgeist erklären, welcher dem Individuum deutlich mehr Raum gab als je zuvor. Gleichzeitig verfolgte Flaubert einen objektiven und wissenschaftlich-präzisen Ansatz beim Schreiben seiner Romane, den er selbst durch die Grundsätze impersonnalité, impassibilité, impartialité – d.h. Unpersönlichkeit, Leidenschaftslosigkeit und Unparteilichkeit – charakterisiert. Dieser rationale Anspruch an das literarische Schaffen ist ebenfalls typisch für die Epoche der Moderne, welche stark durch die Wissenschaften und mit ihnen durch den Positivismus als grundsätzliche erkenntnistheoretische Haltung geprägt war und die sich durch Exaktheit, Objektivität und eine empirisch-beobachtbare Vorgehensweise auszeichnet.
PRÜFUNGSLEISTUNG SEMINAR KOMPLEX B
AUFGABE 1
Indem Flaubert den Autor mit Gott gleichsetzt („comme Dieu dans l'univers“), ihm also im Rahmen seines Werkes unbedingte Autorität zugesteht, offenbart er sich als Kind seiner Zeit, der Epoche der Moderne bzw. der Aufklärung. Dieser waren mit dem Empirismus in Großbritannien und dem Rationalismus in Frankreich tiefgreifende Entwicklungen in der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie vorausgegangen, welche ihren Ursprung in der sich seit dem 16. Jh. in Europa stark verbreitenden protestantischen Glaubensbewegung haben (Barthes 2009a, S. 186). Die Reformation sowie wissenschaftliche, technologische und gesellschaftliche Neuerungen — im Bereich Literatur wären hier vor allem die Erfindung des Buchdrucks und die fortschreitende Alphabetisierung zu nennen - hatten also zur Folge, dass das Individuum mitsamt seiner persönlichen Leistungen in den Vordergrund rückte, was eine regelrechte Euphorie über die Erkenntnis- und Schaffensmöglichkeiten des modernen Menschen im Vergleich zum mittelalterlichen Subjekt in Gang setzte. Der Bruch mit Traditionen und Konventionen wird in literaturhistorischer Hinsicht besonders an der im 18. Jh. in Frankreich einsetzenden Debatte zwischen „alten“ und „modernen“ Autoren deutlich, auf die sich auch als „Querelle des Anciens et des Modernes“ bezogen wird und welche wenig später das Konzept des „Original-Genies, in dessen Begriff schon das Ursprüngliche, Angeborene und Unverwechselbare seiner Fähigkeiten“ mitschwingt, hervorbrachte (Detering und Fohrmann 1990, S. 46). Das Neue und der Fortschritt wurden so zum Sinnbild der Moderne, wobei dem Autor als ästhetischem Schöpfer des Neuen ein besonders hoher Stellenwert zu gesprochen wird.
Flauberts Forderung nach der gottgleichen Präsenz des Autors („présent partout“), der als Erschaffer eines Textes alle Fäden in der Hand hält, lässt sich also über den oben beschriebenen, damals herrschenden Zeitgeist erklären, welcher dem Individuum deutlich mehr Raum gab als je zuvor. Gleichzeitig verfolgte Flaubert einen objektiven und wissenschaftlich-präzisen Ansatz beim Schreiben seiner Romane, den er selbst durch die Grundsätze impersonnalité, impassibilité, impartialité — d.h. Unpersönlichkeit, Leidenschaftslosigkeit und Unparteilichkeit — charakterisiert (Hartwig und Stenzel 2017, S. 195). Dieser rationale Anspruch an das literarische Schaffen ist ebenfalls typisch für die Epoche der Moderne, welche stark durch die Wissenschaften und mit ihnen durch den Positivismus als grundsätzliche erkenntnistheoretische Haltung geprägt war und die sich durch Exaktheit, Objektivität und eine empirisch-beobachtbare Vorgehensweise auszeichnet. Dieser Umstand mag erklären, weshalb in Flauberts Zitat der immer präsente Autor nirgends im Werk sichtbar sein soll („visible nulle part“). Erzähler und Autor sind somit für den Leser auf den ersten Blick voneinander verschieden, wobei jedoch zwischen beiden, das zeigt Flauberts Ausspruch, ein Zusammenhang besteht, den es aus rezeptionsästhetischer Sicht zu entschlüsseln gilt.
Bei der Interpretation literarischer Texte liegt es nun nahe, diesen angenommenen Zusammenhang durch Kenntnisse über das Leben des Autors mittels umfassender Quellen (biographische Daten, Autorenäußerungen, Manuskripte, Briefe etc.) zu begründen. Der sogenannte Biographismus bzw. die biographische Methode war noch besonders zu Flauberts Lebzeiten im 19. Jh. weit verbreitet und wurde von bekannten Literaturkritikern wie Augustin Sainte-Beuve angewendet und weiterentwickelt (Hartwig und Stenzel 2017, S. 27). Gleichzeitig wurden jedoch auch weitere wissenschaftliche Verfahren entwickelt, die die Rolle des Autors als Original-Genie sowie den Zusammenhang zwischen ihm und dem Erzähler bzw. den Protagnisten im Werk zwar noch voraussetzten, jedoch nicht mehr behaupteten, diesen systematisch enthüllen zu können. Als Beispiele hierfür wären einerseits die hermeneutische Textdeutung in der Tradition Wilhelm Diltheys oder Friedrich Schleiermachers anzuführen, die sich auf eine bewusste oder unbewusste Autorintention berufen, welche über den Erzähler und die Protagonisten vermittelt wird und der es sich durch einem kreisförmigen Verstehensprozess, den hermeneutischen Zirkel, anzunähern gilt (Jannidis 2009, S. 11). Ein ähnlicher Ansatz wird bei der Literaturpsychoanalyse angewendet, bei welcher der Fokus auf unbewussten, in der Psyche des Autors versteckt liegenden Absichten ruht, die es durch Brüche im Text mittels psychoanalytischer Deutungsmuster in der Tradition Sigmund Freuds zu interpretieren gilt (ebd.).
Alle drei o.g. Verfahren haben gemeinsam, dass sie für die Interpretation literarischer Texte dem Autor einen hohen Stellenwert einräumen und demensprechend einer strikten Trennung zwischen Autor und Erzähler nur bedingt zustimmen. Dies änderte sich mit dem Aufkommen weiterer literaturwissenschaftlicher Strömungen und Interpretationstheorien im Laufe des 20. Jh., welche die vorherrschende Rolle des Autors kritisierten und sich für die Deutung von Literatur stärker auf den Text selbst oder auf die Rolle des Lesers im Verstehensprozess stützten (ebd., S. 16). Textbasierte Interpretation, die gänzlich ohne das Autorenkonzept auskommen will, wird im Rahmen strukturalistischer Ansätze angewendet, welche auf Basis semiotischer Erkenntnisse die Beziehungen zwischen Textfragmenten wie Wörtern und Zeichen und der Konstitution von Bedeutung untersucht. Laut dem Strukturalisten Roland Barthes ist es das Ziel strukturalistischer Tätigkeit, durch Dekonstruktion, d.h. systematisches Herausarbeiten von Textfragmenten, und deren anschließender Rekonstruktion „zu erkennen, wodurch Bedeutung möglich ist“ (Barthes 2003, S. 221) und eben nicht notwendigerweise eine durch den Autor intendierte Bedeutung des Textes herauszuarbeiten. Gleichzeitig gilt Barthes auch als einer der Hauptvertreter des Poststrukturalismus, der die Methoden des Strukturalismus noch einmal radikalisierte und die Rolle des Lesers ins Zentrum rückte. Dieser äußerst subjektivistische Ansatz, der an die Lerntheorie des Konstruktivismus anknüpft und die Möglichkeit der Wahrnehmung einer objektiven Realität infrage stellt, proklamiert, dass die „Geburt des Lesers [...] mit dem Tod des Autors“ zu bezahlen sei (Barthes 2009a, S. 193). Der Autor wird in diesem Szenario zu einem Schreiber degradiert, der bereits Geschriebenes lediglich neu anordnet und ein „Gewebe von Zitaten“ erstellt (ebd., S. 190), welches von Leser entwirrt werden muss, aber zugleich keinen versteckten Sinn enthält, den es freizulegen gilt. Die Deutung des Inhalts wird somit gänzlich dem Leser übertragen, während dem Text jede Originalität abgesprochen wird, da im Sinne intertextueller Theorien “jeder Text [.] sich in einem schon vorhandenen Universum der Texte“ situiert (Stierle 2003, S. 163). Die poststrukturalistische Position kann also im Verhältnis zu den weiter o.g. autorenzentrierten Ansätzen in gewisser Weise als Antithese gesehen werden, welche die Trennung zwischen Autor und Erzähler auf die Spitze treibt, da erstgenannter in der Textinterpretation gar keine Bezugsgröße mehr darstellt. In der literaturwissenschaftlichen Praxis lässt sich allerdings de facto bisher kaum auf textimmanente und autorenbezogene Deutungsmuster verzichten (Jannidis 2009, S. 24), weshalb der endgültige „Tod des Autors“ bis heute noch nicht abschließend diagnostiziert werden kann.
AUFGABE 2
« Ni tout a fait coupable, ni tout a fait innocente »: Racine bezieht sich mit dieser Formulierung darauf, dass Phädra den tragischen Ausgang der Ereignisse mitzuverantworten hat. Für die Liebe zu ihrem Stiefsohn kann ihr zunächst keine Schuld zugesprochen werden, da Gefühle und Affekte nicht frei und willensmäßig gesteuert werden können. Die Liebe ist in diesem Sinne ein schicksalhaftes Ereignis, über das sie keine Verfügungsgewalt hat, wohingegen die Entscheidung, ihr Geheimnis mit Oenone zu teilen, ihre Gefühle gegenüber Hippolytos trotz der zu erwartenden Konsequenzen zu gestehen und der Verbreitung einer Intrige stattzugeben Phädra selbst angelastet werden muss. Laut dem humanistischen Menschenbild, welches sich zu Racines Lebzeiten allmählich durchzusetzen begann und mit der „Entchristlichung der Umwelt“ (Racine 1995, S. 234) einherging, wäre es der moralische Anspruch an den Menschen gewesen, den Affekt dem Verstand zu unterwerfen, ein Ideal, dem Phädra im Stück nicht gerecht werden kann. Dass dies nicht aus bösem Willen oder Gier sondern aus dem „Unvermögen des Menschen“ (ebd., S. 238) heraus geschieht, macht die Tragik der Geschehnisse aus, zumal Phädra die Folgen ihres Handelns vor Augen stehen, sie aber aus Mangel an psychischer Kraft nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu handeln. Dieses ambivalente Verhältnis von freiem Willen und Fremdbestimmtheit spiegelt sich in Racines Aussage wider.
Figurenanalyse: Oenone stellt in Racines Drama laut der Personenbeschreibung (ebd., S. 13) die Amme und Vertraute Phädras dar. Im Vorwort wird sie, in Bezug auf ihre Rolle als Intrigantin, als niedrig und ruchlos einerseits, und bezüglich ihrer grundsätzlichen Haltung gegenüber Phädra als dienstfertig und loyal andererseits charakterisiert (ebd., S. 5). In Abgrenzung zu dieser expliziten Charakterisierung durch den Autor ist die auktorial-implizite Beschreibung Oenones vor allem durch den Kontrast zu ihren Pendants, Theramenes und Ismene, geprägt. Während erstgenannter die Rolle des Erziehers gegenüber Hippolytos innehat und im Stück dem damit verbundenen moralischen Anspruch gerecht wird1 und letztere zwar auf Nachfrage Aricias ihre persönliche Wahrnehmung und Meinung zur Sachlage schildert, jedoch nicht aktiv zu konkreten Handlungen rät (ebd., 49ff.), ist Oenone im Vergleich dazu manipulierend und überschreitet dadurch eindeutig ihre Kompetenzen als Vertraute der Königin. Im Gegensatz dazu wird in der figural-expliziten Darstellung anhand Oenones Replik an mehreren Stellen deutlich, dass sie ihrer Herrin ehrlich ergeben und verbunden ist und sie ihr in den Tod folgen würde (ebd., 27/97). Von Phädra selbst wird ihr dementsprechend auch großes Vertrauen ausgesprochen (ebd., S. 89), wobei dieses Oenone im Laufe der Entwicklung der Ereignisse wieder entzogen und sie zunächst als schmeichlerisch (ebd., S. 85), später gar als intrigant bezeichnet (ebd., S. 133/149) wird. Auf figural-impliziter Ebene scheint durch, dass Oenone eine einfache Frau ist, die dazu neigt, erst zu reden, bevor sie die Folgen abwägt (ebd., S. 33). Weiterhin fehlt ihrer moralischer Tiefgang, was man daraus ableiten kann, dass sie sich wiederholt um weltliche Dinge wie Phädras Ruf und das Fortbestehen ihrer Herrschaft sorgt (ebd., S 95) und dafür bereit ist, Tugend und Sittlichkeit zu opfern (ebd., S. 97)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Oenone ein statischer und eindimensionaler Charakter ohne Selbstreflexion ist. Ihr Handeln bleibt gemäß der o.g. charakterlichen Bestimmung vorhersehbar und der Selbstmord nach Phädras Verbannung ist somit folgerichtig, was sich auch daran zeigt, dass sie sich sehr schnell mit ihrem Schicksal abfindet und den Ausgang als ihren verdienten Lohn betrachtet (ebd., S. 133), jedoch nicht, weil sie ihren Fehler einsieht, sondern weil sie jede Reflexion sofort abbricht.
[...]
1 Beispielsweise fragt er nicht weiter neugierig nach und bleibt sachlich, als Hippolytos andeutet, es gäbe ein „gräßliche[s]Geheimnis“ (Racine 1995, 79.
- Quote paper
- Fabian Hoppe (Author), 2020, Einführung und Grundlagen der französischen Literatur- und Kulturwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1189956