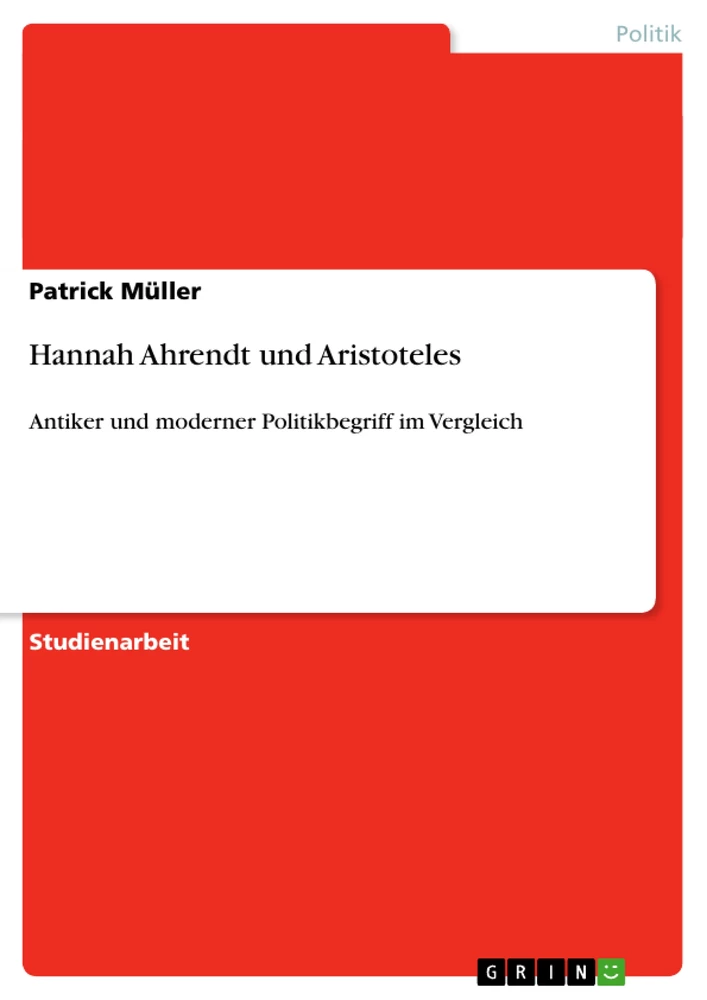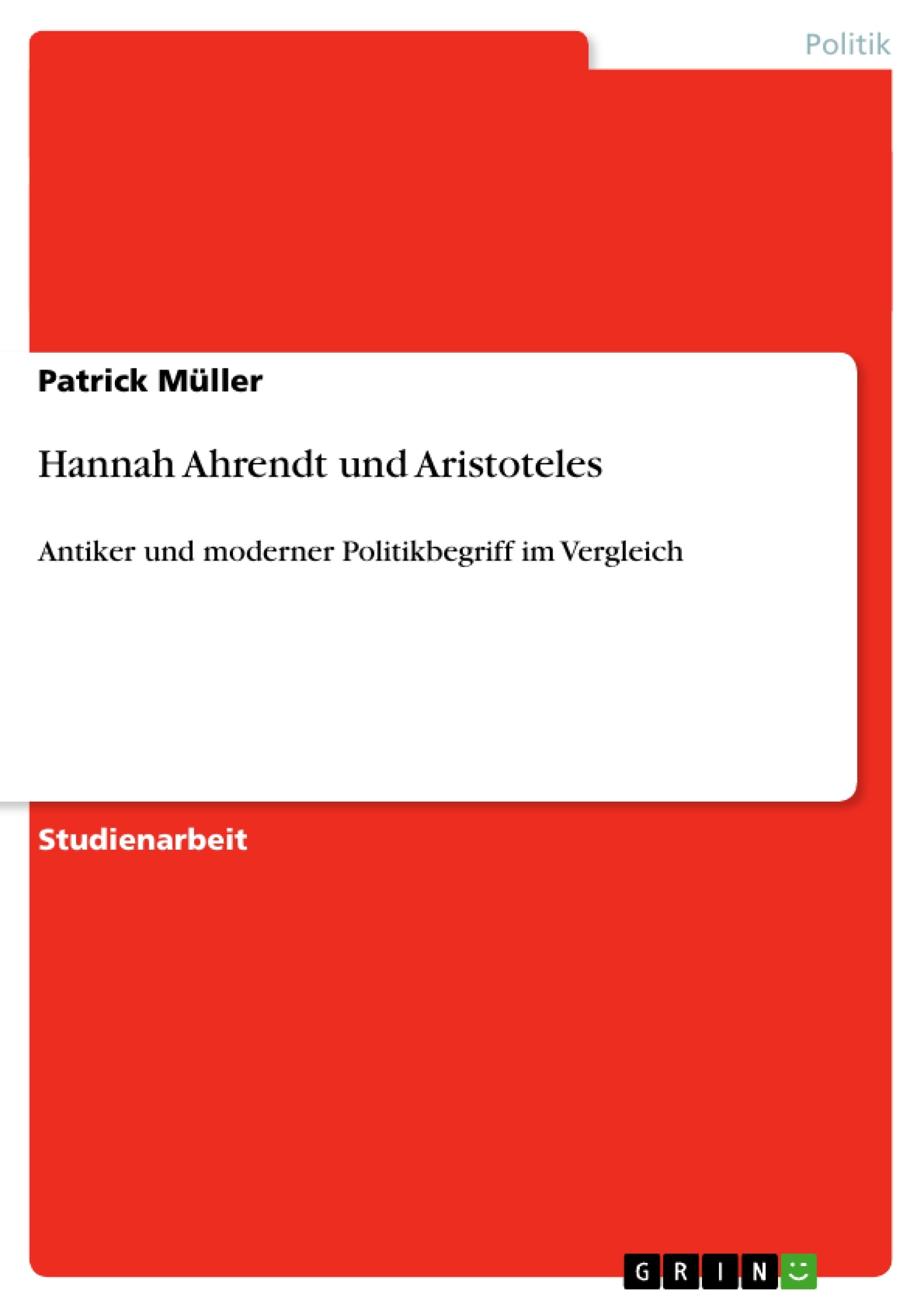In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird mitunter die gesteigerte Bedeutung
der Auseinandersetzung mit dem Werk Hannah Arendts vor dem Hintergrund
der Terroranschläge vom 11. September 2001 betont. Oft liegt dabei, was durchaus
nahliegend ist, der Schwerpunkt auf Arendts Hauptwerk „Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft“. Dieses gestiegene Interesse an Hannah Arendt lässt es sinnvoll
erscheinen sich auch mit ihrem anderen Hauptwerk, „Vita Activa oder Vom tätigen
Leben“, verstärkt auseinanderzusetzen. Zu eben dieser Auseinandersetzung will die
vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.
Zweck dieser Untersuchung soll die Auseinandersetzung mit zwei in der wissenschaftlichen
Publizistik zu findenden *esen sein. Die erste dieser *esen ist die
Dolf Sternbergers gemäß welcher das Denken Hannah Arendts seinen Ursprung
nicht, wie von ihr selbst in ihren Werken mitunter angedeutet, im platonischen sondern
vielmehr im aristotelischen Denken hat. Die andere *ese ist eine Lesart des
arendtschen Denkens welche von Margaret Canovan stammt, und welche unter anderem
auch von Richard J. Bernstein vertreten wird, nach der der Ursprung der politischen
Philosophie Hannah Arendts nicht in ihrer Auseinandersetzung mit der
antiken politischen Philosophie sondern in der Erfahrung des Totalitarismus liegt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- ERSTES KAPITEL
- Einführung
- ZWEITES KAPITEL
- Das politische Denken in der Antike: Der Politikbegriff des Aristoteles
- Vorbedingung aristotelischen Denkens
- Die griechische Polis
- Das voraristotelische politische Denken
- Der Begriff des Politischen bei Aristoteles
- Das Ziel des Politischen
- Die Polis als einzig politischer Raum
- Der Politikbegriff Hannah Arendts
- Politik als Handeln: Einführung in den Politikbegriff Hannah Arendts
- Der politische Raum und die ihn konstituierenden Elemente
- Das Handeln in Abgrenzung zum Herstellen und Arbeiten
- Vom Verhältnis der Politikbegriffe Hannah Arendts und Aristoteles
- Die Normativität des Politikbegriffs
- Bezugnahmen Hannah Arendts auf Aristoteles
- Die Kritik des Zoon Politikon
- Spontanität als Element des Politischen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Schlusswort und Fazit der Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verbindung zwischen dem politischen Denken Hannah Arendts und Aristoteles. Sie setzt sich mit zwei Thesen auseinander: Die erste, von Dolf Sternberger aufgestellt, besagt, dass Arendts Denken nicht platonisch, sondern aristotelisch geprägt ist. Die zweite These, vertreten von Margaret Canovan und Richard J. Bernstein, argumentiert, dass Arendts politisches Denken nicht in der Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie, sondern in der Erfahrung des Totalitarismus wurzelt. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Thesen zu analysieren und zu beurteilen, indem sie die Politikbegriffe von Arendt und Aristoteles gegenüberstellt.
- Vergleich der Politikbegriffe von Hannah Arendt und Aristoteles
- Analyse der These von Dolf Sternberger über die aristotelischen Wurzeln von Arendts Denken
- Bewertung der These von Margaret Canovan und Richard J. Bernstein über den Einfluss des Totalitarismus auf Arendts politisches Denken
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Politikbegriffen
- Bedeutung der „Vita Activa“ für Arendts politisches Denken
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die These der Arbeit vor und erläutert den Hintergrund der Untersuchung. Es wird auf die wachsende Bedeutung von Hannah Arendts Werk nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hingewiesen und die Relevanz ihrer Werke „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ und „Vita Activa oder Vom tätigen Leben“ hervorgehoben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem politischen Denken des Aristoteles. Es beschreibt die griechische Polis als wichtige Bedingung für das politische Verständnis der Antike und hebt die enge Verknüpfung von Bürger und Polis hervor. Anschließend wird das voraristotelische politische Denken beleuchtet, das Handeln auf die Polis als Gemeinschaft und das Gemeinwohl fokussiert. Das Kapitel schließt mit einer Analyse des aristotelischen Politikbegriffs, der das Ziel des Politischen und die Polis als einzigen politischen Raum definiert.
Schlüsselwörter
Hannah Arendt, Aristoteles, Politikbegriff, Vita Activa, Totalitarismus, Polis, Gemeinwohl, Handeln, Zoon Politikon, Spontanität, Normativität.
- Arbeit zitieren
- Patrick Müller (Autor:in), 2007, Hannah Ahrendt und Aristoteles, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/118898