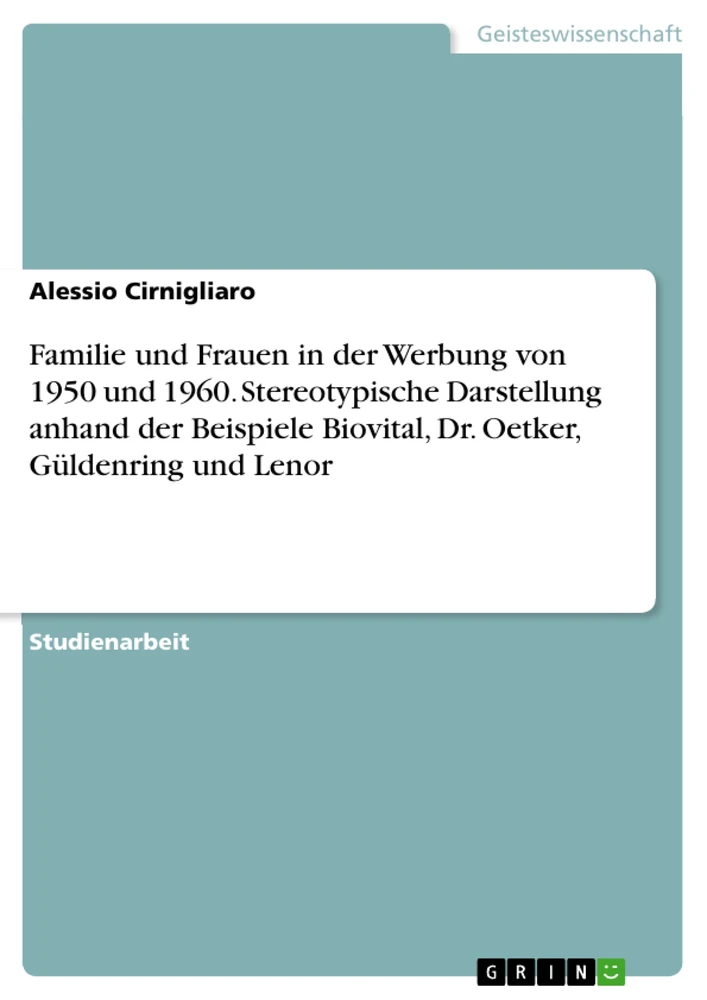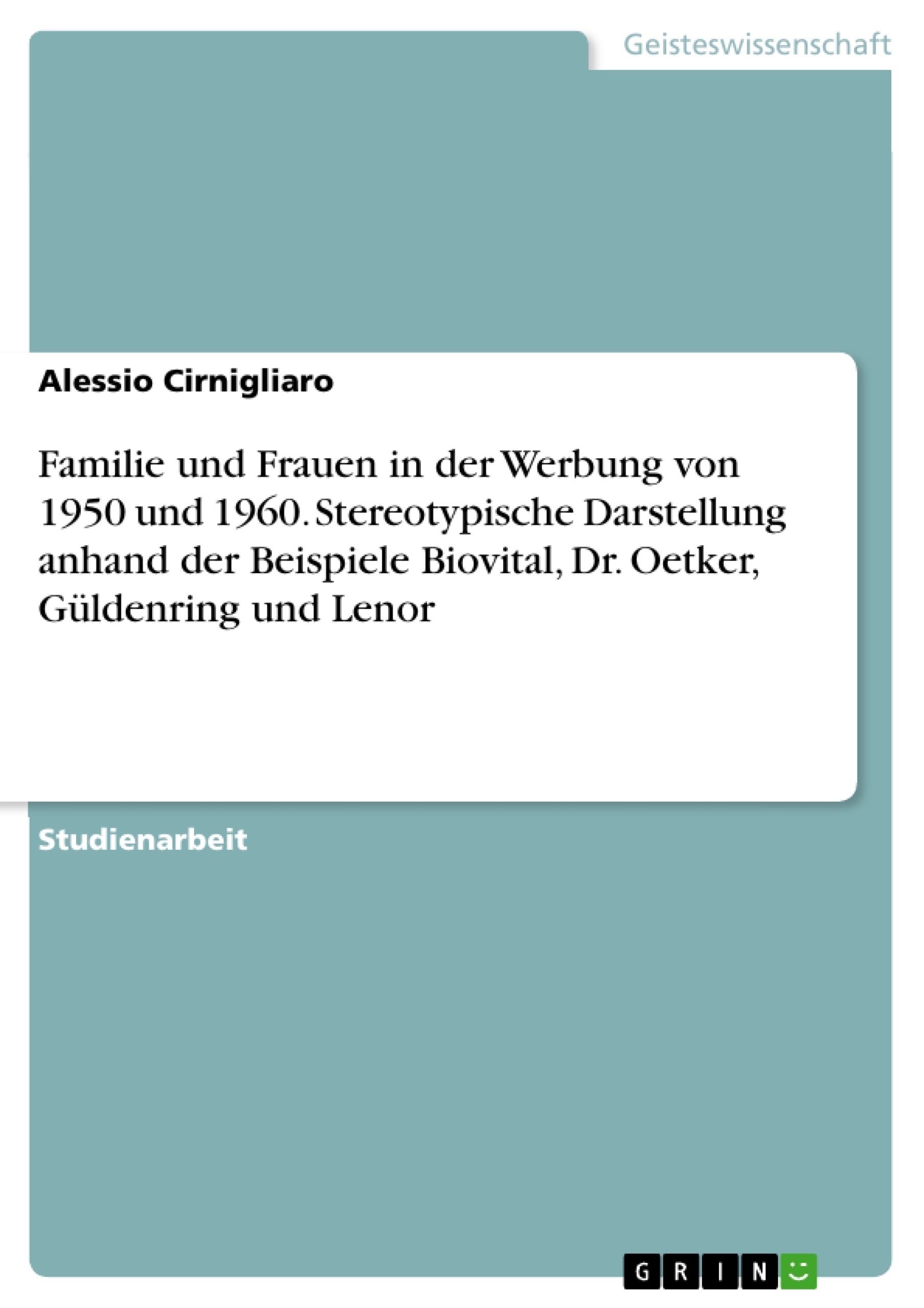Diese Arbeit thematisiert die Darstellung von Familien in Werbefilmen der 1950er und 1960er Jahre. Hierzu werden vier ausgewählte Werbefilme der 50er und 60er Jahre untersucht und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse näher beleuchtet. In den Werbefilmen auftretende Gemeinsamkeiten werden in Kategorien zusammengefasst. Diese Methode erlaubt es, auftretende Stereotypen zu kategorisieren, um dann in einem zweiten Schritt die Forschungsfrage zu beantworten, inwiefern ein gesellschaftliches Leitbild von Familie in der Werbung von 1950 bis 1970 deutlich wird. Die Arbeit konzentriert sich hierbei auf die Darstellung der Frau und möchte auf mögliche Stereotypen aufmerksam machen, die in der Werbung auftreten können.
Der Grund für den thematischen Schwerpunkt liegt in der heute noch festgestellten stereotypischen und frauenfeindlichen Darstellung der Frau in Werbefilmen. So verabschiedete am 26ten Juni 2007 die Parlamentarische Versammlung des Europarates eine Resolution mit dem Titel „The image of women in advertising“. Dieser Beschluss beklagt die Art und Weise, wie Frauen dargestellt würden. Die Bilder der Frau stünden immer noch im krassen Gegenteil zu ihrer tatsächlichen Rolle. Nach neueren Ansichten der Kommunikations- und Medientheorie trägt Werbung, als Teilsystem der Wirtschaft, einen Beitrag zur „Wirklichkeitskonstruktion“ bei. Demnach gebe es eine Wechselbeziehung zwischen Gesellschaft, Wirklichkeit und Werbung. Somit sei Werbung nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft, sondern selbst „Trendsetter, Impulsgeber und Verstärker gesellschaftlicher Entwicklungen“.
Werbung kann nur erfolgreich sein, wenn sie rechtzeitig den „gesellschaftlichen und kulturellen Wandel“ aufnimmt. Das bedeutet, sie muss „Lebensformen und Lebensstile, Gefühle und Werte, Erwartungen und Überzeugungen, Wünsche und Bedürfnisse, Selbstbilder und Sehnsüchte“ kongruent widerspiegeln. Sie muss den Zeitgeist erfassen. Aus diesem Grund kann Werbung einen gesellschaftlichen Effekt hervorbringen, „der Persönlichkeit und Sozialverhalten der Konsumenten beeinflusst.“ Folglich kann sie als Mittel der Sozialisation verstanden werden. Daraus folgt, dass Werbung auch zur Konstruktion von Geschlechterrollen beiträgt. Diese Tatsache macht die Analyse von Werbefilmen so interessant.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Methodisches Vorgehen
- 3.1. Werbung Lenor
- 3.2. Werbung Güldenring
- 3.3. Biovital Werbung
- 3.4. Werbung von Dr. Oetker: „Wenn man's eilig hat“
- 4. Ergebnispräsentation
- 4.1. Gute Mutter/Ehefrau = gute Hausfrau
- 4.2. Geringe Wertschätzung
- 4.3. Liebes Kind
- 4.4. Familienbild
- 5. Transfer
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Familien in deutschen Werbefilmen der 1950er und 1960er Jahre. Ziel ist es, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählter Werbespots stereotype Bilder von Familie und insbesondere der Rolle der Frau aufzuzeigen und deren Übereinstimmung mit einem gesellschaftlichen Leitbild zu beleuchten. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung weiblicher Rollen und deren mögliche stereotypische und frauenfeindliche Aspekte, die bis heute in der Werbung präsent sein können.
- Stereotypische Darstellung der Frau in der Werbung der 50er und 60er Jahre
- Gesellschaftliche Leitbilder von Familie in der Werbung
- Analyse von Werbebotschaften und deren Wirkung
- Vergleich der Werbebilder mit aktuellen Debatten über Geschlechterrollen
- Pädagogische Relevanz der Analyse von Werbefilmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der stereotypischen Darstellung von Familien in der Werbung der 1950er und 1960er Jahre ein. Sie begründet die Relevanz der Thematik mit der anhaltenden Problematik frauenfeindlicher Darstellungen in der Werbung und verweist auf relevante Resolutionen des Europarates. Die Einleitung erläutert die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Analyse von vier ausgewählten Werbefilmen konzentriert, um Gemeinsamkeiten und Stereotype zu identifizieren und deren Bedeutung im Kontext der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlechterrollen zu untersuchen.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den bestehenden Forschungsstand zur Werbeindustrie und deren Rolle in der Konstruktion sozialer Realitäten. Es diskutiert die Doppelrolle der Werbung als Spiegel und aktiver Gestalter gesellschaftlicher Werte und Normen. Es werden verschiedene theoretische Perspektiven vorgestellt, die die Wirkung von Werbung auf die Sozialisation und Identitätsbildung, insbesondere hinsichtlich der Geschlechterrollen, betonen. Der historische Kontext der Nachkriegszeit und die Bedeutung von Werbung als Orientierungs- und Identifikationshilfe werden ebenfalls behandelt.
3. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die qualitative Inhaltsanalyse als gewählte Methode und stellt die vier ausgewählten Werbefilme (Lenor, Güldenring, Biovital und Dr. Oetker) vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in die Auswahl der Werbefilme und die angewandte Methodik, die der Untersuchung zugrunde liegt.
4. Ergebnispräsentation: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse der vier ausgewählten Werbefilme. Es fasst die in den Werbespots identifizierten Stereotypen zusammen und kategorisiert sie unter verschiedenen Aspekten, wie z.B. der Darstellung der "guten Mutter/Ehefrau", der "geringen Wertschätzung" der Frau, dem "lieben Kind" und dem generellen "Familienbild". Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und interpretiert, wobei der Fokus auf den identifizierten Stereotypen und deren Bedeutung liegt.
5. Transfer: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung in Bezug zu den im Rahmen des Studiums besuchten Vorlesungen gesetzt. Es wird eine kritische Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse im Kontext der theoretischen Grundlagen vorgenommen, wodurch ein tiefergehendes Verständnis der Thematik und deren Relevanz entsteht. Dieser Transfer ermöglicht eine Verknüpfung von Theorie und Empirie und erweitert die Interpretation der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Werbung, Familienbild, Geschlechterrollen, Stereotype, Qualitative Inhaltsanalyse, 1950er Jahre, 1960er Jahre, Nachkriegszeit, Frauenbild, Sozialisation, Identitätsbildung, Medienwirkung, Gesellschaftliche Leitbilder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Familienbildern in der Werbung der 1950er und 1960er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Familien in deutschen Werbefilmen der 1950er und 1960er Jahre. Der Fokus liegt auf der Darstellung weiblicher Rollen und der Untersuchung stereotypischer und potenziell frauenfeindlicher Aspekte, die bis heute relevant sein können.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählter Werbespots stereotype Bilder von Familie und der Rolle der Frau aufzuzeigen und deren Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Leitbildern zu beleuchten. Es soll untersucht werden, wie Werbung zur Konstruktion sozialer Realitäten beitrug und welche Wirkung die Werbebotschaften auf die Sozialisation und Identitätsbildung hatten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet die qualitative Inhaltsanalyse als Methode. Ausgewählte Werbespots von Lenor, Güldenring, Biovital und Dr. Oetker wurden analysiert, um Gemeinsamkeiten und Stereotype zu identifizieren.
Welche Werbespots wurden untersucht?
Die Analyse umfasst vier Werbespots: Lenor, Güldenring, Biovital und einen Spot von Dr. Oetker ("Wenn man's eilig hat").
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Analyse identifizierte Stereotype in der Darstellung der Frau, wie z.B. die "gute Mutter/Ehefrau" gleichbedeutend mit einer "guten Hausfrau", geringe Wertschätzung der Frau, das "liebe Kind" und ein spezifisches "Familienbild". Diese Stereotype wurden detailliert dargestellt und interpretiert.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
Die Ergebnisse werden im Kontext der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlechterrollen interpretiert. Es wird untersucht, wie die Werbung gesellschaftliche Werte und Normen widerspiegelte und aktiv mitgestaltete.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Werbung, Familienbild, Geschlechterrollen, Stereotype, Qualitative Inhaltsanalyse, 1950er Jahre, 1960er Jahre, Nachkriegszeit, Frauenbild, Sozialisation, Identitätsbildung, Medienwirkung und Gesellschaftliche Leitbilder.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Forschungsstand, Methodisches Vorgehen, Ergebnispräsentation, Transfer (Verknüpfung mit Vorlesungsinhalten) und Fazit.
Welche Relevanz hat diese Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die anhaltende Problematik frauenfeindlicher Darstellungen in der Werbung und deren Wirkung auf die Sozialisation und Identitätsbildung. Sie trägt zum Verständnis der Konstruktion von Geschlechterrollen bei und hat pädagogische Relevanz.
Welche theoretischen Perspektiven werden berücksichtigt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene theoretische Perspektiven zur Wirkung von Werbung auf die Sozialisation und Identitätsbildung, insbesondere hinsichtlich der Geschlechterrollen. Der historische Kontext der Nachkriegszeit und die Bedeutung von Werbung als Orientierungs- und Identifikationshilfe werden ebenfalls behandelt.
- Arbeit zitieren
- Alessio Cirnigliaro (Autor:in), 2022, Familie und Frauen in der Werbung von 1950 und 1960. Stereotypische Darstellung anhand der Beispiele Biovital, Dr. Oetker, Güldenring und Lenor, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1188201