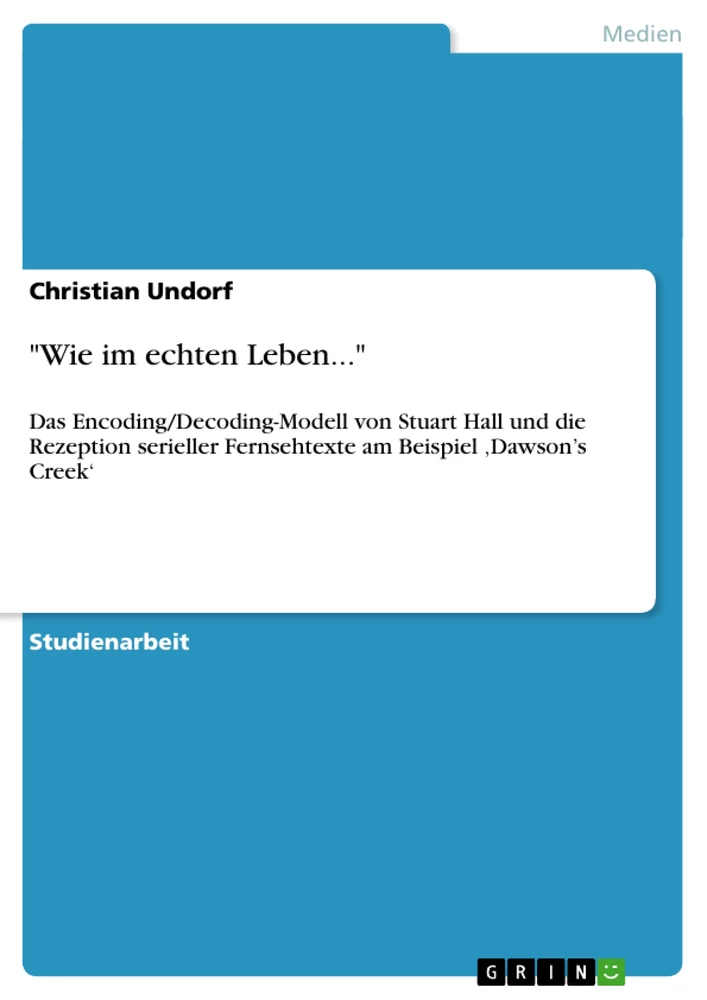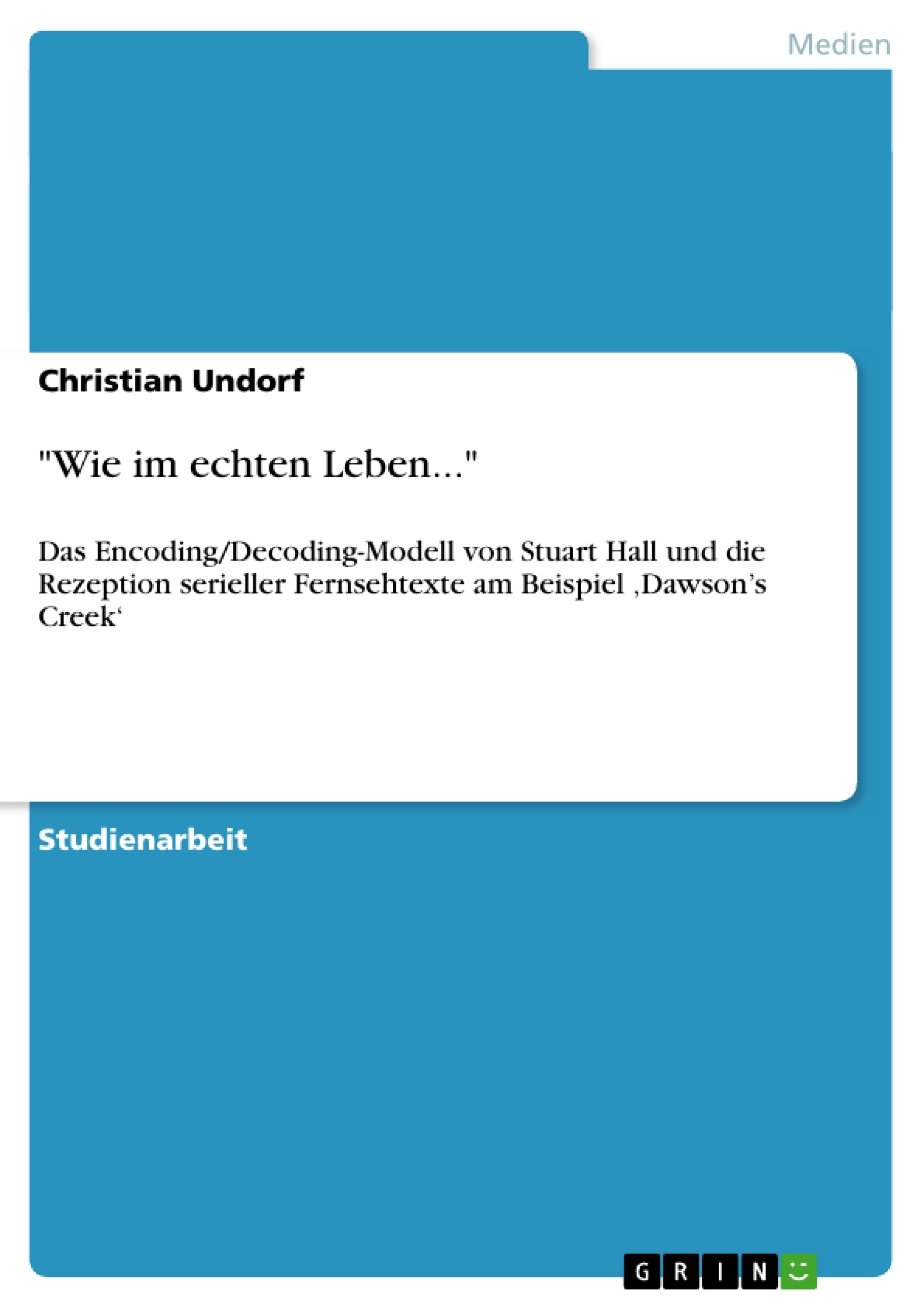Die fiktionalen Bilderwelten von Fernsehserien gehören fest zu unserem Alltag und im Fernsehen vergeht kaum eine Minute, in der nicht auf irgendeinem Kanal eine Serie ausgestrahlt wird. Doch wie gehen wir eigentlich mit diesen Inhalten um? Was passiert, wenn wir eine Fernsehserie rezipieren, und sei es nur aus Zeitvertreib? Sind wir Medieninhalten tatsächlich so machtlos ausgeliefert, wie es beispielsweise das Reiz-Reaktions-Modell oder andere medienwissenschaftliche Ansätze implizieren? Oder müssen wir den Fernsehzuschauer vielmehr als aktiv Handelnden betrachten?
Letztere Auffassung hat sich insbesondere in den Cultural Studies durchgesetzt. Diese vertreten die Meinung, dass sich die vollständige Wirkung eines Medientextes erst bei dessen Rezeption zeigt, abhängig von der aktuellen Situation des Rezipienten, dessen Vorwissen sowie beeinflusst durch eigene, persönliche Erfahrungen. Die Vorstellung Stuart Halls, einem herausragenden Vertreter der Cultural Studies, von der Aneignung von Fernsehtexten, in der Lesart und soziale Lage des Zuschauers untrennbar miteinander verknüpft sind, bildet die Grundlage dieser Arbeit. Das von ihm entwickelte Encoding/Decoding-Modell soll dabei nicht nur einen Schwerpunkt im ersten Teil der Ausarbeitung darstellen, sondern anschließend in der Untersuchung der US-amerikanischen Jugend-Dramaserie 'Dawson’s Creek' den theoretischen Bezugsrahmen bilden. Anhand einer beispielhaft ausgewählten Episode wird versucht, die von Hall konstatierten, verschiedenen Möglichkeiten der Deutung und Bewertung von Fernsehtexten zu veranschaulichen.
Die Arbeit soll einen Bogen schlagen vom Medienprodukt zur soziokulturell vermittelten Rezeption nach Stuart Hall sowie den daraus resultierenden möglichen Rezeptionspositionen und Lesarten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Encoding/Decoding-Modell von Stuart Hall - Ausgangspunkt und Bezugsrahmen dieser Arbeit
- Medienaneignung im soziokulturellen Kontext
- Drei hypothetische Lesarten von Medientexten
- Kritische Einwände gegen das Massenkommunikationsmodell
- Das Beispiel Dawson's Creek
- Geschichte und Konzept der Serie
- Die Episode „The Longest Day\" als exemplarischer Untersuchungsgegenstand
- Darstellung der möglichen Rezeptionspositionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Encoding/Decoding-Modell von Stuart Hall und dessen Anwendung auf die Rezeption der Fernsehserie „Dawson's Creek“. Ziel ist es, die verschiedenen Möglichkeiten der Deutung und Bewertung von Fernsehtexten zu veranschaulichen und die Relevanz des soziokulturellen Kontextes für die Medienaneignung aufzuzeigen.
- Das Encoding/Decoding-Modell als theoretischer Rahmen
- Die Rolle des soziokulturellen Kontextes in der Medienrezeption
- Die verschiedenen Lesarten von Fernsehtexten
- Die Analyse der Fernsehserie „Dawson's Creek“ als Beispiel
- Die Bedeutung der Rezeptionsforschung für das Verständnis von Medienwirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Medienrezeption und die Relevanz des Encoding/Decoding-Modells von Stuart Hall ein. Kapitel 2 erläutert das Encoding/Decoding-Modell im Detail, beleuchtet die Medienaneignung im soziokulturellen Kontext und stellt die drei hypothetischen Lesarten von Medientexten vor. Kapitel 3 analysiert die Fernsehserie „Dawson's Creek“ als Beispiel für die Anwendung des Encoding/Decoding-Modells. Dabei wird die Geschichte und das Konzept der Serie vorgestellt, die Episode „The Longest Day\" als exemplarischer Untersuchungsgegenstand ausgewählt und die möglichen Rezeptionspositionen dargestellt.
Schlüsselwörter
Encoding/Decoding-Modell, Medienaneignung, soziokultureller Kontext, Rezeption, Fernsehserie, Dawson's Creek, Lesarten, Deutung, Bewertung, Medienwirkungen.
- Quote paper
- Christian Undorf (Author), 2007, "Wie im echten Leben...", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/118414