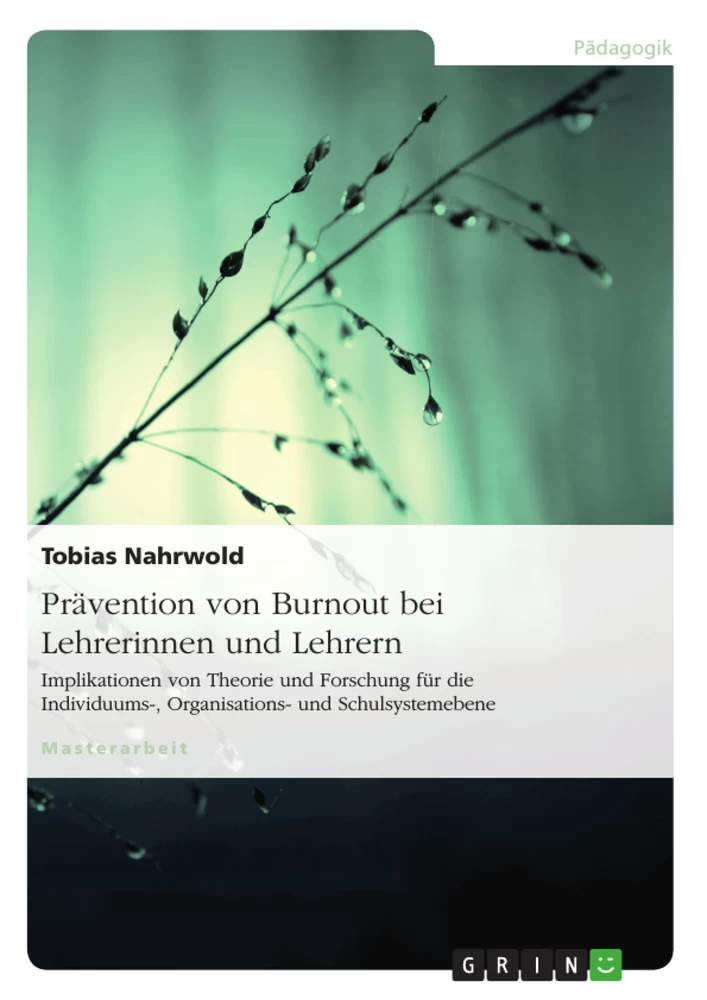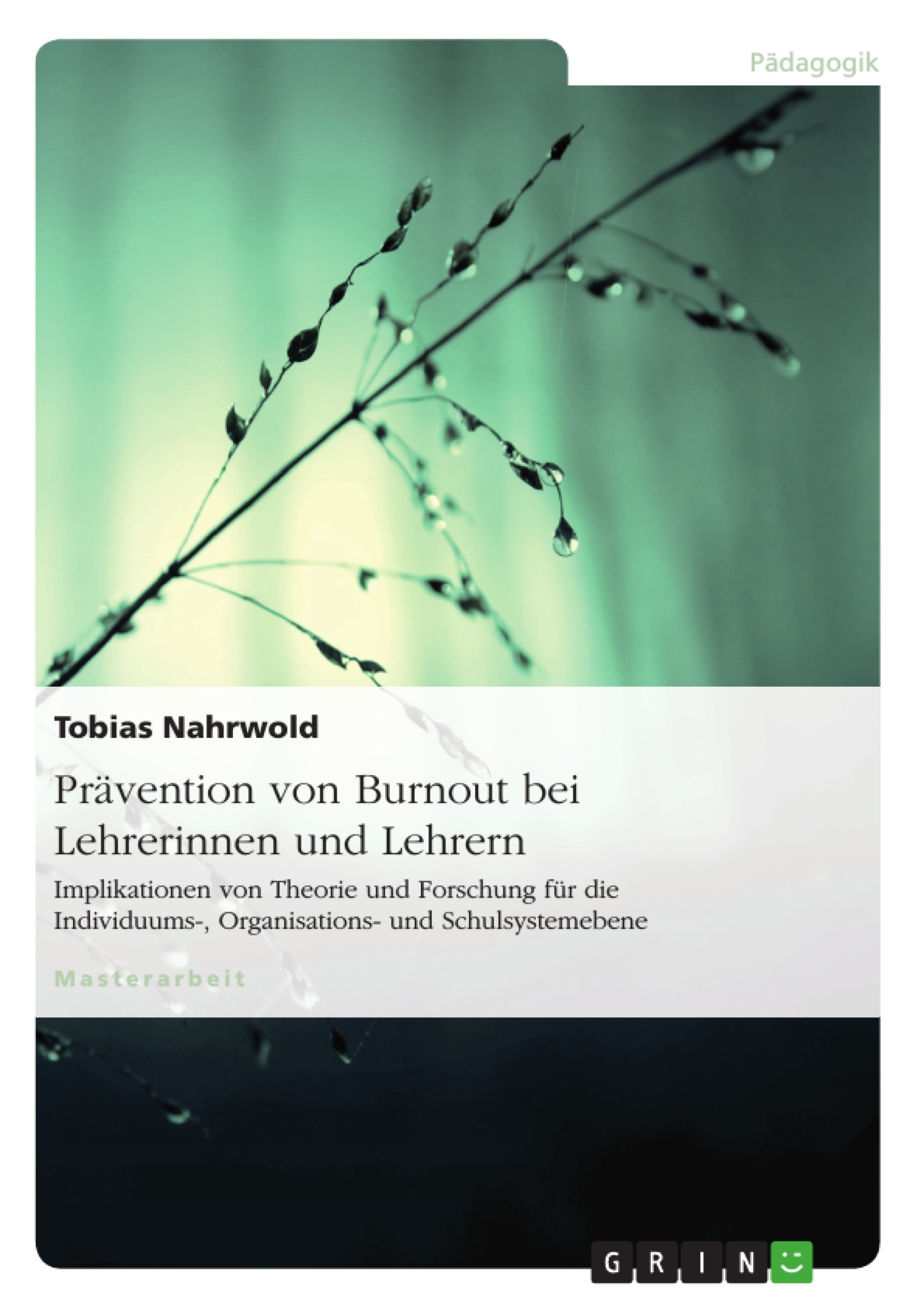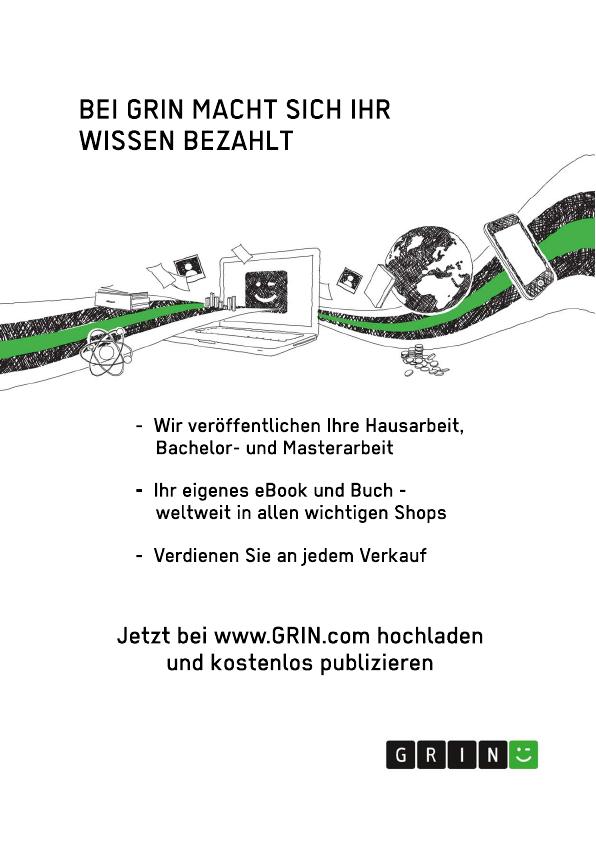Depressionen, häufig die letzte Stufe des Burnout-Syndroms als Folge übermäßiger Belastung, werden nach Einschätzungen von Experten bis zum Jahr 2020 das weltweit zweitgrößte Gesundheitsproblem nach Herzerkrankungen darstellen (vgl. WHO 2001, 7). Depressionen und Burnout sollten nicht nur entgegenwirkt werden, weil sie die zweitgrößte Ursache für Arbeitsausfälle und Frühpensionierungen sind, sondern auch, weil Wohlbefinden nach der WHO-Charta als Grundrecht und Entwicklungsziel für jedermann gilt (vgl. Sieland 2000, 35).
Mittlerweile wird angenommen, dass Burnout nicht nur in sozialen, sondern in allen Berufen auftreten kann. Immer mehr Arbeitgeber gestehen den Beschäftigten ein Sabbatical zu. Ist der Arbeitsplatz im Allgemeinen zu stressig, kommt nur noch Downshifting in Betracht. Ob sich hinter diesen Maßnahmen jedoch nur aktuelle Trends oder auch längerfristige Erholungsmöglichkeiten für einen Großteil der Bevölkerung verbergen, wird sich noch zeigen. Dabei ist Burnout – auch im Lehrerberuf – nichts Neues. Der Begriff wurde erstmals 1974 vom deutschamerikanischen Psychologen Herbert Freudenberger in einem psychologischen Kontext verwendet (vgl. Schmid 2003, 25). Doch bereits 1911 wurde in einem Artikel aus dem Oberpfälzer Schulanzeiger über eine Lehrerkrankheit namens Neurasthenie berichtet, deren Symptome wie Erschöpfung, verminderte Leistungsfähigkeit und Angstgefühle dem modernen Burnout-Syndrom stark ähneln (vgl. Barth 1992, 13-14 und Schmid 2003, 24).
Das nicht mehr steuerlich absetzbare häusliche Arbeitszimmer (vgl. Simon 2007), Zeitarbeitsverträge für junge Lehrer, die teilweise vor den Sommerferien entlassen und zum Beginn des neuen Schuljahres bei derselben Schule wieder eingestellt werden (vgl. Grüter 2008) sowie Überlegungen der niedersächsischen Kultusministerin Heister-Neumann zur Verschiebung des Überstunden-Ausgleiches (vgl. Berger 2008) stellen aktuelle in den Medien diskutierte Belastungen von Lehrern dar. Ebenso wird häufig über die hohe Burnout- und Frühpensionierungs-Quote im Lehrerberuf berichtet. Als Gründe werden oft destruktives Schülerverhalten und die zum Umgang hiermit fehlenden Ausbildungsangebote genannt, zugleich immer ‚schwierigere‘ Kinder und weniger intakte Familien (vgl. Tscharnke 2001, 16). Auch über die Prävention von Stress und Burnout im Allgemeinen existiert eine große Menge an populärwissenschaftlicher Literatur, vor allem über Entspannungstechniken.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Stress, Bewältigung und Burnout – Modelle und Definitionen
2.1 Stress als Reaktion und Reiz
2.2 Stress und Bewältigung als Transaktion
2.3 Burnout und (Über-)Belastung
3. Besondere Anforderungen in personenbezogenen Dienstleistungen und speziell im Lehrerberuf
3.1 Interaktionsstress und Kommunikationsdefizit
3.2 Lehrerpersönlichkeit und Lehrerbild
3.3 Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen
3.4 Besonderheiten des Lehrerberufs und der Institution Schule
4. Ausgewählte Befunde zu Stress, Burnout und Gesundheit bei Lehrern
4.1 Belastungssituation
4.1.1 Belastungen auf der Individuumsebene
4.1.2 Belastungen auf der Organisationsebene
4.1.3 Belastungen auf der Systemebene
4.2 Entlastungsmöglichkeiten
4.3 Überprüfung von Theorien
4.3.1 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus et al.
4.3.2 Die sozial-kognitive Theorie: Selbstwirksamkeit nach Bandura
4.3.3 Entflammtsein als Ursache von Burnout?
5. Zusammenfassung und Perspektiven: Prävention und Intervention bei Stress und Burnout
5.1 Implikationen für die Systemebene
5.2 Implikationen für die Organisationsebene
5.3 Implikationen für die Individuumsebene
5.3.1 Ressourcen stärken, erholen und evaluieren
5.3.2 Disziplinförderung
5.3.3 Offener Unterricht und Methodenvielfalt
5.3.4 Arbeitsökonomie und Zeitmanagement
5.4 Perspektiven
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, jeweils die weibliche und die männliche Bezeichnung zu verwenden. Soweit neutrale oder männliche Bezeichnungen verwendet werden, sind darunter jeweils weibliche und männliche Personen zu verstehen.
1. Einleitung
Depressionen, häufig die letzte Stufe des Burnout-Syndroms als Folge übermäßiger Belastung, werden nach Einschätzungen von Experten bis zum Jahr 2020 das weltweit zweitgrößte Gesundheitsproblem nach Herzerkrankungen[1] darstellen (vgl. WHO 2001, 7). Depressionen und Burnout sollten nicht nur entgegenwirkt werden, weil sie die zweitgrößte Ursache für Arbeitsausfälle und Frühpensionierungen sind, sondern auch, weil Wohlbefinden nach der WHO-Charta als Grundrecht und Entwicklungsziel für jedermann gilt (vgl. Sieland 2000, 35).
Mittlerweile wird angenommen, dass Burnout nicht nur in sozialen, sondern in allen Berufen auftreten kann. Immer mehr Arbeitgeber gestehen den Beschäftigten ein Sabbatical[2] zu. Ist der Arbeitsplatz im Allgemeinen zu stressig, kommt nur noch Downshifting[3] in Betracht. Ob sich hinter diesen Maßnahmen jedoch nur aktuelle Trends oder auch längerfristige Erholungsmöglichkeiten für einen Großteil der Bevölkerung verbergen, wird sich noch zeigen. Dabei ist Burnout – auch im Lehrerberuf – nichts Neues. Der Begriff wurde erstmals 1974 vom deutsch-amerikanischen Psychologen Herbert Freudenberger in einem psychologischen Kontext verwendet (vgl. Schmid 2003, 25). Doch bereits 1911 wurde in einem Artikel aus dem Oberpfälzer Schulanzeiger über eine Lehrerkrankheit namens Neurasthenie berichtet, deren Symptome wie Erschöpfung, verminderte Leistungsfähigkeit und Angstgefühle dem modernen Burnout-Syndrom stark ähneln (vgl. Barth 1992, 13-14 und Schmid 2003, 24).
Das nicht mehr steuerlich absetzbare häusliche Arbeitszimmer (vgl. Simon 2007), Zeitarbeitsverträge für junge Lehrer, die teilweise vor den Sommerferien entlassen und zum Beginn des neuen Schuljahres bei derselben Schule wieder eingestellt werden (vgl. Grüter 2008) sowie Überlegungen der niedersächsischen Kultusministerin Heister-Neumann zur Verschiebung des Überstunden-Ausgleiches (vgl. Berger 2008) stellen aktuelle in den Medien diskutierte Belastungen von Lehrern dar. Ebenso wird häufig über die hohe Burnout- und Frühpensionierungs-Quote im Lehrerberuf berichtet[4]. Als Gründe werden oft destruktives Schülerverhalten und die zum Umgang hiermit fehlenden Ausbildungsangebote genannt, zugleich immer ‚schwierigere‘ Kinder und weniger intakte Familien (vgl. Tscharnke 2001, 16). Auch über die Prävention von Stress und Burnout im Allgemeinen existiert eine große Menge an populärwissenschaftlicher Literatur, vor allem über Entspannungstechniken.
In der vorliegenden Arbeit soll es jedoch darum gehen, sich den Begriffen Stress und Burnout zunächst theoretisch zu nähern (&Kapitel 2). Stress wird im Folgenden verstanden als ein Missverhältnis von Anforderungen und Anpassungsfähigkeit und Burnout als Folge einer solchen langfristigen Diskrepanz. Bei den Präventionsmaßnahmen wird zwischen Systemebene bzw. Bildungspolitik, Organisationsebene bzw. Einzelschule sowie Individuumsebene bzw. Einzellehrer unterschieden, da hier jeweils unterschiedliche Personen agieren müssen, um das Burnoutrisiko zu minimieren. Dieses Kapitel behandelt auch theoretische Konzepte gegen das Ausbrennen, wie das Selbstwirksamkeitskonstrukt nach Bandura.
In &Kapitel 3 werden die beunruhigend hohen, psychisch begründeten Frühpensionierungszahlen von Lehrern angesprochen und mögliche Ursachen – besondere Anforderungen wie Interaktionsstress, Rollenkonflikte und eine veränderte Kindheit der Schüler – beschrieben.
Die Ergebnisse empirischer Studien sind Inhalt des &4. Kapitels. Es werden Belastungs- und Entlastungsfaktoren aus verschiedenen Untersuchungen vorgestellt. Besonders die von Schaarschmidt et al. an etwa 16.000 Lehrern durchgeführte Potsdamer Lehrerstudie erweist sich dabei als gehaltvolle Datenquelle. Außerdem umfasst dieses Kapitel Überprüfungen einiger Stress- und Burnoutkonzepte, die in &Kapitel 2 vorgestellt wurden.
In &Kapitel 5 schließlich werden mittels der theoretischen Erkenntnisse zu Stress und Burnout, der Informationen über die besonderen Anforderungen an Lehrer als auch anhand der empirischen Untersuchungsergebnisse zusammenfassend Präventions- und Interventionsmöglichkeiten auf den drei strukturellen Ebenen zusammengefasst und weiter ausgeführt. Über die erwartete Wirksamkeit der prophylaktischen Maßnahmen wird ein kurzer Ausblick gegeben: Während auf der Systemebene keine entscheidenden Reformen, wie eine vermehrte Einstellung von Lehrern (die zu geringeren Klassengrößen führt), zu erwarten sind, bergen vor allem Veränderungen auf Ebene der Einzelschule oder auf Ebene des Individuums (des einzelnen Lehrers oder im Verbund einer kleinen Gruppe von Kollegen) ein hohes Potenzial für einen wirksamen Schutz vor Überbelastung und Burnout.
2. Stress, Bewältigung und Burnout – Modelle und Definitionen
2.1 Stress als Reaktion und Reiz
Stress als Reaktion
Bereits in den 1930ern veröffentlichte Hans Selye seine ersten Theorien zum Thema Stress, die er ausführlicher in seinem 1956 erschienenen Buch The stress of life modellierte. Er näherte sich Stress aus physiologischer und medizinischer Sicht und beschrieb ausführlich ein somatisches Reaktionsmuster, das er Allgemeines Adaptionssyndrom (AAS) nannte. Es stellt eine unspezifische Abwehrmaßnahme dar, die bei günstigem (Eustress) wie auch ungünstigem Stress (Distress) in drei Phasen (Alarm-, Widerstands- und Erschöpfungsphase) abläuft. Die körperliche Schädigung sei bei Eustress jedoch weitaus geringer. Nach Selye antwortet der Körper auf Reize (auch Reize mit emotionaler Beteiligung), „in einer stets gleichartigen Reaktionsweise“ (Thews/Mutschler/Vaupel 1999, 504): Wirkt ein auslösender Reiz (Stressor) auf den Organismus ein, wird vermehrt entzündungshemmendes Cortisol produziert. Unter anderem steigt der arterielle Blutdruck und Blut wird in die Skelettmuskeln umgeleitet, also die Muskeln, die für die willkürlichen Körperbewegungen, z.B. von Armen und Beinen zuständig sind. Während kurzfristige Blutdruckanstiege sinnvolle Reaktionen des Körpers darstellen (Alarmphase), ist ständig erhöhter Blutdruck (Widerstandsphase) infolge von chronischem Stress gesundheitsschädlich (Erschöpfungsphase; vgl. insg. Lyon 2005, 26-29, Rice 2005b, 51-56 und Schmidt 2004, 57).
An Selyes Reaktionsmodell wurde viel Kritik geübt, unter anderem weil es Kognition, Wahrnehmung und subjektive Interpretation des Reizes außer Acht lässt (vgl. Mason 1971, aufgeführt nach Rice 2005b, 56) und reaktionsbasierte Studien bei Menschen gezeigt haben, dass Stresserleben reiz- oder situationsspezifisch ist und von individuellen Verarbeitungsmustern abhängt (vgl. Lyon 2005, 29 und Wagner-Link 2005, 30). Das Modell erfasst nicht die Komplexität der Realität und Stress wird zu stark vereinfacht in guten Eu- und ungünstigen Distress eingeteilt. Außerdem haben Studien der letzten drei bis vier Jahrzehnte belegt, dass Stressreaktionen starken psychologischen Einflüssen unterliegen: „Stress entsteht vor allem im Kopf“ (Spitzer 2007, 173 und vgl. Hillert 2004, 74).
Stress als Reiz
Eine zweite Herangehensweise an die Erforschung von Stress ist, Stress im Sinne eines Reizes als Folge eines spezifischen Umweltereignisses zu sehen, das mit einer Störungsreaktion beantwortet wird (vgl. Lazarus/Launier 1981, 220-221). In diesem Zusammenhang entstand die Analyse von größeren Lebensereignissen (life events) und kleineren täglichen Belastungen (daily hassles). Der Einfluss von Lebensereignissen auf die mentale und körperliche Gesundheit wird mit Hilfe einer Skala in Lebensveränderungseinheiten (life change units, LCUs) gemessen, indem Probanden den Stress von aufgelisteten Lebensereignissen z.B. im Verhältnis zum Heiratsstress bewerten. Neben allgemeinen Skalen mit Ereignissen, die jeden Menschen treffen können, wie ‚Tod eines engen Familienmitgliedes‘ oder ‚Scheidung der Eltern‘, gibt es auch Skalen für bestimmte soziale Gruppen. So enthält eine studentische Stress-Skala zusätzlich Ereignisse wie ‚Nichterreichen eines wichtigen Scheines‘ oder ‚Wechsel der Universität‘ (vgl. Zimbardo/Gerrig 2004, 568).
Die daily-hassles-Forschung geht dagegen davon aus, dass kleinere Alltagsprobleme einen bedeutenderen Einfluss auf das Wohlbefinden haben als große Lebensereignisse. Hierzu zählen z.B. Probleme mit dem Übergewicht oder der Garten- und Hausarbeit (vgl. Kramis-Aebischer 1995, 31). Auch Lazarus und Folkman (vgl. 1987, 148-150) untersuchten Anfang der 1980er den Einfluss von daily hassles und kamen zu folgenden Ergebnissen: Alltägliche Probleme haben mehr Einfluss auf die psychische und somatische Gesundheit als große Lebensereignisse, vor allem auf die Gesundheit und Stimmung des aktuellen und des folgenden Tages. Außerdem unterscheiden sie zwischen zentralen (wichtige andauernde persönliche Konflikte) und peripheren Belastungen (z.B. Stau, schlechtes Wetter), wobei erstere einen größeren Einfluss auf das Wohlbefinden haben als letztere.
Wie beim Reaktionsansatz wird der Mensch auch beim Reizkonzept „als passives Objekt von Umweltbelastungen“ (Badura/Pfaff 1989, 646) begriffen. Erst interaktionale und transaktionale Stresskonzepte betrachten den Menschen als Subjekt, „das sich mit den Umweltbelastungen aktiv auseinandersetzt“ (ebd.).
2.2 Stress und Bewältigung als Transaktion
Bereits interaktionale Stresskonzepte zeichnen sich dadurch aus, dass sie Stress als Prozessgeschehen zwischen Person und Umwelt betrachten. Transaktionale Stresskonzepte verzichten zusätzlich auf eine Ursache-Wirkungs-Zuordnung (vgl. Busch 1998, 97): „Mit Transaktion beschränkt sich Stress nicht nur auf Input und Output, sondern stellt eine Verbindung dar zwischen einer sich veränderlichen Situation und einer denkenden, fühlenden und handelnden Person.“ (Kramis-Aebischer 1995, 33).
Transaktionales Stressmodell nach Lazarus et al.
Das transaktionale Stressmodell, das von Lazarus seit den 1960ern vertreten wird, ist vermutlich, zumindest unter Psychologen, das weithin anerkannteste (vgl. Busch 1998, 97 und Schwarzer 2000, 17). Auch in dieser Arbeit wird von einer transaktionalen Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt ausgegangen. Nach Lazarus und Launier (1981) besitzen Person-Umwelt-Beziehungen bei Stress, Emotion und Bewältigung eine fortlaufende Dynamik. Person- und Umweltvariablen und ihre Bedeutung ändern sich ständig im Verlauf des Anpassungsprozesses mit dem Einwirken der Person auf die Umwelt und in Übereinstimmung mit Rückmeldungen aus ihr (vgl. ebd., 219). „Bewältigung verändert die Person-Umwelt-Beziehung, und starke Emotionen dauern nie lange an, sondern kommen und gehen oder verändern sich mit der Zeit in Abhängigkeit von der sich verändernden Beziehung.“ (ebd.).
Stress ist nach Lazarus und Launier (1981, 226) eine gestörte Person-Umwelt-Beziehung bzw.
„jedes Ereignis ..., in dem äußere oder innere Anforderungen (oder beide) die Anpassungsfähigkeit eines Individuums, eines sozialen Systems oder eines organischen Systems beanspruchen oder übersteigen... Streß schließt somit eine Transaktion ein, in der Fähigkeiten mobilisiert werden müssen“ (Hervorh. im Orig.).
Kognitive Bewertungsprozesse (cognitive appraisals) und Bewältigung (coping) sind die zwei zentralen Konstrukte des transaktionalen Ansatzes von Lazarus et al. (vgl. Lazarus/Folkman 1987, 145), welcher in &Abbildung 1 zusammenfassend dargestellt wird.
Die kognitive Bewertung besteht aus sich ständig ändernden Beurteilungen über die Bedeutung des laufenden Geschehens. „Solche Beurteilungen finden immer statt – die adaptive Auseinandersetzung mit der Umwelt erfolgt kontinuierlich und verändert sich ständig –, obwohl Bewertungen auch eine gewisse Stabilität besitzen ... können“ (Lazarus/Launier 1981, 233). Man fragt sich daher ständig: ‚Was bedeutet das für mich persönlich?‘ Unterschieden wird zwischen der primären Bewertung (primary appraisal), welche sich auf die Bedeutung des
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ereignisses für das Wohlbefinden der Person bezieht und der s ekundären Bewertung (secondary appraisal), bei der die verfügbaren Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten beurteilt werden. Primäre und sekundäre Bewertung müssen nicht notwendigerweise zeitlich aufeinander folgen, auch ist die primäre nicht wichtiger als die sekundäre. Bessere Begrifflichkeiten wären z.B. Ereignisbewertung und Ressourcenbewertung. Die Autoren belassen es jedoch bei ihrer Benennung, weil „bereits soviel hierüber geschrieben worden [ist]“ (Lazarus/Launier 1981, 238; vgl. insg. Lazarus/Launier 1981, 233; Lazarus/Folkman 1987, 145).
Die primäre Bewertung des Wohlbefindens ist in drei Kategorien eingeteilt: Ein Ereignis kann als irrelevant, günstig/positiv oder stressend bewertet werden. Wird es als irrelevant eingeschätzt, betrachtet es die Person als ohne jegliche Auswirkung auf ihr Wohlbefinden. Diese Beurteilung kann sich jedoch schnell mit der Reizkonfiguration oder durch Reflexion ändern. Wird eine Situation als günstig/positiv bewertet, sieht eine Person ein Zeichen für Sicherheit oder für eine positive Lage der Dinge in einem Ereignis. Da „alles in Ordnung ist, kann sie sich entspannen und dem zuwenden, was sonst noch ansteht“ (Lazarus/Launier 1981, 234). Auch eine solche Bewertung kann sich über die Zeit verändern, so kann sie z.B. im Hinblick darauf, dass die Bedingung nicht fortbestehen könnte, in eine Bedrohung übergehen. Schließlich kann ein Ereignis auch als stressend bewertet werden. Diese Bewertung tritt in drei Formen auf, als Schädigung/Verlust, Bedrohung und Herausforderung. Alle drei schließen „eine gewisse negative Bewertung des eigenen gegenwärtigen oder zukünftigen Wohlbefindens“ ein (Lazarus/Launier 1981, 235), wobei Herausforderung Potenzial zum Meistern der Situation oder zu Gewinn bietet (vgl. insg. Lazarus/Launier 1981, 233-235; Lazarus/Folkman 1987, 145).
Mit Schädigung/Verlust ist eine bereits eingetretene Schädigung gemeint, während sich Bedrohung auf eine antizipierte Schädigung oder Verlust bezieht. Schädigung/Verlust und Bedrohung vermischen sich häufig, wenn beispielsweise nach einer eingetretenen Behinderung oder einem Trauerfall mit zukünftigen neuen Anforderungen oder finanziellen Verlusten zu rechnen ist. Im Unterschied zur Bedrohung besitzt Herausforderung eine eher positive Tönung. Wird ein Ereignis als Herausforderung bewertet, wird es mit einer schwer erreichbaren, vielleicht risikoreichen, aber mit positiven Folgen verbundenen Meisterung oder einem Nutzen assoziiert. Ob eine Situation als Bedrohung oder als Herausforderung bewertet wird, hängt wahrscheinlich nicht nur von den Umweltbedingungen, sondern auch von den Überzeugungen und Bewältigungsfähigkeiten der Person ab: „Einige Personen scheinen durch einen Denkstil gekennzeichnet zu sein, der sie eher zur Herausforderung als zur Bedrohung disponiert“ (Lazarus/Launier 1981, 236). Solche Bewertungstendenzen werden appraisal styles genannt (vgl. Schwarzer 2000, 17) Schädigung/Verlust, Bedrohung und Herausforderung sind breite Kategorien primärer Bewertung, die weiter in Subkategorien aufgeteilt werden können – z.B. Verlust sozialer Anerkennung, Bedrohung der physischen Unversehrtheit etc. (vgl. insg. Lazarus/Launier 1981, 235-237; Lazarus/Folkman 1987, 145-146)
Die sekundäre Bewertung bezieht sich auf die verfügbaren Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten der Person. Bereits aus einer primären Bewertung als Bedrohung oder einer Schädigung bzw. eines Verlustes können Kognitionen über Bewältigungsmöglichkeiten und -fähigkeiten gebildet werden, so kann man „z.B. auf Wege achten, wie man aus einem Theater entfliehen oder sich auf eine Prüfung vorbereiten kann, ohne notwendigerweise das Gefühl unmittelbarer Gefahr zu haben“ (Lazarus/Launier 1981, 238). Primäre und sekundäre Bewertung beeinflussen sich auch gegenseitig. So kann das Wissen, dass man eine potenzielle Gefahr überwinden kann, diese Gefahr fragwürdig erscheinen lassen. Der Grund für diese gegenseitige Beeinflussung liegt in der Definition des psychologischen Stress selbst: „Eine potentielle Schädigung ist dann keine Schädigung, wenn die Person damit leicht fertig werden kann, und wenn sie so bewertet wird, entsteht nur geringe oder keine Bedrohung“ (ebd., 240). Die hier betrachteten Bewertungsprozesse können auch unbewusst ablaufen, „obwohl wir häufig bewußt und willkürlich über Bewältigungsmöglichkeiten nachdenken, insbesondere in antizipatorischen Situationen, die allmählich entstehen und Reflexion erlauben“ (ebd.). Bewerten und Bewältigen gehen konzeptionell Hand in Hand: Welcher Prozess gerade stattfindet – Sekundärbewertung oder Bewältigung –, kann nur durch vollständige Untersuchung der psychischen Vorgänge bei der Person und des Kontexts herausgefunden werden. Eine Bewertung ist dann das Ergebnis eines Bewältigungsprozesses, „wenn dadurch eine gezielte Suche nach Informationen und Bedeutungen zustande kommt, auf deren Grundlage unter Stress gehandelt werden kann“ (Lazarus 2005, 244; vgl. insg. Lazarus/Launier 1981, 238-240 und Lazarus/Folkman 1987, 146).
Informationen über eigene Reaktionen und über die Umwelt sowie anschließende Reflexionen können zu einer Neubewertung (reappraisal) führen. Es entstehen Rückmeldeschleifen, z.B. durch Rückmeldungen über die Adäquatheit des Bewältigungsprozesses durch andere Personen, durch einen offensichtlichen Fortschritt der Problemlösung selbst oder durch Veränderungen der emotionalen Empfindlichkeit (vgl. Kramis-Aebischer 1995, 35 und Schmid 2003, 57). „Streßemotionen und emotionale Zustände allgemein kommen und gehen und verändern sich qualitativ in Abhängigkeit von den sich ändernden Transaktionen mit der Umwelt“ (Lazarus/Launier 1981, 241). Der Input aus der Umwelt, an den sich das Verhalten der Person in gewissem Grad anpassen muss, wird dabei durch relativ stabile Persönlichkeitseigenschaften gefiltert (vgl. ebd.).
Bewältigung nach dem transaktionalen Modell von Lazarus et al.
Lazarus und Launier (1981) führen aus, dass bisherige Bewältigungskonzepte zu wenig dynamisch orientiert waren und sich entweder auf Reize wie Erregung oder Triebe konzentrierten, wie beim ‚animal model‘, oder auf Charakteristika und Stile, wie beim ‚ego psychology model‘ (vgl. Lazarus/Folkman 1987, 146). Die Autoren legen jedoch Wert darauf, dass es sowohl automatische Reaktionen (wie beim Treten der Bremse) als auch Situationen gibt, in denen nicht klar ist, welche Reaktion angemessen ist. Bewältigung besteht daher für Lazarus und Launier (1981, 244) „sowohl aus verhaltensorientierten als auch intrapsychischen Anstrengungen, mit umweltbedingten und internen Anforderungen sowie den zwischen ihnen bestehenden Konflikten fertig zu werden“. Bewältigungsprozesse werden klassifiziert nach instrumentellem Schwerpunkt, Funktionen, zeitlicher Orientierung und Bewältigunsformen.
Der instrumentelle Schwerpunkt eines Bewältigungsprozesses kann das Selbst, die Umwelt oder beides sein, je nachdem was das Individuum für den Stress verantwortlich macht. Die eigenen Merkmale (z.B. Ziele, Überzeugungen, Reaktionsgewohnheiten) zu verändern, macht einen Großteil der Bewältigungsbemühungen aus, ebenso kann man versuchen, die Umwelt zu verändern (z.B. andere Personen ansprechen), um das Ärgernis zu beseitigen (vgl. insg. Lazarus/Launier 1981, 247-248).
Das Bewältigungsbemühen kann vor allem zwei Funktionen erfüllen: Eine Änderung der stressenden Person-Umwelt-Beziehung oder die Kontrolle der emotionalen Reaktion, die aus dieser Beziehung entsteht. Die erste Funktion ist problemlösungsorientiert und nimmt einen Großteil der Bewältigung ein. Sie hat zum Ziel, die Bedrohung verschwinden zu lassen oder die Herausforderung zu bewältigen. Die zweite Funktion ist Emotionsregulierung oder Selbstberuhigung. Hierbei wird versucht, die aus der gestörte Transaktion resultierende emotionale Belastung abzumildern (vgl. Lyon 2005, 35). Dies ist wichtig, da Stressemotionen, wie Angst, Schuld, Ärger, Traurigkeit etc., schmerzlich oder quälend sind und zu Ablenkung oder selektiver Aufmerksamkeit führen können. Außerdem kann eine schwerwiegende und dauerhafte Störung eine körperliche Erkrankung zur Folge haben. Es macht wenig Sinn für eine Person, „allein im Interesse psychologischen Überlebens zu handeln, um dann dabei physiologisch zusammzubrechen“ (Lazarus/Launier 1981, 250) – ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Interessen muss gefunden werden. Neben diesen beiden hauptsächlichen Bewältigungsfunktionen gibt es weitere, z.B. das Tolerieren oder Ertragen von affektivem Distress, um handlungsfähig zu bleiben oder die Aufrechterhaltung einer positiven Lebensmoral, beispielsweise bei einer schweren unabwendbaren Krankheit (vgl. insg. ebd., 248-251).
Die zeitliche Orientierung spielt eine Rolle für die Bewertung und den thematischen Charakter des Bewältigungsprozesses: Eine vorangegange oder gegenwärtige Schädigung bzw. ein Verlust muss „überwunden, toleriert, durch Erholung ausgeglichen oder im gegenwärtigen Situationszusammenhang neu interpretiert werden“ (ebd., 247). Bei einer zukünftigen potenziellen Schädigung (Bedrohung, Herausforderung) versucht man, sie abzuwehren oder zumindest den Status quo aufrechtzuerhalten. Bewertet man zukunftsbezogenen Stress als Herausforderung, setzt man sich zwar einer potenziellen Schädigung aus; „dies erfolgt aber mit einer mehr positiven als negativen Einstellung und ist genau dann der Fall, wenn man entwicklungsorientiert ist“ (ebd.), wie es z.B. ein Jugendlicher ist, der von der sicheren Eltern-Kind-Beziehung wegstrebt (vgl. insg. ebd., 245-247).
Unabhängig vom instrumentellen Schwerpunkt, von Funktion und zeitlicher Orientierung der Bewältigung gibt es vier Bewältigungsformen: Informationssuche, direkte Aktion, Aktionshemmung und intrapsychische Formen. Die Informationssuche dient als Grundlage für eine Handlung zur Änderung der Transaktion, kann aber auch das Wohlbefinden der Person steigern, indem sie die Transaktion als besser kontrollierbar erscheinen lässt. Weiterhin kann versucht werden, die Situation durch eine direkte Aktion, aber auch durch Aktionshemmung zu bewältigen. Bei einer Unterdrückung von Aktion versuchen wir, im Einklang mit situativen und intrapsychischen Gegebenheiten zu bleiben, da die komplexe soziale und intrapsychische Welt tatsächliche oder moralische Zwänge und Gefahren mit sich bringt. Intrapsychische Prozesse meinen all das, was eine Person zu sich selbst sagt, und alle Formen der Aufmerksamkeitslenkung (vgl. insg. ebd., 252-253).
Neuerungen und Kritik am transaktionalen Stressmodell von Lazarus et al.
Bereits Ende der 1970er sprechen Lazarus und Launier (vgl. 1981, 234; Orig.: 1978) davon, dass ihre Theorie nicht nur eine Theorie des kognitiven Stress, sondern auch eine allgemeine kognitive Theorie der Emotion ist. Sie folgern dies daraus, dass ihr Modell solch komplexe – wahrscheinlich aber alltägliche – Bewertungen einschließt, wie den Übergang einer günstigen Bewertung in eine bedrohliche, weil man fürchtet, eine günstige Bedingung ist zeitlich begrenzt oder deren Aufrechterhaltung erfordert Anstrengungen (vgl. ebd.). Außerdem sei Stress nur eine Unterkategorie von Emotion, welche auch positive Transaktionen, Bewertungen und Emotionen wie Freude, Ehre, Liebe und Erleichterung einschließe (vgl. Lazarus/Folkman 1987, 142). Die sich hieraus ergebende Komplexität und die daraus folgernde Kritik wird bei Schwarzer (2000, 17) zusammengefasst:
„Es handelt sich hier auch um eine psychologisch-philosophische Sicht des Lebens überhaupt, und gerade die ihr immanente Komplexität und Dynamik sind oft kritisiert worden, nicht zuletzt wegen den sich daraus ergebenden Schwächen für die Operationalisierung und für die empirische Prüfung ... es [gibt] kaum empirische Arbeiten ..., die eine zuverlässige Quantifizierung von Appraisals und Coping vorgenommen und allgemeingültige Resultate erbracht haben. Erst sehr spät sind die Hassles und Uplifts-Skala (Lazarus & Folkman, 1989) und die Ways of Coping-Skala (Folkman & Lazarus, 1988) veröffentlicht worden, und bis heute gibt es nur einen vorläufigen, dürftigen Versuch, die Appraisals, also das Kernstück der Theorie, zu operationalisieren (Lazarus, 1991, S. 447f.).“
Allerdings hat dies auch gute Gründe, denn einerseits sind Kognitionen und Emotionen von Situation zu Situation unterschiedlich, andererseits gibt es überdauernde individuelle Unterschiede in den Bewertungen, die Lazarus appraisal styles nennt (s.o.). Deren empirische Trennung von den entsprechenden Emotionen scheint nicht möglich zu sein. Lazarus ist davon überzeugt, dass vereinfachte Messinstrumente das Abbild der komplexen Realität verfälschen würden (vgl. insg. Schwarzer 2000, 17-18).
Sozial-kognitive Theorie nach Bandura – Das Konstrukt Selbstwirksamkeit
Mit der sozial-kognitiven Theorie erweitert Albert Bandura 1977 die soziale Lerntheorie, indem er eine wechselseitige Beziehung zwischen Umwelt und Verhalten annimmt. Banduras Theorie ist einzuordnen als kognitive Lerntheorie, die Persönlichkeits- und Stresstheorie verbindet. Sie will erklären, wie sich menschliche Kognitionen, Handlungen, Motivationen und Emotionen gegenseitig beeinflussen. Nach ihr schafft der Mensch die kognitive Basis für die Selbststeuerung oder Kontrolle seines Verhaltens, indem er sich der Fähigkeit zur Selbstreflexion seiner Gedanken, Erfahrungen und Verhaltensweisen bedient. Das Konstrukt Selbstwirksamkeit entstammt dieser Theorie. Sein Grad hängt ab von der Überzeugung, ein bestimmtes Verhalten so ausführen zu können, dass es zum gewünschten Ergebnis führt (Wirksamkeitserwartungen) und von der Überzeugung hinsichtlich der Sicherheit, mit der ein bestimmtes, korrekt durchgeführtes Verhalten das erwünschte Ergebnis zur Folge hat (Ergebniserwartungen; vgl. &Abb. 2; vgl. insg. Siela/Wieseke 2005, 552-553).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sowohl Lazarus und Folkman (1984) als auch Bandura (1997, beide aufgeführt nach Siela/Wieseke 2005, 556) sehen einen Zusammenhang zwischen ihren Konzepten: Nach Ban-
dura kommt es zu Stressreaktionen, wenn das Gefühl der Selbstwirksamkeit bezüglich der Kontrolle von Bedrohungen und belastenden Umweltanforderungen nur schwach ausgeprägt ist: „Sind Menschen überzeugt, ihre Umwelt nicht kontrollieren zu können, geraten sie unter Stress und sind nicht in der Lage, geeignete [Bewältigungs-]Maßnahmen zu ergreifen“ (Siela/Wieseke 2005, 556). Lazarus und Folkman verstehen Wirksamkeitserwartungen als Bestandteile der Sekundärbewertung. Das Selbstwirksamkeitskonzept überschneidet sich mit den Bestandteilen situative Bewertung (die von Fall zu Fall unterschiedliche Bewertung in Abgrenzung zu den appraisal styles), Bewältigungspotenzial und Zukunftserwartungen des Bewertungsprozesses. Liegt das Erreichen eines Ergebnisses in der Kontrolle der Person, empfiehlt sich eine problemlösungszentrierte Bewältigungsform, während eine eher emotionsorientierte Bewältigung angebracht ist, falls das Ergebnis als nicht kontrollierbar wahrgenommen wird (vgl. insg. Siela/Wieseke 2005, 556-557; Lazarus/Folkman 1987, 148).
Mit beruflicher Selbstwirksamkeitserwartung ist gemeint, dass man einschätzt, über jene Leistungsvoraussetzungen zu verfügen, die im Beruf notwendig sind. Nach Bandura ist eine hohe Kompetenzattribuierung für das Wohlbefinden wichtig. Für Lehrer stellt eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung somit eine wichtige Ressource dar (vgl. insg. Ebner/Zimmermann 2006, 190).
Modell der Erhaltung von Ressourcen nach Hobfoll
Auch das Ressourcenmodell nach Hobfoll (1988, aufgeführt nach Kramis-Aebischer 1995, 38 u.a.) entspricht einem kognitiv-transaktionalen Ansatz. Es befasst sich weniger mit den Bewältigungshandlungen und -kognitionen als mit den Bewältigungsmitteln bzw. -ressourcen. Hobfoll geht davon aus, dass das Vermeiden von Verlust ein stärkeres Motiv darstellt als das Streben nach Gewinn. Das Erleben von Verlust wird daher als zentrale Eigenschaft von Stress genannt – und nicht Herausforderung, Bedrohung oder Schädigung, wie im Stressmodell von Lazarus et al. Stress ist nach Hobfoll gegeben, „wenn jemand auf eine Situation reagiert, in der der Verlust von Ressourcen droht, dieser Verlust eingetreten ist oder wenn keine Gewinne eintreten, nachdem man zuvor Ressourcen dafür investiert hat“ (Schwarzer 2000, 21). Zu den Ressourcen zählt Hobfoll Gegenstände (die Sicherheit bieten, wie Nahrungsmittel, Kleidung, Wertsachen), Bedingungen (nichtmaterielle Ressourcen wie berufliches Fortkommen, Partnerschaft, Beamtenstatus), Persönlichkeitsmerkmale (stabile Fähigkeiten und persönliche Überzeugungen wie Intelligenz, Geschick, Optimismus, Zuneigung, Wertschätzung) und Energien (die Zugang zu anderen Ressourcen vermitteln können, wie Zeit, Wissen, Geld; vgl. insg. Kramis-Aebischer 1995, 38, Schwarzer 2000, 19-20 und Badura/Pfaff 1989, 646).
Aus diesen grundlegenden Annahmen ergeben sich nach Hobfoll vier Ableitungen (vgl. Schwarzer 2000, 20-21):
- Ressourcen sind nicht zufällig verteilt, sondern Menschen spielen eine aktive Rolle darin, über welche Ressourcen sie verfügen und wie sie diese zum Einsatz bringen.
- Wer über mehrere, gute Ressourcen verfügt, ist gegenüber Schwierigkeiten besser gewappnet und investiert mehr; wem dagegen Ressourcen fehlen, ist gegenüber stressreichen Ereignissen verwundbarer.
- Bewältigung verursacht Kosten, da Ressourcen zur Sicherung anderer Ressourcen gebraucht werden (z.B. Zeit und Wertschätzung zum Erhalt einer Partnerschaft).
- Gewinn oder Verlust von Ressourcen kann kumulieren und negative oder positive Spiralen erzeugen.
Die Ressourcentheorie hat vor allem den Vorteil, sparsam und gut überprüfbar zu sein, da Ressourcen die einzige zu messende Einheit darstellen, um Stress erklären zu können. Hierdurch wird versucht, der Verwobenheit von Person und Umwelt auszuweichen. Nach Hobfoll wollen Menschen vor allem das Wachstum maximieren, indem sie Ressourcen wiederherstellen, schützen und aufbauen. Aus einer Wechselwirkung von Ressourcen, Bedürfnissen, Belastungen, Werten, Zeit und Wahrnehmungen ergibt sich eine mehr oder weniger gelungene Passung zwischen den Umweltanforderungen und den individuellen Reaktionen. Wie man mit Stress umgeht, hängt vom Grad dieser Passung innerhalb eines bestimmten ökologischen Kontextes ab. Ressourcenverluste und die individuellen Antworten darauf stellen laut Hobfoll Meilensteine in der Entwicklung der Persönlichkeit dar und können zu besonderen Verwundbarkeiten, aber auch zum Aufbau bestimmter Widerstandskräfte führen (vgl. insg. Schwarzer 2000, 21)
Salutogenese und Kohärenzgefühl nach Antonovsky
Auch das kognitive Salutogenese-Modell von Antonovsky (1979 und 1987, aufgeführt nach Horsburgh 2005) kann Hinweise darauf liefern, unter welchen Umständen ein Mensch weniger leicht unter Stress gerät und gesund bleibt. Das Modell ist zu umfangreich, um es hier vollständig darzulegen, daher wird eine Beschränkung auf die wichtigsten Konzepte vorgenommen: Es waren unter anderem die Arbeiten von Selye (1956) und eine Stichprobe von Frauen, die nationalsozialistische Konzentrationslager überlebt und von denen dennoch über ein Viertel eine relativ stabile körperliche und emotionale Gesundheit bewahrt hatten, die Antonovsky beeinflussten, darüber nachzudenken, welche Merkmale und Ressourcen bei der Erhaltung der Gesundheit helfen.
Er schuf den Begriff der Salutogenese (in etwa ‚Gesundheitsentstehung‘) als Gegenbegriff zur Pathogenese und führte das dem Modell zentrale Konzept des Kohärenzgefühls ein. Kohärenz ist in diesem Zusammenhang eine globale Orientierung, die ausdrückt, wie ausgeprägt nachhaltig und doch dynamisch das Vertrauen einer Person darauf ist, dass (1) die Reize, die sich im Laufe des Lebens aus der inneren und äußeren Umwelt ergeben, vorhersehbar und erklärbar sind (Verstehbarkeit), dass (2) Ressourcen verfügbar sind, den Anforderungen, die sich aus diesen Reizen ergeben, zu begegnen (Handhabbarkeit) und dass (3) diese Anforderungen Herausforderungen darstellen, die Einsatz und Engagement lohnen (Sinnhaftigkeit). Das Kohärenzgefühl ist nach Antonovsky die wichtigste Bestimmungsgröße, um zu lokalisieren, wo sich eine Person auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum befindet. Kohärenz bewirkt eine optimistische Einstellung hinsichtlich der Wirksamkeit des eigenen Handelns und positiver Sinnorientierungen. Generalisierte Widerstandsressourcen (GWR) nehmen auf die Entwicklung des Kohärenzgefühls Einfluss: Eine GWR ist „jede Eigenschaft einer Person, einer Gruppe oder eines Umfelds, die zum erfolgreichen Umgang mit Spannung beitragen kann“ (Antonovsky 1979, 99, aufgeführt nach Horsburgh 2005, 213). Es werden 12 GWRs unterschieden, u.a. materielle Ressourcen, Wissen und Intelligenz, Bewältigungsstrategien, sozialer Rückhalt, kulturelle Stabilität und Gesundheitszustand. Mit Bewältigungsstrategien sind in diesem Zusammenhang rationale, flexible und vorausschauende Handlungspläne gemeint. Bewältigungsverhalten meint hingegen die Handlungen, die unternommen werden, um mit Stress zurechtzukommen (vgl. insg. Horsburgh 2005, 209-215 und Schmid 2003, 58-64).
Nach Antonovsky wird die Forschung nach individuellen, sozialen und organisationalen Ressourcen als zentrale Aufgabe aufgefasst. Mit diesem strukturorientierten Ansatz ist „eine umfassende Forschungsrichtung gelungen, die sich nicht lediglich auf Teilkonstrukte stützt, wie z.B. auf belastende Lebensereignisse (stressful life events) oder einer pathogenetischen Forschungstradition“ (Schmid 2003, 58). Die GWR weisen Ähnlichkeiten mit den Ressourcen nach Hobfoll auf, andererseits erinnert das Konzept des Kohärenzgefühls auch an Banduras Selbstwirksamkeit-Konstrukt.
2.3 Burnout und (Über-)Belastung
Basiskonzept
Burnout ist in der Internationalen statistischen Klassifikation der Erkrankungen (ICD-10; vgl. DIMDI 2007) nicht als Syndrom, wie es häufig in der Literatur genannt wird, sondern lediglich als gesundheitsbeeinflussender Faktor unter dem Diagnoseschlüssel Z73 als „Ausgebranntsein [Burn out]“ aufgeführt. Aus Gründen der Konformität wird hier jedoch auch vom Burnout-Syndrom gesprochen.
Wie bereits in der Einleitung (&Kapitel 1) dargelegt, existierte das Phänomen Burnout schon lange vor dem Erscheinen des Artikels Staff-Burn-Out von Herbert J. Freudenberger im Jahre 1974. Mit diesem Artikel wurde allerdings der Grundstein für die wissenschaftliche Burnout-Diskussion gelegt, die zunächst vorwiegend in den USA stattfand. Eine allgemein anerkannte Definition des Begriffs besteht bis heute nicht (vgl. van Dick 1999, 63), doch formulieren Schaufeli und Enzmann (1998, 36, aufgeführt nach Schmitz 2004a, 52) in ihrer Meta-Analyse eine Arbeitsdefinition, die einen guten Überblick bietet:
„Burnout ist ein andauernder negativer, arbeitsbezogener psychischer Zustand ‚normaler‘ Personen, der primär durch Erschöpfung gekennzeichnet ist und von Überforderung (distress), dem Gefühl verminderter Wirksamkeit, abnehmender Motivation sowie der Entwicklung dysfunktionaler Einstellungen und Verhaltensweisen begleitet wird. Dieser psychische Zustand entwickelt sich langsam, kann aber von den Betroffenen lange unbemerkt bleiben. Er resultiert aus einem Missverhältnis (misfit) von Intentionen und der Arbeitswirklichkeit. Oft wird er durch inadäquate Bewältigungsstrategien aufrechterhalten.“
Mittlerweile ist der Geltungsbereich von Burnout auf alle Berufe erweitert worden (vgl. Schmitz 2004a, 52). Bis in die 1990er Jahre wurde jedoch davon ausgegangen, dass Burnout fast nur in sozialen Dienstleistungsberufen vorkommt. So spricht Barth (1992, 16) über die in Deutschland zunehmende Diskussion „über das Ausbrennen als eine Gefahr der Sozialberufe“. Von allen Berufen wurde in der Literatur bis 1990 der Lehrerberuf am häufigsten im Zusammenhang mit Burnout genannt (vgl. Kleiber/Enzmann 1990, 17, aufgeführt nach Kramis-Aebischer 1995, 43): Lehrer stehen in der Öffentlichkeit und haben sich den ständig steigenden Ansprüchen ihrer Klienten anzupassen. Gleichzeitig steigt der Belastungsdruck durch neue Aufgaben und veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen (vgl. Schmitz 2004a, 52). Bevor jedoch die speziellen Anforderungen an Lehrer erläutert werden (&Kapitel 3), folgen zunächst kurze Darstellungen verschiedener Herangehensweisen an das Burnout-Syndrom.
Herbert J. Freudenberger – Ermüdung durch Routine
Der Psychoanalytiker Freudenberger (1974) beobachtete bei sich und anderen ehrenamtlich Tätigen in einer alternativen Selbsthilfe- und Kriseninterventionseinrichtung Tendenzen wie Ermüdung und Langeweile durch Routine, die er burn-out nannte. Dementsprechend ordnete er Burnout „vor allem Menschen mit starken Grundsätzen, hoher Anstrengungsbereitschaft und mit hohen Erwartungen an sich und andere“ (Schmid 2003, 25) zu. In späteren Werken weitet er den Begriff von sozialen auf allgemeine Berufstätigkeiten aus (vgl. insg. ebd.).
Christina Maslach – Maslach Burnout Inventory
Auch Maslach definierte 1980 Burnout zunächst „als ein Phänomen, das (nur) bei langfristig und engagiert in Sozialberufen tätigen Personen auftritt“ (Hillert 2004, 96). Sie versuchte, Burnout anhand der drei Dimensionen emotionale Erschöpfung, reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit und Depersonalisation zu operationalisieren und entwickelte das Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach/Jackson 1981, aufgeführt nach Schmid 2003, 27), das aus 22 (beziehungsweise in einer erweiterten Version aus 25) Items besteht, um Burnout zu erfassen (vgl. Schmid 2003, 27 und Hillert 2004, 96). Mit Depersonalisation ist hier jedoch nicht der psychopathische Begriff (Depersonalisierungssyndrom nach ICD-10; F48) gemeint, sondern eine „unpersönliche, entmenschlichende Wahrnehmung der Rezipienten“ (Schmitz 2004a, 53). Daher ist der Begriff Dehumanisierung passender (vgl. ebd.). Die Items sind den drei Dimensionen zugeordnet und anhand einer 5-Punkte-Skala zu bewerten. Wird in allen Dimensionen eine hohe Punktzahl erreicht, gilt die entsprechende Person als ausgebrannt. Vom MBI existieren in mehreren Sprachen an bestimmte Berufe angepasste Versionen (vgl. van Dick 2000, 64) – hier einige Items aus einem für den Lehrerberuf bestimmten Fragebogen (Hillert 2004, 96):
Emotionale Erschöpfung
- »Ich fühle mich durch meine Arbeit ausgebrannt.«
- »Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich verbraucht.«
Reduzierte Leistungsfähigkeit
- »Ich habe ein unbehagliches Gefühl wegen der Art und Weise, wie ich manche Schüler behandelt habe.«
Dehumanisierung
- »Es ist mir eigentlich egal, was aus manchen Schülern wird.«
- »Seit ich diese Arbeit mache, bin ich gefühlloser im Umgang mit den Schülern geworden.«
Das MBI ist das am weitesten verbreitete Instrument, um Burnout zu messen (vgl. Schmid 2003, 27-28). Es liegt ca. 90% aller international publizierten Burnoutstudien zugrunde (vgl. Schmitz 2004a, 53). Kritisch angemerkt sei jedoch, dass Maslachs Burnout-Konzept, wie Schmid (vgl. 2003, 27) darlegt, nicht aus empirischen Daten gewonnen wurde, sondern auf bereits vorliegenden Theorien aufbaut.
Cary Cherniss – Transaktion und Bedeutsamkeit
Der US-amerikanische Forscher Cherniss bezieht gesellschaftliche und kulturelle Faktoren in seine Modellformulierungen ein. Er nennt seine Burnout-Definition, die aus drei ineinandergehenden Stadien besteht, analog zur Stresstheorie von Lazarus et. al transaktional (vgl. &Abb. 3; vgl. Schmid 2003, 28 und Barth 2001, 70).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im ersten Stadium wird Stress als Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen empfunden. Diese können sowohl von außen (extern) an eine Person gestellt werden, als auch von der Person selbst ausgehen (intern). Im zweiten Stadium folgen kurzfristige emotionale Antworten wie Gefühle der Angst, Anspannung, Müdigkeit und Erschöpfung. Schließlich gibt es im letzten Stadium einen Einstellungswandel und es erfolgen Verhaltensveränderungen, wie „die Tendenz, Schüler (Klienten) in einer sehr distanzierten, unverbindlichen und mechanistischen, eventuell auch zynischen Art und Weise zu behandeln“ (Barth 1991, 84)[5]. Burnout ist nach Cherniss das Ergebnis eines transaktionalen Prozesses, der durch Stressoren, Stressreaktionen und Bewältigungsstrategien in Gang kommt und bei dem ineffektiv mit Stress umgegangen wird (vgl. insg. ebd., 83-85).
Cherniss und Krantz (1983, aufgeführt nach Schmid 2003, 30) finden jedoch auch ein wirksames Gegenmittel gegen Burnout: Bei einem Besuch in einem katholischen Orden, der eine stationäre Einrichtung für geistig behinderte Menschen führt, sowie bei engagierten Pädagogen einer Montessori-Schule entdecken sie, dass, obwohl die Arbeit viel Zeit und Geduld beansprucht und Rollenambiguitäten beinhaltet, kein Ausbrennen stattfindet. Die Autoren sind daher der Meinung, dass in i deologisch geprägten Gemeinschaften bzw. dort, wo ein Sinn- und Bedeutungsrahmen für die eigene Tätigkeit wahrgenommen wird, Stress nicht zu Burnout führt. Sie bedauern, dass es in den meisten Schulen keine ideologische Gemeinschaft gäbe und dadurch die einzelnen Personen keine konsistente moralische Unterstützung ihrer Arbeit erfahren würden (vgl. insg. Schmid 2003, 30-31).
[...]
[1] Herzerkrankungen sind ebenfalls in vielen Fällen die Folge von Stress, was schon Selye feststellte (vgl. Schwarzer 1987, 36).
[2] Ein Sabbatical (Sabbatjahr) ist eine drei- bis zwölfmonatige Auszeit vom Beruf, die oft für Weltreisen, die Betreuung von Kindern und Verwandten oder Mitarbeit am Eigenheim genutzt wird. Personen berichten, dass sie nach ihrem Sabbatical gelassener und klarer auf die Arbeitsabläufe um sich herum blicken und schneller Entscheidungen treffen können (vgl. Götting 2008).
[3] Beim Downshifting wird eine finanziell attraktive, aber stresserfüllte Karriere gegen eine weniger anstrengende, aber mehr erfüllende Lebensweise mit geringerem Einkommen getauscht (vgl. Jahn 2006).
[4] Vgl. z.B. Stern.de 2003, Ärzte Zeitung 2006, Finetti 2006.
[5] Barth (1991, 84) merkt hierbei Gemeinsamkeiten mit den drei Phasen des Allgemeinen Adaptionssyndroms nach Selye an (Alarm-, Widerstands- und Erschöpfungsphase).
- Quote paper
- Tobias Nahrwold (Author), 2008, Prävention von Burnout bei Lehrerinnen und Lehrern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117947