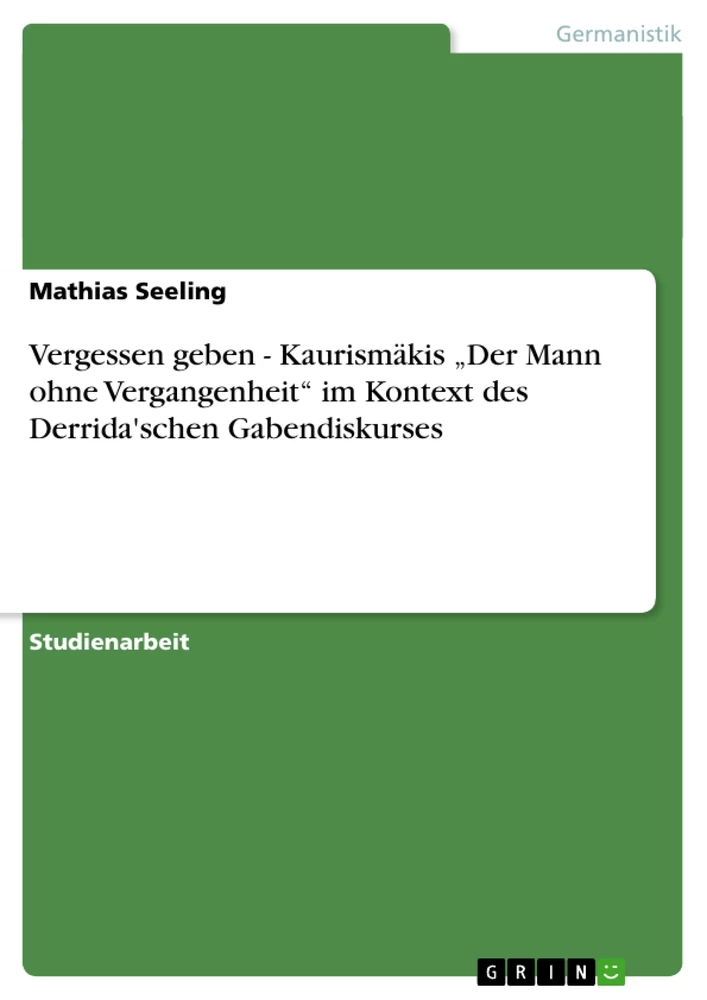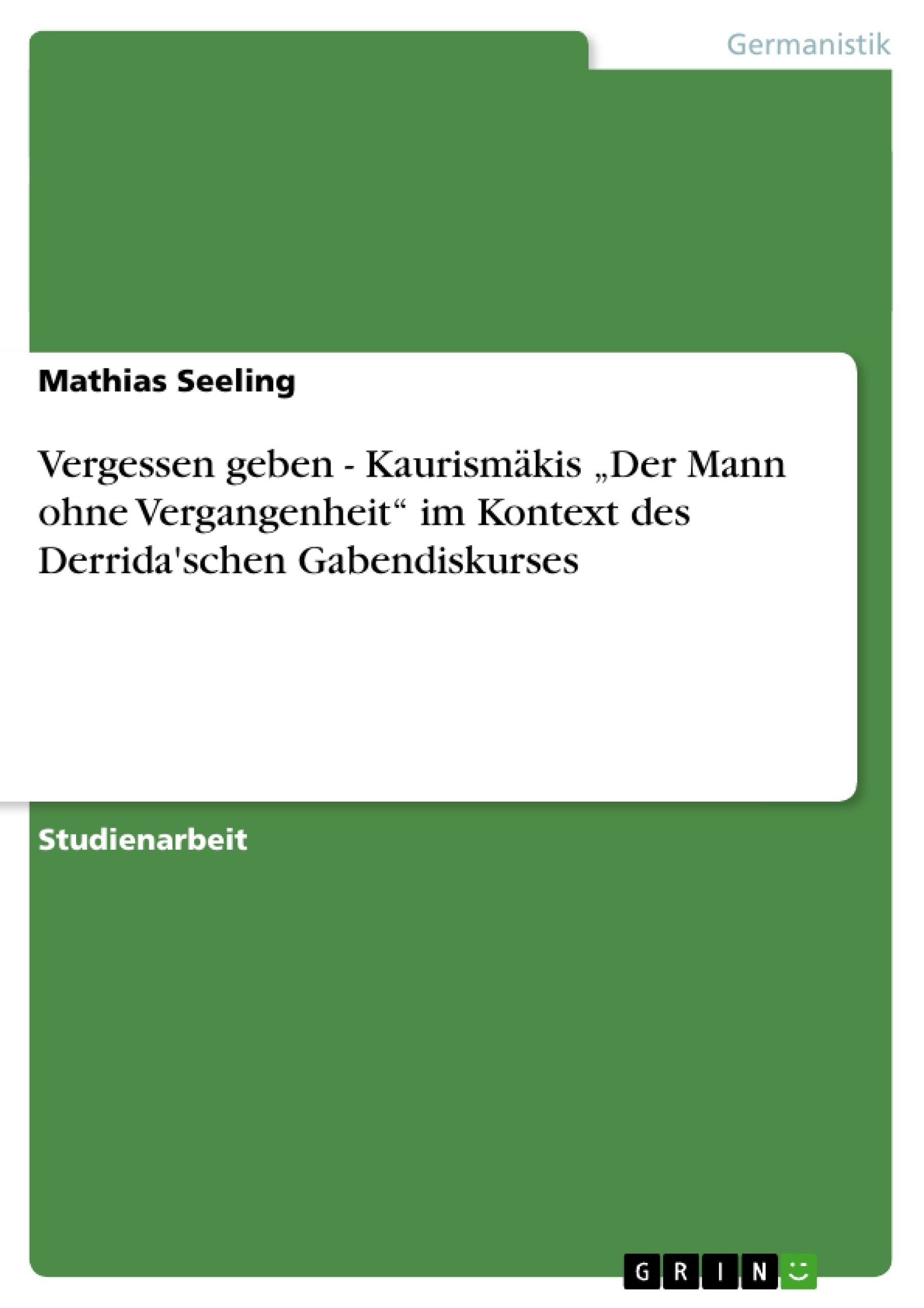Mit der „Möglichkeit des Unmöglichen“ wird nun, nachdem die Soziologie Jahrzehnte lang die
Tausch- und Gabeereignisse in verschiedenen Kulturen beschrieben hat, die semantische Seite der
Gabe und des Gebens geöffnet und betrachtet. Jacques Derrida spielt in diesem Kontext eine
entscheidende Rolle in der postmodernen Philosophie, fordert und fördert neue Denkprozesse. Die
Kernfrage, die sich Derrida stellt lautet: Gibt es Gabe? Diese Frage soll in dieser Arbeit auch im
Film „Der Mann ohne Vergangenheit“ von Aki Kaurismäki gestellt werden. Dabei geht er
formalistischen und strukturalistischen Ansätzen nach, indem er den Begriff der Gabe einerseits aus
ökonomischen Aspekten, andererseits jedoch auch aus linguistischen Erkenntnissen her konstruiert.
Die Gefahr der Formalisierung des Gabeereignisses in der Hinsicht, dass es sich jeden Augenblick
selbst zerstören und zu einem bloßen Tauschakt werden könnte, zeigt die Polemik des
Gabendiskurses, der Derrida entschieden und mit einem Komplex von Fragen nachgeht. Kann man
geben, ohne zurückzugeben? Kann man schenken, ohne sich im ökonomischen Kreislauf von
Tausch, Verpflichtung und Schuld zu verstricken? Kann man „sich geben“?
Besonders im Film sind zwei Extrema zu erkennen: die der gesellschaftlichen Tauschökonomie, in
der es vorrangig um Profit, Kapitale und Chancen geht und zum Anderen die reine
zwischenmenschliche Ökonomie, die mit Gesten, Zusprüchen, Geschenken „handelt“. Zwar begibt
sich Derrida bei dem Versuch, diese Fragen zu klären, immer wieder auf einen gedanklichen
Spießrutenlauf durch die unlogische Logik der Paradoxien, zeigt aber gerade dadurch, dass man mit
einem anderen Denken neue Erkenntnisse gewinnen kann. Er fordert eine klare Abgrenzung der
Gabe vom ökonomischen Kreislauf, aber gleichzeitig sieht er die Integration (wenn auch nicht
statisch) der Gabe im selben System. Diese Abspaltung soll sich im Folgenden vor allem an der
Grenze von Gesellschaft und Rand-gesellschaft zeigen. Sind diese, von der Gesellschaft
ausgeschlossenen Menschen tatsächlich absolut davon differenziert? Wie verhält es sich dann mit
denjenigen, die freiwillig und ohne jede Rückforderung eben genau für diese Menschen aufopfern?
Die Grenzen sind hier sicherlich verschwommen, teilweise jedoch auch klar zu erkennen. In einer
ökonomiefixierten Gesellschaft, wie sie sich heute immer mehr etabliert, muss man sich fragen,
welche Opfer man dafür bringen kann und welche Werte dadurch verloren gehen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Allgemeines
- 2 Zur Gabe-Philosophie Derridas - das Paradox der Unmöglichkeit der Gabe
- 2.1 Dissemination des Gebens und Nehmens
- 2.2 Dimensionen des Gebens
- 2.3 Äquivalenz und Ambivalenz im Gabe-Ereignis
- 2.4 „es gibt“-sprachliche Eigenarten und ihre Paradoxien
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jacques Derridas Gabe-Philosophie im Kontext von Aki Kaurismäkis Film „Der Mann ohne Vergangenheit“. Die zentrale Frage ist, ob eine „reine“ Gabe, losgelöst von ökonomischen Tauschprozessen, überhaupt möglich ist. Der Film dient als Fallbeispiel zur Analyse der Paradoxien des Gebens und Nehmens.
- Derridas Konzept der Gabe und seine Paradoxien
- Die Ambivalenz von Gabe und Tausch in gesellschaftlichen Beziehungen
- Die Darstellung von Gabe und Tausch im Film „Der Mann ohne Vergangenheit“
- Die Grenzen zwischen Gesellschaft und Randgesellschaft im Kontext des Gebens
- Ökonomische und zwischenmenschliche Ökonomien im Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Möglichkeit einer „reinen“ Gabe im Kontext von Derridas Philosophie und Kaurismäkis Film „Der Mann ohne Vergangenheit“. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der sowohl ökonomische als auch linguistische Aspekte des Gebens beleuchtet, und hebt die Paradoxien des Gabendiskurses hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse expliziter Szenen im Film, die die Thematik des Gebens und Nehmens repräsentieren, und positioniert sich als distanzierte Betrachtung sozialer und filmstilistischer Momente im Lichte von Derridas Philosophie, wobei insbesondere die Arbeit von Bernhard Waldenfels herangezogen wird.
1 Allgemeines: Dieses Kapitel führt die Leitthese von Bernhard Waldenfels ein, die das Paradox der Gabe durch deren gleichzeitiges Erscheinen und Nichterscheinen beschreibt. Waldenfels postuliert einen „ungeschriebenen Vertrag“ zwischen kommunizierenden Subjekten als Voraussetzung für die Gabe. Der Film „Der Mann ohne Vergangenheit“ wird als Beispiel herangezogen, um die ökonomische Bedingtheit produktiver Prozesse zwischen Subjekten aufzuzeigen. Derrida's ternäre Struktur der Gabe wird vorgestellt und die Gefahr ihrer Reduktion auf einen bloßen Tausch wird diskutiert. Derrida's Kritik an Marcel Mauss' Verständnis des Gabeereignisses wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Gabe, Tausch, Derrida, Kaurismäki, „Der Mann ohne Vergangenheit“, Paradox, Ökonomie, Gesellschaft, Randgesellschaft, zwischenmenschliche Beziehungen, Waldenfels.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Jacques Derridas Gabe-Philosophie in Aki Kaurismäkis "Der Mann ohne Vergangenheit"
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Jacques Derridas Gabe-Philosophie anhand von Aki Kaurismäkis Film "Der Mann ohne Vergangenheit". Die Hauptfrage ist, ob eine "reine" Gabe, unabhängig von ökonomischen Tauschprozessen, überhaupt möglich ist.
Welche Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse beleuchtet sowohl ökonomische als auch linguistische Aspekte des Gebens und untersucht die Paradoxien des Gabendiskurses. Sie konzentriert sich auf explizite Szenen im Film, die das Geben und Nehmen repräsentieren, und betrachtet soziale und filmstilistische Momente im Lichte von Derridas Philosophie, wobei die Arbeit von Bernhard Waldenfels miteinbezogen wird.
Welche Rolle spielt Bernhard Waldenfels in der Arbeit?
Waldenfels' Leitthese, die das Paradox der Gabe durch deren gleichzeitiges Erscheinen und Nichterscheinen beschreibt, wird im ersten Kapitel eingeführt. Seine Vorstellung eines "ungeschriebenen Vertrages" zwischen kommunizierenden Subjekten als Voraussetzung für die Gabe spielt eine wichtige Rolle.
Wie wird Derridas Gabe-Konzept dargestellt?
Die Arbeit präsentiert Derridas ternäre Struktur der Gabe und diskutiert die Gefahr ihrer Reduktion auf einen bloßen Tausch. Derridas Kritik an Marcel Mauss' Verständnis des Gabeereignisses wird ebenfalls behandelt.
Welche konkreten Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 1 behandelt allgemeine Aspekte der Gabe-Philosophie und die ökonomische Bedingtheit von Prozessen zwischen Subjekten. Weitere Kapitel (die im Inhaltsverzeichnis detailliert sind) befassen sich mit spezifischen Aspekten von Derridas Philosophie im Kontext des Films.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Gabe, Tausch, Derrida, Kaurismäki, "Der Mann ohne Vergangenheit", Paradox, Ökonomie, Gesellschaft, Randgesellschaft, zwischenmenschliche Beziehungen, Waldenfels.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Paradoxien des Gebens und Nehmens, die Ambivalenz von Gabe und Tausch in gesellschaftlichen Beziehungen und die Darstellung dieser Aspekte im Film "Der Mann ohne Vergangenheit". Sie beleuchtet die Grenzen zwischen Gesellschaft und Randgesellschaft im Kontext des Gebens und vergleicht ökonomische und zwischenmenschliche Ökonomien.
Wie wird der Film "Der Mann ohne Vergangenheit" in die Analyse einbezogen?
Der Film dient als Fallbeispiel zur Analyse der Paradoxien des Gebens und Nehmens. Die Arbeit analysiert explizite Szenen im Film, die die Thematik repräsentieren.
- Quote paper
- Mathias Seeling (Author), 2008, Vergessen geben - Kaurismäkis „Der Mann ohne Vergangenheit“ im Kontext des Derrida'schen Gabendiskurses, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117283