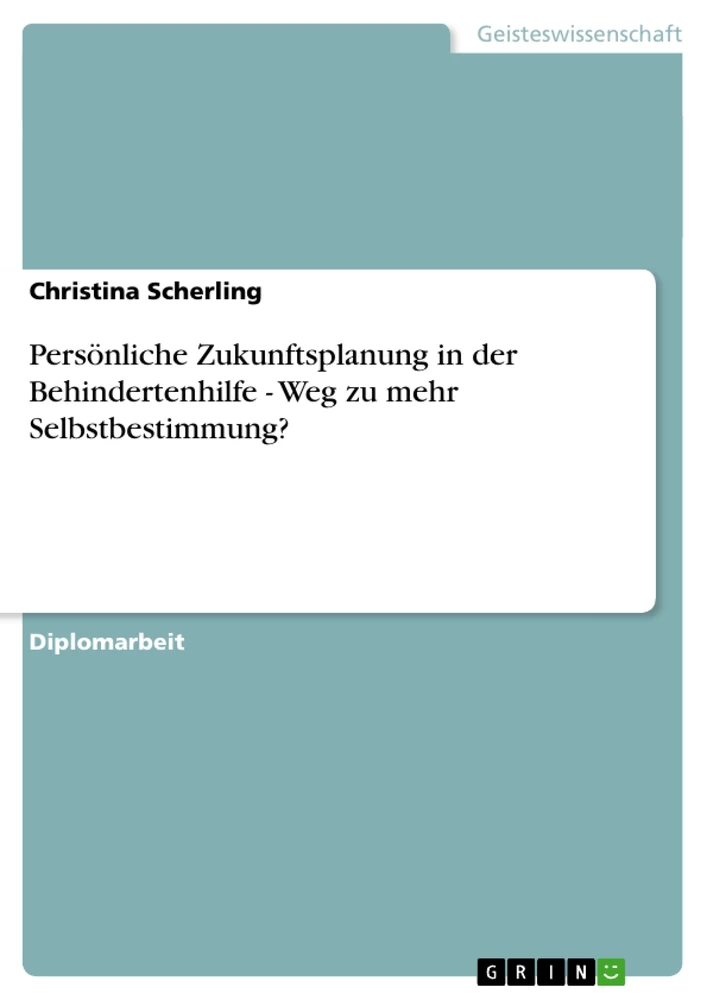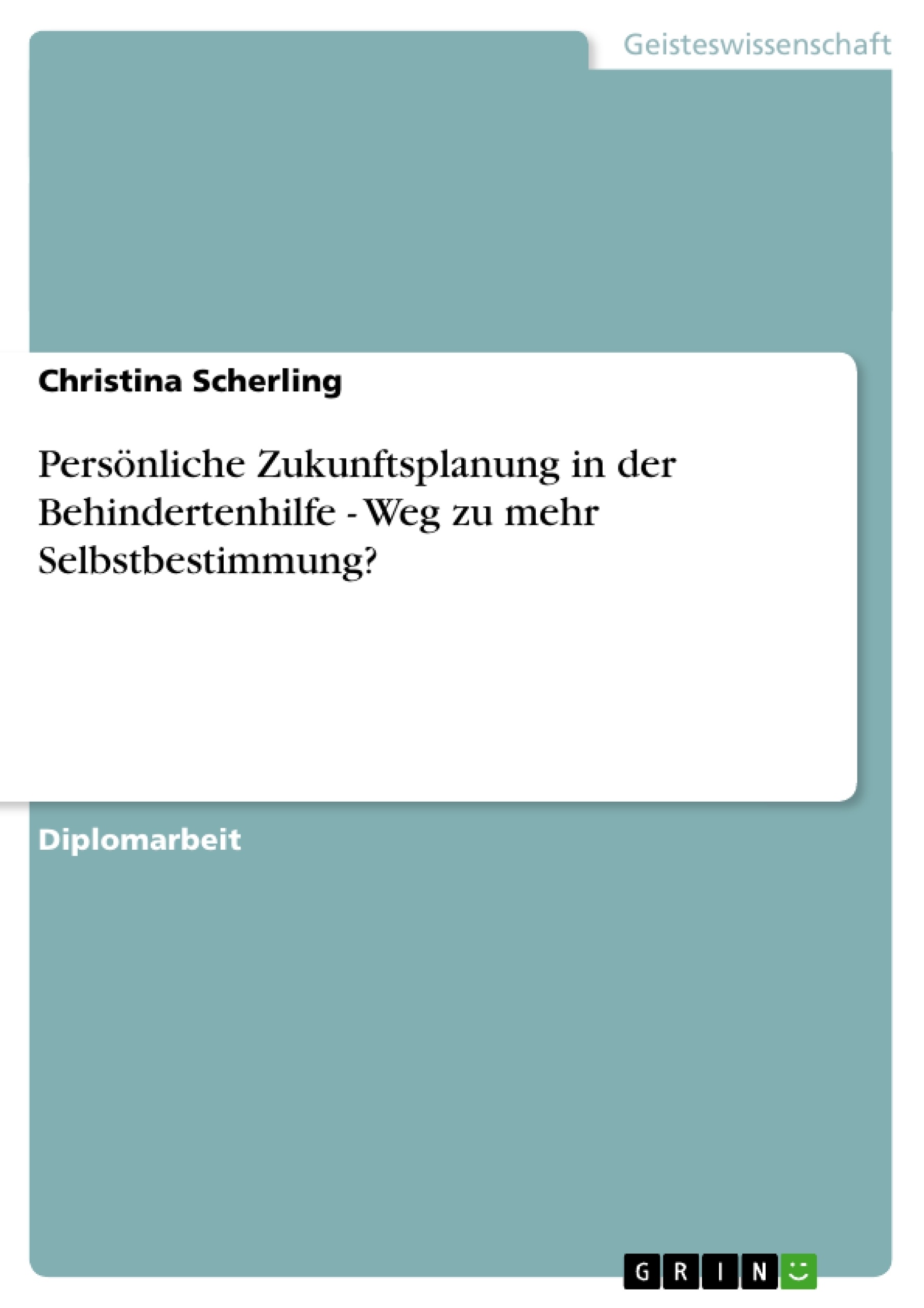Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem methodischen Ansatz der „Persön-lichen Zukunftsplanung“ im Kontext der Behindertenhilfe.
Dieser in den 80er Jahren in den USA entwickelte Ansatz, stellt eine Möglichkeit zur individuellen Lebensstilplanung dar und findet Anwendung in der Arbeit mit Menschen mit und ohne Behinderung. Im deutschsprachigen Raum ist dieser An-satz in der Behindertenhilfe im Allgemeinen zwar bekannt, jedoch stellt er noch keine gängige Praxis dar.
Einige wenige engagierte Menschen haben in den vergangenen Jahren die Durch-setzung der Persönlichen Zukunftsplanung vorangebracht. Aus diesen damals noch wenig koordinierten Durchführungsansätzen, entwickelte sich das Projekt „Zeit für Veränderungen“, dass durch das Netzwerk People First initiiert und durch-geführt wurde. Dieses Projekt diente als Aufklärungskampagne, um den Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung in Deutschland bekannt zu machen und erste Erfahrungen zu sammeln. Diese Kampagne und das Engagement der beteiligten Personen, haben dazu geführt, dass eine Reihe von Persönlichen Zukunftsplanungen durchgeführt wurde und der Ansatz in der Öffentlichkeit weiter Bekanntheit erlangte. Mittlerweile haben sich mehrere Autoren dieser Thematik gewidmet und zum Teil auch eigene Zukunftsplanungen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten durchgeführt. Auffällig bei der Betrachtung dieser verfügbaren Arbeiten ist, dass zumeinst ein wesentlicher Lebensbereich Grundlage der Planung darstellte - der Übergang von der Schule in das Berufsleben. Aus diesem Grund habe ich in meiner Arbeit diesen Lebensbereich weitgehend ausgeklammert und mich auf einen weiteren wesentlichen Lebensbereich konzentriert - das Wohnen von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
0. Einleitung
1. Begriffsbestimmung
1.1 Der Begriff Behinderung
1.1.1 Die medizinische Sichtweise
1.1.2 Die soziale Sichtweise
1.2 Verknüpfung der dargestellten Sichtweisen
1.3 Zum Verständnis de Begriffs geistige Behinderung
2. Selbstbestimmung kontra Fremdbestimmung
2.1 Was ist Fremdbestimmung?
2.2 Was ist Selbstbestimmung?
2.2.1 Recht auf Selbstbestimmung
2.3 Selbstbestimmung bei Menschen mit Lernschwierigkeiten
2.3.1 Bedeutung der Selbstbestimmung
2.4 Bedingungen der Selbstbestimmung
2.4.1 Selbstständigkeit im Kontext der Selbstbestimmung
3. Die Idee der Persönlichen Zukunftsplanung
3.1 Geschichtlicher Ursprung
3.2 Was ist die Persönliche Zukunftsplanung
3.3 Zugrunde liegendes Menschenbild
3.4 Kernelemente der Persönlichen Zukunftsplanung
3.5 Grundgedanken zur praktischen Umsetzung
3.6 An der Planung beteiligte Personen - Unterstützerkreise
3.6.1 Zusammensetzung des Unterstützerkreises
3.7 Roller der professionellen Helfer
3.8 Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung
4. Wohnen für Menschen mit Lernschwierigkeiten - Rückblick und Gegenwart
4.1 Zum Begriff des Wohnens
4.1.1 Bedeutung des Wohnens
4.2 Wohnformen
4.2.1 Wohnheime
4.2.2 Betreutes Wohnen
4.2.3 Wohnen in der eigenen Wohnung
4.3 Der Einfluss der Wohnform auf die Selbstbestimmung
5. Vergleich traditioneller Hilfeplanung und Persönlicher Zukunftsplanung im Bereich Wohnen
5.1 Komponenten der traditionellen Hilfeplanung
5.1.1 Auswirkungen auf die Selbstbestimmung
5.2 Komponenten der Persönlichen Zukunftsplanung
5.2.1 Auswirkungen auf die Selbstbestimmung
5.3 Fazit
6. Veränderungen in der Behindertenhilfe
6.1 Rechtliche Veränderungen
6.1.1 Das Persönliche Budget
6.2 Veränderungen in der Rolle der professionellen Helfer
6.2.1 Vom Betreuer zum Begleiter
6.3 Zusammenfassung
7. Resümee
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF
Abb. 2: Klassifikation des Schweregrades geistiger Behinderung
Abb. 3: Freundeskreis „Circle of Friends“
Abb. 4: Die wichtigsten Fragen einer „individuellen Landkarte“
Abb. 5: Der PATH-Prozess
Abb. 6: Bedürfnispyramide nach Maslow
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
0. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem methodischen Ansatz der „Persönlichen Zukunftsplanung“[1] im Kontext der Behindertenhilfe.
Dieser in den 80er Jahren in den USA entwickelte Ansatz, stellt eine Möglichkeit zur individuellen Lebensstilplanung dar und findet Anwendung in der Arbeit mit Menschen[2] mit und ohne Behinderung. Im deutschsprachigen Raum ist dieser Ansatz in der Behindertenhilfe im Allgemeinen zwar bekannt, jedoch stellt er noch keine gängige Praxis dar.
Einige wenige engagierte Menschen haben in den vergangenen Jahren die Durchsetzung der Persönlichen Zukunftsplanung vorangebracht. Aus diesen damals noch wenig koordinierten Durchführungsansätzen, entwickelte sich das Projekt „Zeit für Veränderungen“, dass durch das Netzwerk People First initiiert und durchgeführt wurde. Dieses Projekt diente als Aufklärungskampagne, um den Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung in Deutschland bekannt zu machen und erste Erfahrungen zu sammeln. Diese Kampagne und das Engagement der beteiligten Personen, haben dazu geführt, dass eine Reihe von Persönlichen Zukunftsplanungen durchgeführt wurde und der Ansatz in der Öffentlichkeit weiter Bekanntheit erlangte. Mittlerweile haben sich mehrere Autoren dieser Thematik gewidmet und zum Teil auch eigene Zukunftsplanungen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten[3] durchgeführt. Auffällig bei der Betrachtung dieser verfügbaren Arbeiten ist, dass zumeinst ein wesentlicher Lebensbereich Grundlage der Planung darstellte - der Übergang von der Schule in das Berufsleben. Aus diesem Grund habe ich in meiner Arbeit diesen Lebensbereich weitgehend ausgeklammert und mich auf einen weiteren wesentlichen Lebensbereich konzentriert - das Wohnen von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Die persönliche Zukunftsplanung kann immer dann Anwendung finden, wenn sich im Leben einer Person etwas verändert oder, wenn eine Unzufriedenheit besteht und somit eine Veränderung herbeigeführt werden sollte. Somit hat sie im Bereich Wohnen auch eine große Bedeutung.
Der Lebensbereich des Wohnens stellt für jeden Menschen einen bedeutenden Aspekt dar. Wohnraum bietet Schutzraum und Rückzugsmöglichkeit, aber ist auch Ausdruck von Individualität, indem sich jeder Mensch verwirklichen und ausleben kann und sollte. Jeder erwachsene Mensch hat das Recht, sich die Wohnform (eigene Wohnung, Wohngemeinschaft) auszusuchen, in der er sich wohl und zu Hause fühlt.
In diesem Zusammenhang spielt die Thematik der Selbstbestimmung eine entscheidende Rolle. Die Wahl der vermeintlich richtigen Wohnform orientiert sich heute immer noch häufig an der Behinderung selbst und dem Hilfebedarf des behinderten Menschen. Die Wünsche und Vorstellungen des Individuums werden dabei zu oft außer Acht gelassen, sodass Menschen mit Lernschwierigkeiten in diesem Bereich sehr oft fremdbestimmt werden.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf den Personenkreis der Menschen mit Lernschwierigkeiten und geht dabei nicht spezifisch auf die Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung ein. Persönliche Zukunftsplanung im Kontext dieser Zielgruppe, würde im Rahmen dieser Diplomarbeit ein zu weites Feld öffnen.
Durch persönliche Erfahrungen, in Form von verschiedenen Praktika in unterschiedlich konzipierten Wohnheimen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, habe ich die traditionelle Hilfeplanung kennen gelernt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob diese den Vorstellungen und Wünschen dieser Menschen gereicht werden kann. Die Überlegung, ob es alternative Planungsmodelle gibt, die den Menschen selbst stärker in die Mittelpunkt der Planung stellen, statt hauptsächlich die Behinderung, hat mich zu der vorliegenden Arbeit motiviert.
Vordergründig untersuche ich die Fragestellung, ob die Persönliche Zukunftsplanung Menschen mit Lernschwierigkeiten, im Lebensbereich Wohnen, zu mehr Selbstbestimmung verhelfen kann. Dabei werde ich die traditionelle Hilfeplanung der Persönlichen Zukunftsplanung gegenüber stellen, um so zu untersuchen, welchen Einfluss die jeweilige Planungsform auf die Selbstbestimmung der planenden Person hat. Zum Abschluss gehe ich auf einen aktuellen Rechtsverhalt (das Persönliche Budget) und einem Handlungsansatz (die Persönliche Assistenz) näher ein, der mit diesem im engen Zusammenhang steht. Dabei soll deutlich werden, ob diese Aspekte positiven Einfluss auf die Umsetzung der Persönlichen Zukunftsplanung haben können.
Die Inhalte dieser Arbeit setzen sich aus einer intensiven Literaturrecherche und den sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen zusammen. Besonders bei der Thematik der Persönlichen Zukunftsplanung wird deutlich, dass es hierzu bislang noch wenig deutschsprachige Literatur gibt. Daher beziehen sich die Literaturangaben zu diesem Themenbereich vorrangig auf Zeitschriftenartikel.
Im Anschluss an die Einleitung erfolgt im ersten Kapitel eine Definition von Behinderung, die einem besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit dienen soll. Dabei werden sowohl die medizinische, als auch die soziale Sichtweise Einzug finden, da letztere im Kontext der Persönlichen Zukunftsplanung von Bedeutung ist.
Im folgenden Kapitel wird die Theorie der Selbstbestimmung thematisiert, um eine Abgrenzung zu den Begrifflichkeiten Selbstbestimmung, Fremdbestimmung und Selbstständigkeit darzustellen.
Daran schließt ein Kapitel über die Persönliche Zukunftsplanung an, dass dem Leser einen Überblick zu diesem methodischen Ansatz verschafft. Dabei werden der Ursprung des Ansatzes geklärt, wesentliche Elemente der Planung vorgestellt werden und einige methodische Vorgehensweise beschrieben.
Nachdem ein Basiswissen zu vorliegendem Thema geschaffen wurde, setzt sich die vorliegende Diplomarbeit mit der Thematik des Wohnens von Menschen mit Lernschwierigkeiten auseinander. Aktuelle Wohnformen werden vorgestellt und es wird auf die Bedeutung und die Selbstbestimmung dieser einzelnen Wohnmöglichkeiten eingegangen. Dies stellt die Grundlage für das folgende Kapitel dar, in dem im Hinblick auf den Grad der Selbstbestimmung, die traditionelle Hilfeplanung gegenüber der Persönlichen Zukunftsplanung im Bereich Wohnen verglichen werden.
Im Anschluss werden das Persönliche Budget und die Persönliche Assistenz vorgestellt. Hier wird Aufschluss darüber gegeben, welchen Einfluss sie im Kontext der Persönlichen Zukunftsplanung haben können.
Den Schluss stellt ein persönliches Resümee dar, welches zur Auswertung der Arbeit vorgenommen wird und das Thema abrundet.
1. Begriffsbestimmung
1.1 Der Begriff Behinderung
Vordergründig betrachtet bedarf der Begriff Behinderung keiner spezifischen Definition (vgl. Dörr / Günther 2003, 32). Die Begriffe Behinderung und auch ‚behindert’ sind heute in der Alltagssprache, aber auch im wissenschaftlichen Zusammenhang äußert gebräuchlich, um eine spezifisches Erscheinungsbild zu definieren (vgl. Kron 2005, 83). Im Allgemeinen scheint bekannt zu sein, wer behindert ist und wer nicht. So wird beispielsweise einer Person im Rollstuhl oder einem taubstummen Menschen zugeschrieben, dass er behindert ist (vgl. Dörr / Günther 2003, 32). Folgt man diesem Denkmuster, so ist anzunehmen, dass ‚behindert sein’ ausschließlich von einer Funktionsbeeinträchtigung abhängig ist. Allerdings ist festzuhalten, dass diese Form der Definition von Behinderung nicht mehr dem derzeitigen Stand entspricht. Dieser Erklärungsversuch scheint zu eindimensional und lässt wichtige Komponenten außer Acht (vgl. Vernooij 2007, 11). Die wissenschaftliche Sichtweise von Behinderung bezieht heute Faktoren, wie Umfeld und Partizipation[4] mit ein (vgl. Kron 2005, 83). Trotzdem ist eine eindeutige Definition von Behinderung auch heute noch nicht gegeben, da in der Literatur weiterhin unterschiedlichste Ansätze vorherrschen. Daher sollen nun im Folgenden die in der Diskussion um Behinderung geläufigsten Sichtweisen erläutert werden, um im Anschluss eine Definition des Terminus Behinderung zu schaffen. Diese dient als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit.
1.1.1 Die medizinische Sichtweise
Aus medizinischer Sicht ist Behinderung immer im Kontext von Krankheit zu sehen. Demnach resultiert eine Behinderung aus einer Schädigung und ist damit notwendigerweise als eine Folgebeeinträchtigung dessen zu sehen. Dies impliziert, dass eine Abweichung zum gesellschaftlich definierten Normverständnis von Gesundheit stattfindet. Diese Sichtweise bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Annahme, dass im körperlichen und/ oder geistigen Bereich ein Defekt vorliegt. Dieser Defekt wird durch die gesundheitliche Norm der Gesellschaft definiert, was erkennen lässt, dass Behinderung in diesem Zusammenhang einen medizinisch greifbaren Sachverhalt darstellt. Behinderung stellt hier somit einen Endzustand dar, der nach möglicher Behandlung irreversibel ist. Die Ursache für eine Behinderung liegt hierbei in der Person selbst und ist mit einem spezifischen Merkmal, also einer feststehenden Eigenschaft, einer Person verbunden (vgl. Weingärtner 2006, 37). Dabei werden andere Verursachungsmomente - wie der gesellschaftliche Kontext - nicht in Betracht gezogen. Behinderung wird damit als individuelles Schicksal oder Problem gekennzeichnet, das kaum veränderbar scheint (vgl. Dörr / Günther 2003, 37). Ein vorliegender Defekt bzw. eine Schädigung führt so zu einer Beschränkung persönlicher Lebensfunktionen. Folgen des Defekts bzw. der eingeschränkten Lebensfunktionen sind ein Sonderstatus und die -behandlung in und durch die Gesellschaft. Dies führt letztlich zu einer Erschwerung und Beschränkung in der gesellschaftlichen Partizipation (vgl. Vernooij 2007, 11). Sicherlich sind viele Behinderungen auf Schädigungen zurückführbar, dennoch bleibt fraglich, ob eine Beeinträchtigung bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausschließlich auf diese zurückführbar ist (vgl. Dörr / Günther 2003, 37f).
1.1.2 Die soziale Sichtweise
Der Begriff Behinderung wird in diesen Erklärungsansätzen immer im sozialen Kontext gesehen. Demnach liegt die Ursache für die Behinderung nicht im Individuum selbst, sondern ist Folge eines Zuschreibungsprozesses von Erwartungshaltungen der Gesellschaft (vgl. Dörr / Günther 2003, 32).
Der Soziologe Goffman entwickelte in diesem Zusammenhang bereits in den 70er Jahren die Ausgrenzungs- und Stigmatheorie. Das Stigma ist im Kontext von Behinderung ein Merkmal, das eine Person hat, - bspw. eine körperliche Deformation - welche die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zieht (vgl. Forster 2007, 332). Dies geschieht auf negative Weise, da nur ein Merkmal in den Vordergrund tritt und andere Eigenschaften und/oder Stärkern der Person kaum oder gar nicht gesehen werden. Dem Merkmal wird eine Negation zugeschrieben, da es nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Der soziale Mechanismus, der hinter dieser Theorie steht, hat zur Folge, dass eine Person aufgrund eines Merkmals beurteilt wird. Entspricht das Merkmal nicht der gängigen Norm, so kommt es zu einer Ausgrenzung, die von der nicht betroffenen Mehrheit ausgeht. Die Theorie Goffmans wurde von der Heilpädagogik aufgegriffen, um einen Ansatz zur Definition von Behinderung zu schaffen. Dabei betont sie, dass aufgrund einer Stigmatisierung die Identität eines Menschen beschädigt oder gar verändert werden kann. Eine Stigmatisierung kann somit als Teilursache für Behinderung gesehen werden. Menschen mit einer Behinderung zeigen in vielen Fällen auch Eigenschaften, die der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen. Diese Eigenschaften können aufgrund dessen auch zu Aussonderung führen und damit zu einer erschwerten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (vgl. Kulig 2007, 357).
Eine weitere soziale Theorie zur Erklärung von Behinderung ist die Rollentheorie von Wolfensberger. Er verfolgt den Ansatz, dass eine Herabsetzung gesellschaftlicher Gruppen auf die Vorstellung der sie ablehnenden Umwelt zurückzuführen ist. Das bedeutet, dass die Ablehnung nicht auf den Abgelehnten selbst (dem Individuum) bezogen wird, sondern auf die Rolle, die er bekleidet. Dieser Denkansatz impliziert, dass Menschen in verschiedene Rollen eingeteilt werden und ihnen mit Hilfe eines allgemeingültigen Begriffes rollenbezogene Eigenschaften zugeschrieben werden. Es entsteht eine Rangfolge, die maßgeblich durch allgemeine Wertvorstellungen beeinflusst wird. Eine Aufteilung in angesehene (bspw. Arbeitgeber, Ehemann) und unangesehene (bspw. Trinker, Trottel) Rollen, ist damit dadurch bestimmt, wie sie durch andere Menschen behandelt werden und „inwieweit ihnen die Zugänge zu Ressourcen[5] erleichtert oder erschwert werden“ (ebd., 357).
Im Zusammenhang mit Behinderung würde die Rollentheorie ausdrücken, dass behinderten Menschen die Rolle des ‚Behinderten’ zugeschrieben wird. Dies bedeutet, die rollenbezogene Eigenschaft äußert sich insbesondere dadurch, dass der Mensch ‚be-hindert’ wird, indem ihm nicht alle Ressourcen zu Verfügung stehen (vgl. ebd., 358). Ein Beispiel dafür ist die Nutzbarkeit des Internets, um sich Wissen anzueignen. Viele Internetseiten sind so erklärt, dass die Bedienung nicht von jedem Menschen verstanden werden kann. Eine Erklärung in ‚leichter Sprache’[6] würde hier vielen Menschen den Zugang zum Wissen erleichtern.
Zusammenfassend ist anzumerken, dass Behinderung aus sozialer Sicht immer mit der Partizipation des Individuums am Leben in der Gesellschaft einhergeht. Diese ist aus unterschiedlichen Gründen nicht immer gewährleistet, da die Möglichkeit zur Nutzung von Ressourcen oft erschwert ist oder gar verschlossen bleibt. Die Behinderung eines Menschen manifestiert sich in diesem Zusammenhang als Problem, welches seinen Ausgangspunkt innerhalb der Gesellschaft sucht (vgl. Kobi 1993, 98).
1.2 Verknüpfung der dargestellten Sichtweisen
In den letzten Jahren wurde die Forderung nach einem umfassenderen Erklärungsmodell für Behinderung immer deutlicher. Aufgrund dessen geriet das medizinische Modell vermehrt in die Kritik (vgl. Weingärtner 2006, 39). Diese eindimensionale, personenbezogene und defizitorientierte Sichtweise stellt letztlich die Entwicklungsfähigkeit eines Individuums in Frage (vgl. Thimm 1995, 17) und beschreibt den Menschen anhand dessen, welche Fähigkeiten er nicht besitzt (vgl. Weingärtner 2006, 39).
Aufgrund dieser kritischen Einstellung vollzieht sich in der Sicht auf Behinderung ein Wandel, der versucht, ein positiveres Bild von Behinderung zu erzeugen. Bereits der Blickwinkel auf die Partizipation am Leben in der Gesellschaft stellt einen Fortschritt in der Sicht auf behinderte Menschen dar (vgl. Doose 2006, 45). Jedoch äußern sich auch bei der sozialen Sicht auf Behinderung viele Autoren kritisch. So geht VERNOOIJ davon aus, dass Behinderung nicht immer klar von Krankheit abgegrenzt werden kann (vgl. Vernooij 2007, 17). DÖRR und GÜNTHER führen diesen Gedanken weiter aus, indem sie eine Behinderung nicht hauptsächlich durch eine Ursache begründet sehen. Sie betonen dabei, dass mehrere Verursachungsmomente zusammenwirken. Diese können sich unter Umständen gegenseitig beeinflussen, sodass es zu einer Wechselwirkung kommt. Weder das medizinische noch das soziale Modell berücksichtigen einen derartigen Prozess. Daher drängt sich die Frage auf, ob ein einziges Modell Behinderung ganzheitlich definieren kann (vgl. Dörr / Günther 2003, 41). HOERNLE greift diese Frage auf und betont, dass die Zusammenführung beider Sichtweisen vollzogen werden muss. Dies verdeutlicht er anhand eines prägnanten Beispiels:
Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die sich durch die leichte Ansteckung (Tröpfcheninfektion) schnell ausbreiten kann. Die Krankheit wird ausgelöst durch ein Bakterium, so liegt die Ursache medizinisch gesehen in diesem. HOERNLE spricht von einer Halbwahrheit diesbezüglich und betont, dass das Bakterium allein die Krankheit nicht hervorrufen kann. Seiner Meinung nach muss dieser erst in eine Umgebung geraten, welche seine Entwicklung begünstigt. Es kommt also eine zweite Entstehungsebene in Betracht - die Gesellschaft (vgl. Hoernle 1983 zit. nach: Jantzen 2007, 17).
WEINGÄRTNER führt dazu weiter aus, dass es eine Tatsache sei, dass nicht jede Schädigung/ jeder Defekt unvermeidlich eine Beeinträchtigung zur Folge haben muss. Er stellt dazu das Beispiel dar, dass eine Schädigung des Innenohrs bspw. durch ein Hörgerät fast vollständig ausgeglichen werden kann. Dies impliziert, dass es weitere Verursachungsmomente für eine Behinderung geben muss, die sich nicht ausschließlich auf die Person beziehen, sondern auf den sozialen Raum, indem sich die Person bewegt (vgl. Weingärtner 2006, 38f).
Diesen Sachverhalt hat die WHO[7] in der neunen ICF[8] 2001 aufgegriffen (vgl. ebd., 40). Dieses Modell bezieht die gesamte Lebenswirklichkeit einer behinderten Person mit ein. So ist es in zwei wesentliche Teile aufgegliedert: 1) Funktionsfähigkeit und Behinderung und 2) Kontextfaktoren. Die Person kann so in ihrer Situation anhand ihrer Körperfunktionen und -strukturen, ihrer Aktivitäten und Partizipation sowie den Umweltfaktoren und persönlichen Faktoren beschrieben werden, was ein ganzheitliches Bild von der Person und ihrer Lebenswirklichkeit zulässt (vgl. Doose 2006, 45).
Beide Teile der ICF umfassen zwei essentielle Komponenten, die im Folgenden kurz erläutert werden.
1. Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung
Die erste Komponente bilden die Körperfunktionen (= alle physiologischen und psychologischen Funktionen, wie bspw. Sinnes- und Sprechfunktion oder alle mentalen Funktionen etc.) und Körperstrukturen (= die gesamte Körperanatomie, d.h. Gliedmaßen, Organe etc.). Die zweite Komponente umfasst die Aktivitäten (= Handlungsdurchführung) und Partizipation (= Einbezogensein in eine Lebenswelt) (vgl. Vernooij 2007, 15).
2. Komponenten der Kontextfaktoren
Hier ist die erste Komponente eine Liste der Umweltfaktoren. Diese können bspw. von Menschen veränderbare Dinge (Gebäude, Straßen), Produkte (Medikamente), Dienste oder Systeme (Gesundheits- oder Rechtssystem) und auch Beziehungen (Familie, Freunde) sein. Die zweite Komponente der Kontextfaktoren sind die personenbezogenen Faktoren, wie Personendaten, Lebensbewältigungsformen, Persönlichkeitsmerkmale oder der Erfahrungshintergrund (vgl. Doose 2006, 45).
Die ICF beschreibt Behinderung am Begriff der „funktionalen Gesundheit“. Mithilfe des Modells kann eine Person als funktional gesund beschrieben werden, wenn alle Komponenten vor dem Lebenshintergrund (also den Kontextfaktoren) positiv darstellt werden können. Dabei spielt bei der Entstehung von Behinderung die Wechselwirkung zwischen der Funktionsfähigkeit der Person (1. Komponente) und den Kontextfaktoren (2. Komponente) eine entscheidende Rolle (vgl. Weingärtner 2006, 40).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 zeigt dabei die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten der ICF, die im Folgenden anhand eines Beispiels kurz dargestellt werden.
Eine Person kann bspw. eine kognitive Beeinträchtigung haben. Das heißt, es kann eine Schädigung oder Funktionsbeeinträchtigung des Nervensystems festgestellt werden. Dies wird auf der Ebene der Köperfunktionen u. -strukturen dargestellt. Aufgrund dessen kann es auf der Ebene der Aktivitäten und Partizipation zu einer Beeinträchtigung kommen. DOOSE bezieht sich dabei auf die Arbeitswelt, in der die Person an der Teilhabe an üblichen Aktivitäten im Arbeitsleben beeinträchtigt ist, d.h. keine Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Es kommt also zu einer Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem und der Aktivität und den Partizipationsmöglichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen. Hinzu kommen noch die Umweltfaktoren, die ebenfalls in Wechselwirkung zu den anderen Komponenten stehen. Bezogen auf das Beispiel könnte dies eine schlechte Arbeitsmarktsituation sein, die maßgeblich Einfluss auf die Aktivität der Person in diesem Lebensbereich haben kann. Dazu kommen letztlich noch die personenbezogenen Faktoren, die bspw. eine niedrige Motivation sein könnten. Wichtig ist zu erkennen, dass diese niedrige Motivation durch die Wechselwirkung zwischen den anderen Komponenten bedingt sein kann. Das heißt, sie ergibt sich aus der Beeinträchtigung der Aktivität und Partizipation, den Umweltfaktoren und letztlich aus der Beeinträchtigung der Körperfunktionen u. -strukturen. Die Behinderung resultiert somit aus der dynamischen Wechselwirkung zwischen den Komponenten (vgl. Doose 2006, 46f).
Die WHO schafft mit der ICF eine Möglichkeit, Behinderung in den verschiedenen Bereichen, in denen sie auftreten kann, differenziert darzustellen, ohne dabei die Ursachen für Behinderung ausschließlich in der Person und im sozialen Umfeld zu sehen (vgl. Doose 2006, 47).
Abschließend möchte ich mich der Sichtweise auf Behinderung seitens der WHO anschließen und dabei betonen, dass sie die Sicht auf Menschen mit Behinderung positiv verändert. Jedoch kann dies meines Erachtens nur der erste Schritt in eine Gesellschaft sein, in der behinderte Menschen keinen Sonderstatus haben, der ihre Teilhabe am Leben beeinträchtigt. So wie die Autorin Evamarie Knust-Potter, bin ich der Ansicht, dass „Menschen nicht auf ihre Behinderung hin reduziert wahrgenommen und behandelt werden sollten, sondern als Personen mit vielfältigen Fähigkeiten und Eigenschaften“ (Knust-Potter 1998, 5). Nur so kann, meiner Meinung nach, ein selbstbestimmtes Leben für jeden Menschen möglich sein. In diesem Zusammenhang möchte ich im zweiten Kapitel die Thematik der Selbstbestimmung aufgreifen.
1.3 Zum Verständnis des Begriffs geistige Behinderung
Zunächst ist fraglich, ob der Begriff der geistigen Behinderung an dieser Stelle extra definiert werden muss. Denn ebenso wie eine allgemeine Definition von Behinderung, ist auch dieser Definitionsansatz uneinheitlich. Daher sollte er differenzierter dargestellt werden. Aufgrund dessen möchte ich zu dieser Thematik einige Gedanken aufführen, denn vorliegende Arbeit bezieht sich vorwiegend auf den Personenkreis der „geistig behinderten Menschen“. Des Weiteren sind einige Überlegungen im Kontext der Selbstbestimmung von Bedeutung.
Medizinisch gesehen wird geistige Behinderung als Intelligenzminderung oder -störung beschrieben. Die ICD-10[9] spricht seit 2006 von einer Intelligenzstörung und definiert diese unter F70-F73, F78 und F79. Dabei unterteilt sie zwischen den Schweregraden der geistigen Behinderung bzw. Intelligenzminderung (vgl. DIMDI 2008). Ausschlaggebend für die Klassifikation des Schweregrades ist hier der Intelligenzquotient (im Folgenden IQ). Abbildung 2 gibt darüber kurz Aufschluss.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Klassifikation des Schweregrades geistiger Behinderung
Quelle: DIMDI 2008: ICD-10 unter F 70-F73)
Diese Klassifikation mag hilfreich sein bei der Inanspruchnahme von Rechtsansprüchen. Sie sagt jedoch nichts über die Teilhabe am Leben der betroffenen oder auf diese Weise eingestuften Person aus. Auch die Unterteilung von geistiger Behinderung durch Ursachen bleibt fraglich und, wie bereits bei der Begriffsbestimmung von Behinderung im Allgemeinen aufgeführt, eine zu eindimensionale Sichtweise darstellt (vgl. Biermann / Goetze 2005, 103ff).
Der Begriff geistige Behinderung zieht, neben den schwierigen Einteilungsversuchen, einen weiteren gravierenden Faktor nach sich. Die Begrifflichkeit der geistigen Behinderung ist oftmals mit einem Stigma verbunden. Betroffenen oder damit bezeichneten Menschen wird unterstellt, dass sie Schwierigkeiten haben, ihr Leben selbstständig und selbstbestimmt führen zu können (vgl. Speck 2007, 136). Somit wird Menschen mit einer geistigen Behinderung oft die Lernfähig- und damit eine Entwicklungsfähigkeit abgeschrieben. Viele Menschen grenzen sich von dieser Sichtweise bereits ab, und besonders die Menschen vom Netzwerk People Frist Deutschland e.V. treten für die Verwendung eines Ersatzbegriffes ein. Sie setzen sich daher dafür ein, dass sie nicht mehr als „geistig Behinderte“ bezeichnet werden, sondern als Menschen mit Lernschwierigkeiten. Diese Begriffsbestimmung impliziert, dass es sich nicht um eine Lernunfähigkeit handelt, sondern dass es vielmehr darum geht, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten mit all ihren Fähigkeiten genauso lernen, wie alle anderen Menschen auch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie dafür mehr Zeit benötigen und evtl. auch einer besonderen Unterstützung (bspw. Materialien in ‚leichter Sprache’) bedürfen (vgl. Netzwerk People First Deutschland 2005, o.S.).
KNIEL und WINDISCH bringen die Kritik an dem Begriff geistige Behinderung noch mal auf den Punkt: "Die Etikettierung von Personen mit dem Begriff "geistiger Behinderung" führt pauschalierend zur Legitimation einer lebenslangen Einschränkung der Selbstbestimmung, Selbständigkeit und individuellen Entwicklung sowie zu einer umfassenden ‚Abhängigkeit und Hilfebedürftigkeit'" (Kniel / Windisch 2000 zit. nach Erlinger 2004). Diese Etikettierung sagt letztlich aus, dass geistige Behinderung versucht, den gesamten Menschen zu beschreiben. Dies führt dazu, dass nicht nur die kognitiven Fähigkeiten des Menschen beeinträchtig sind, sondern dass auch alle anderen Fähigkeiten als defizitär gesehen werden (vgl. Weingärtner 2006, 43).
In diesem Kontext wird nun im Folgenden Kapitel die Theorie der Selbstbestimmung aufgegriffen. Dabei wird erläutert, was Selbstbestimmung umfasst und wo Fremdbestimmung anfängt. Letztlich wird die Bedeutung dessen dargestellt und der Zusammenhang zum Begriff Selbstständigkeit geklärt werden.
Persönlich möchte ich mich nun noch der Forderung für die Einführung eines Ersatzbegriffes für ‚geistig Behinderte’ anschließen, daher möchte ich in meiner Arbeit den Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten verwenden. Meiner Meinung nach, kann es nur dann zu einer Begriffsänderung kommen, wenn dieser kontinuierlich in die Fachwelt, aber auch in die Gesellschaft, eingeführt wird.
2. Selbstbestimmung kontra Fremdbestimmung
2.1 Was ist Fremdbestimmung?
Um einen Zugang zur Thematik der Selbstbestimmung zu bekommen, ist es wichtig, zunächst ein Verständnis zu schaffen, was Fremdbestimmung beinhaltet und ausmacht.
Fremdbestimmung wird im Kontext der Behindertenhilfe zumeist als Kontrast zur Selbstbestimmung wahrgenommen (vgl. Erlinger 2004, o.S.). Das Merkmal der Fremdbestimmung ist immer eine einseitige Abhängigkeit. Berücksichtigt man diesen Aspekt, kann auch von einem Machtgefüge gesprochen werden. Dieses zeichnet sich durch die Einschränkung der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten einer der beteiligten Personen aus (vgl. Niehoff 2007a, 125). Demnach kann Fremdbestimmung auch durch das Einschränken persönlicher und gesellschaftlicher Rechte beschrieben werden, was zur Folge hat, dass die persönliche Entwicklung eines Menschen behindert wird (vgl. Erlinger 2004, o.S.). In der Praxis wird dieser Sachverhalt insbesondere dadurch deutlich, dass Menschen Entscheidungen abgenommen und Wahlmöglichkeiten beschnitten werden. Bezogen auf Menschen mit Lernschwierigkeiten bedeutet dies, dass Helfer in einigen Lebensbereichen für diese Menschen Entscheidungen treffen. Es zeichnet sich demzufolge eine Bevormundung von Menschen mit Lernschwierigkeiten ab (vgl. ebd., o.S.). An dieser Stelle wirft sich die Frage auf, wie und warum es zu einer derartigen Bevormundung kommen kann.
OSBAHR führt dazu an, dass die Definition von Behinderung maßgeblichen Einfluss auf die Bevormundung haben kann. Bei einer defizitären Sichtweise und der Gleichsetzung von Defizit und Behinderung ist Bevormundung letztlich vorhersehbar, weil von einer grundlegenden Abhängigkeit und einem erhöhten Hilfebedarf ausgegangen wird (vgl: Osbahr 2000, 13). Kapitel eins dieser Arbeit hat diesen Sachverhalt bereits verdeutlicht.
HAHN beschreibt in diesem Zusammenhang, dass das Leben von Menschen mit einer Behinderung durch ein „mehr an sozialer Abhängigkeit“ gekennzeichnet ist (vgl: Hahn 1981 zit. nach Klöpfer 1997, 143). Er führt weiter aus, dass in der Vergangenheit besonders Menschen mit Lernschwierigkeiten bestimmte negative Verhaltensweisen zugeschrieben wurden. Einige Beispiele dafür sind: Ausgeprägtes passives Verhalten, Lernen ausschließlich durch Nachahmung, weniger eigene Bedürfnisse und eine funktionelle Angewiesenheit (aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen). Nimmt man diese Verhaltenszuschreibungen ernst, ohne sie kritisch zu hinterfragen, so muss der Schluss gezogen werden, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten generalisierend ihr Leben lang auf Anleitung und somit auf fremde Hilfe angewiesen sind. Zwar kann eine kognitive Schädigung Auswirkung auf die Selbstständigkeit haben, wer bspw. nicht spreche kann ist zwangsläufig abhängiger, jedoch bleibt fraglich, ob dies auch Auswirkungen auf die Selbstbestimmung haben muss (vgl: Speck 2000, 15 f).
HARNACK widmet sich zwei weiteren Faktoren, die das Ausmaß von Fremdbestimmung maßgeblich beeinflussen.
1) Infantilisierung
SPECK hält fest, dass der Mensch in völliger Abhängigkeit von fremder Hilfe zur Welt kommt. Er betont, dass ein (Über-) Leben zunächst von fremder Hilfe und Pflege gekennzeichnet ist (vgl: (vgl: Speck 2000, 17). Die normale Entwicklung eines Menschen beinhaltet, dass das Maß an Abhängigkeit im Laufe des Erwachsenwerdens Stück für Stück minimiert wird, sodass ein weitgehend unabhängiges und selbstbestimmtes Leben möglich wird. Jungendliche ohne Behinderung entwickeln i.d.R. eine Vorstellung von Leben und fordern nach und nach immer mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit für ihr Leben einen. Nur so kann eine erfolgreiche Ablösung von den Eltern vollzogen und ein eigenständiges Leben geführt werden. Diese Entwicklung trifft in den meisten Fällen sicherlich auch auf Menschen mit Lernschwierigkeiten zu, sodass es zu Ablösungsversuchen der Betroffenen von den Eltern kommt. Die Tatsache, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten eigene Vorstellungen vom Leben entwickeln, die möglicherweise konträr zu den Vorstellungen der Eltern sind, wird jedoch oftmals nicht anerkannt. So bleibt es in vielen Fällen bei Ablösungsversuchen.
Aufgrund von verschiedenen Eigenschaften, die Menschen mit Lernschwierigkeiten beigemessen werden, werden sie nicht ausreichend als erwachsene, selbstständig handelnde Menschen wahrgenommen. Allein der Fakt, dass ihnen ein Intelligenzniveau von Kindern zugeordnet wird, macht deutlich, dass sie weniger als erwachsene Menschen wahrgenommen werden, sondern vielmehr als „ewige“ Kinder. Hinzu kommt (und das ebenfalls durch pädagogisches Fachpersonal), dass der Umgang mit diesen Menschen oft kindliche Züge aufweist. Menschen mit Lernschwierigkeiten werden oft geduzt oder es wird in ihrem Beisein über sie gesprochen ohne sie konkret einzubeziehen. Letztlich werden ihnen kaum eigene Meinungen zugetraut. So kommt es zu einer Überbetreuung, die sich in einem fremdbestimmten Verhalten der Helfer zeigt.
Hier wird ebenfalls deutlich, dass ein Machtverhältnis besteht zwischen Erwachsenen und den so genannten „ewigen Kindern“ (vgl: Harnack 1996, 50f).
Gegen diese Stigmatisierung als „ewige Kinder“ tritt auch das Netzwerk People First ein. Deren Mitglieder fordern, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten als erwachsene Menschen wahrgenommen werden, die Wünsche Ziel und Vorstellungen vom Leben haben (oder entwickeln können). Dies impliziert, dass sie, wie jeder andere Mensch auch, mit Nachnamen angesprochen werden und nicht geduzt werden (vgl. Netzwerk People First Deutschland e.V. 2005, o. S.).
2) Institutionalisierung
Das Leben von Menschen mit Lernschwierigkeiten wird häufig in vielen Bereichen (Lernen, Wohnen, Arbeiten, Freizeit) durch Personen ohne Behinderung fremdbestimmt. Maßgeblichen Einfluss darauf hat die Lebenssituation des betroffenen Menschen. Häufig ist deren Leben durch verschiedene Institutionen geprägt. In der Regel sind diese Institutionen Sondereinrichtungen, die auf die (angeblichen) Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind.
Der Übergang vom Elternhaus in eine andere Wohnform stellt bei einem Großteil der Menschen einen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt dar, der gekennzeichnet ist durch Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Anders verhält sich dies bei Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie geraten häufig von einer Abhängigkeit in die nächste. Anfangs sind sie abhängig von ihren Eltern und deren Vorstellung von einem wünschenswerten Leben. Innerhalb der Institution sind sie abhängig von deren oftmals verallgemeinerten und zentralisierten Entscheidungen und Vorgaben. Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Lebens werden so eingeschränkt. Infolgedessen sind einzelne Lebensbereiche dieses Menschen durch Fremdbestimmung gekennzeichnet: Es wird entschieden, wie und wo diese leben (bei den Eltern oder im Heim), sie lernen dürfen (in der Sonderschule) und arbeiten können (in der Werkstatt für behinderte Menschen). Eigene Einflussnahme wird Menschen mit Behinderung nur selten gewährt[10] (vgl. Harnack 1996, 51f).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beide Faktoren durch Fremdbestimmung gekennzeichnet sind und weder Raum für Individualität noch für eigene Lebensvorstellung zulassen. HARNACK erkennt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten als nicht erwachsen, nicht selbstständig, nicht mündig und nicht verantwortungsbewusst angesehen werden. Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften ist es nicht verwunderlich, dass ihnen Selbstbestimmung aberkannt wird (vgl. ebd., 53).
2.2 Was ist Selbstbestimmung?
An dieser Stelle muss nun geklärt werden, was Selbstbestimmung heißt, umfasst und ob es ein Recht darauf gibt. Auch die Bedeutung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und die Frage nach Grenzen der Selbstbestimmung, sollen im Folgenden aufgegriffen werden.
Wenn Selbstbestimmung als Gegenpol zur Fremdbestimmung gesehen wird, muss davon ausgegangen werden, dass Selbstbestimmung allgemein die individuelle Lebensgestaltung in sämtlichen Lebensbereichen darstellt.
Allerdings umfasst dieser Begriff weitaus mehr. So betont SPECK, dass Selbstbestimmung Ausdruck von Freiheit ist (vgl. Speck 2007, 301). Freiheit bedeutet, dass man das machen kann, was man konkret möchte, um seine Bedürfnisse zu erfüllen und schließlich das eigene Leben zu gestalten. Demnach steht Selbstbestimmung im direkten Zusammenhang zur Befriedigung von individuellen Bedürfnissen. Die Erfüllung von Bedürfnissen führt zum Wohlbefinden. Jeder Mensch strebt Wohlbefinden für sein eigenes Leben an, indem er große und kleine Angelegenheiten in seinem Leben selbst bestimmt. Dabei werden Entscheidungen getroffen, die durch bestehende Bedürfnisse maßgeblich beeinflusst werden.
Zusammenfassend bedeutet Selbstbestimmung somit die Kontrolle über das eigene Leben (vgl. Hahn 1996, 25).
2.2.1 Recht auf Selbstbestimmung
Berücksichtigt man die letzte Aussage, so stellt sich die Frage, ob es ein Recht auf Selbstbestimmung gibt. Es wird von der Tatsache ausgegangen, dass jeder das Recht besitzt, sein Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Aus diesem Grund muss die aufgeworfene Frage mit ‚ja’ beantwortet werden.
Dieser Rechtsverhalt lässt sich aus dem Grundgesetz ableiten. Dort heißt es in Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Art. 1, Abs. 1 GG). Die Würde eines Menschen steht im Kontext der individuellen Lebensgestaltung, und umfasst die Erfüllung von Bedürfnissen und die Möglichkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Nicht umsonst spricht man grundsätzlich auch von einem ‚menschenwürdigen Leben’. Menschenwürde beinhaltet folglich das Anerkennen der Fähigkeiten einer Person und demnach selbstbestimmtes Handeln (vgl. Dreblow 1999, 128).
In Artikel 2 ist festgehalten, dass jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt (vgl. Art. 2, Abs. 1 GG). Die Persönlichkeit kann nur dann frei entfaltet werden, wenn Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen, selbst getroffen werden können. So wird auch hier deutlich, dass Selbstbestimmung mit der Entwicklung der Individualität eines Menschen einhergeht (vgl. Dreblow 1999, 128).
Demzufolge ist das Recht auf Selbstbestimmung für jeden Menschen einforderbar. Wie bereits dargestellt wurde, wird dieses Recht Menschen mit Lernschwierigkeiten oftmals abgesprochen, indem ihnen relevante Entscheidungen abgenommen werden.
Auf rechtlicher Ebene scheint dieser Umstand umso erstaunlicher, da im Grundgesetz ebenso festgehalten ist, dass niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf (vgl. Art. 3, Abs. 3 GG). Diese Benachteiligung geschieht jedoch, wenn einem Menschen mit einer Behinderung weniger oder gar keine Entscheidungsfreiheit gewährt wird (vgl. Dreblow 1999, 128).
Fraglich ist, warum Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe nicht immer und letztlich noch viel zu selten realisiert wird.
Erklären lässt sich dies anhand einer gesellschaftlichen Gegebenheit:
Wie bereits erwähnt, herrscht immer noch eine sehr defizitorientierte Sichtweise von Menschen mit Behinderung vor. Diese impliziert, dass Menschen mit Behinderung auf Hilfe angewiesen sind. Infolgedessen kommt es häufig zu Abhängigkeiten, die sich in geringeren Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten äußern. Rechtlich untermauert wird dies durch das Betreuungsgesetz. In diesem heißt es, dass für einen Menschen, der aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können, ein Betreuer bestellt werden soll (vgl. § 1896, Abs. 1 BGB). Dieser rechtliche Sachverhalt dient im eigentlichen Sinne dem Wohle des Betroffenen, jedoch wird auch deutlich, dass wer laut Gesetz seine Angelegenheiten nicht selbst besorgen kann, Hilfe bedarf und somit in ein Abhängigkeitsverhältnis gerät (vgl. Speck 1996, 15). Sicherlich ist dabei immer fraglich, wie diese Hilfe aussieht. Jedoch soll dies an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, da sich Kapitel sechs ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt.
2.3 Selbstbestimmung bei Menschen mit Lernschwierigkeiten
Nach einer allgemeinen Betrachtung des Begriffs Selbstbestimmung wird hier nun Selbstbestimmung in dem Kontext der Menschen mit Lernschwierigkeiten betrachtet .
Selbstbestimmung bei Menschen mit einer Behinderung ist durchaus kein neues Thema. Bereits in den 60er Jahren schlossen sich in den USA behinderte Menschen zusammen, um für die Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung und Benachteiligung behinderter Menschen einzutreten (vgl. Niehoff 1997a, 59). Die Beteiligten dieser Bewegung forderten, dass sie ihre Angelegenheiten selbst regeln wollten, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Voraussetzungen, Entscheidungen eigenständig treffen zu können, die zur Selbstbestimmung führen und weniger Abhängigkeit zur Folge haben (vgl. Rock 2001, 13).
Diese Independent-Living-Bewegung entwickelte sich unter dem Namen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung auch in Deutschland. Die Wurzeln dieser Bewegung liegen in der deutschen „Krüppelbewegung“ aus den 70er Jahren. Die Intentionen dieser Gruppen waren hauptsächlich, sich gegen bestehende Missstände in der Gesellschaft zu wehren. Dabei wurde jedoch die Kooperation durch nicht behinderte Menschen abgelehnt. Die Ideen und Forderungen der Independent-Living-Bewegung hatten erheblichen Einfluss auf die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Deutschland. So wurden ab Mitte der 80er Jahre erste Zentren für selbstbestimmtes Leben gegründet (vgl. Dreblow, 129f). Diese Zentren für selbstbestimmtes Leben (ZsL) sind Beratungsstellen von und für behinderte Menschen. Die Mitarbeiter dieser Zentren sind selbst behindert - bspw. körperbehindert oder sehbehindert - und können so berufliche Qualifikation mit persönlicher Erfahrung verbinden. Sie arbeiten nach dem Konzept des Peer Counseling, was soviel heißt, dass behinderte Menschen von behinderten Menschen beraten werden. Ziel der Beratung ist es, Menschen mit einer Behinderung zu unterstützen, zu informieren und sie auf einem Weg hin zu mehr Selbstbestimmung zu begleiten (vgl. Zentrum für selbstbestimmtes Leben Köln o. J., o.S.).
Wie in dieser Arbeit bereits erwähnt, gibt es zudem Zusammenschlüsse von Menschen mit Lernschwierigkeiten - „Menschen zuerst - Netzwerk People First Deutschland“. Auch diese Gruppen haben ihren Ursprung in den USA. Dort wurden sie vor über 25 Jahren gegründet und forderten, dass sie primär als Menschen und nicht als „Geistigbehinderte“ gesehen werden. Des Weiteren traten und treten sie für ihre eigenen Rechte ein und unterstützen sich gegenseitig dabei, ihr Leben zu verbessern. Dafür entwickelten sie in der Vergangenheit und aktuell verschiedene Projekte und setzen für Themen ein, die Auswirkung auf ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben (z.B. leichte Sprache).
Im Gegensatz zu damaligen „Krüppelbewegung“ lassen sich People First Gruppen durch nicht behinderte Menschen unterstützen. Allerdings beeinflussen diese Unterstützer nicht die inhaltliche Gestaltung, sie helfen vielmehr bei der Organisation und der Verwirklichung von Zielen (vgl. Doose 2006, 54).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Selbstbestimmung keine neue Thematik in der Behindertenhilfe ist. Jedoch ist auch anzumerken, dass die Selbstbestimmungsdiskussion erst seit den 90er Jahren immer mehr in den Fokus geraten ist. Seit dieser Zeit wurden die Veröffentlichungen zum Thema Selbstbestimmung immer zahlreicher (vgl. Weingärtner 1999, 29). Dass die Thematik in den 90ern immer stärker ins Zentrum des Interesses geraten ist, hängt sicherlich mit der sich wandelnden Sicht auf Behinderung zusammen. Demnach werden Menschen mit einer Behinderung (vorrangig in der Fachwelt) zunehmend als Menschen mit eigenen Vorstellungen vom Leben und vielfältigen Fähigkeiten wahrgenommen.
2.3.1 Bedeutung der Selbstbestimmung
Selbstbestimmung in der eigenen Lebensführung ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist dies lange noch nicht Realität. So ist es nicht verwunderlich, dass der Selbstbestimmung dieses Personenkreises besondere Bedeutung zugemessen wird.
Aufgrund dessen werden nun einige wichtige Bedeutungsmerkmale der Selbstbestimmung erläutert.
1) Bedürfnisbefriedigung
Jeder Mensch hat Bedürfnisse, die er befriedigen möchte. Hinter Bedürfnissen stecken immer auch Wünsche und Träume, Ziele und Vorstellungen, die ein Mensch in sich trägt. Grundsätzlich verfolgen Menschen zeitlebens das Ziel, sich diese Wünsche und Träume zu erfüllen oder Vorstellungen zu verwirklichen. So gestaltet sich ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben (vgl. Bach 1996, 66). Selbstbestimmung findet dabei auf allen Ebenen statt. Sie kann grundlegende Lebensbereiche betreffen, wie bspw. die Gestaltung der Freizeit- oder der Arbeitssituation), ist aber auch in kleinen alltäglichen Bereichen, wie bspw. die Wahl der Kleidung von großer Bedeutung.
Menschen mit Lernschwierigkeiten wird die oben beschriebene Bedürfnisbefriedigung oft nicht im vollen Umfang zugestanden. Die Schwierigkeit mag darin liegen, dass ein Teil dieser Menschen nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse kommunikativ und klar zu äußern. Dies darf jedoch kein Grund sein, die Bedürfnisse dieser Menschen nicht ernst zu nehmen oder unreflektiert für sie zu entscheiden. Jeder Mensch hat grundsätzlich das Recht Entscheidungen selbst zu treffen. Für Menschen, die sich kommunikativ nicht äußern können, müssen Wahlmöglichkeiten geschaffen werden, auch wenn dies einen zeitlichen Mehraufwand bedeutet (vgl. Hahn 1997, 145).
Es ist notwendig zu erkennen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ebenso Fähigkeiten und Stärken besitzen, wie jeder andere Mensch auch. Diese können und sollen für ein selbstbestimmtes Leben genutzt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass jeder Mensch „Experte in eigener Sache ist“. Auch dies muss für Menschen mit Lernschwierigkeiten gelten. Sie kennen ihr Leben am besten und wissen in den meisten Fällen, welche Prioritäten und Ziele sie in ihrem Leben haben. Demnach kann man davon ausgehen, dass jeder Mensch Vorlieben und Abneigungen hat oder entwickeln kann. Dabei spielt die Beeinträchtigung keine Rolle. Daher muss Menschen mit Lernschwierigkeiten zugestanden werden, dass Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, von ihnen selbst getroffen werden und nicht durch Angehörige oder von Fachleuten. Um dies zu verdeutlichen und erkennen, sollte man sich bewusstmachen, wie man selbst empfinden würde, wenn andere Leute für die eigene Person über das eigene Leben entscheiden (vgl. Kass 2002, 31f).
Aus meiner eigenen Perspektive kann ich sagen, dass die Vorstellung, dass ein anderer Mensch für mich Entscheidungen treffen würde, sehr negativ belastet ist. Jeder Mensch käme sich bevormundet vor und fühlte sich in seiner persönlichen Entwicklung eingeschränkt. In der Betrachtungsweise von Menschen mit Lernschwierigkeiten sollte mehr versucht werden, den Blickwinkel der Betroffenen einzunehmen. Wenn nichtbehinderte Menschen versuchten, sich in deren Lage zu versetzen und nachzuvollziehen, wie sie in einer vergleichbaren Situation empfänden, kämen sie vermutlich zu der Erkenntnis kommen, dass sich eine derartige Bevormundung negativ auswirkt.
Demnach hat die Befriedigung von Bedürfnissen für Menschen mit Lernschwierigkeiten eine hohe Bedeutung. Nur unter deren Berücksichtigung, ist es möglich, dass sich Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeit ausleben und ein selbstbestimmtes Leben führen können.
2) Lernen, sich selbst zu akzeptieren
Die Möglichkeit der Selbstbestimmung hat für Menschen mit Lernschwierigkeiten auch im Hinblick auf das Selbstwertgefühl eine hohe Bedeutung. Besonders in Menschen, die über einen langen Zeitraum bereits fremdbestimmt wurden, entwickelt sich oft ein negatives Selbstbild. Gefühle wie Minderwertigkeit und Selbstzweifel gehen damit einher (vgl. Dreblow 1999, 132). Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer noch viele Menschen, die in Institutionen leben, ihr Recht auf Selbstbestimmung nicht einfordern. Im Gegenteil, sie nehmen die Situation und das Abnehmen von Entscheidungen als gegeben und unveränderbar hin. Dies kann man auch als angepasste Verhaltensweise bezeichnen. Eine entscheidende Rolle spielt hier auch das Machtverhältnis innerhalb der Arbeit mit behinderten Menschen. Wenn davon ausgegangen wird, dass eine grundsätzliche Abhängigkeit vorherrscht, entsteht ein Machgefälle, indem die Obermacht und damit einhergehend alle Entscheidungsgewalt, den Helfern obliegt. Der „Hilfebedürftige“ steht dieser Macht hilflos und ohnmächtig gegenüber (vgl. Rock 2001, 53).
So gesehen, steht Selbstbestimmung in engem Zusammenhang mit eigenem Selbstwert. Dieses Phänomen ist jedoch nicht nur bei Menschen mit einer Behinderung sichtbar. Auch Menschen ohne Behinderung betrifft dies im hohen Maße. Bei einer Frau bspw., die jahrelang in einer unglücklichen Beziehung lebt und von ihrem Mann geschlagen wird, schwindet das Selbstbewusstsein und das eigene Selbstwertgefühl. Des Weiteren wird sie mit der Zeit wahrscheinlich auch ein sehr negatives Selbstbild entwickeln.
Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickeln aufgrund dessen oftmals ein negatives Selbstbild. Letztlich glauben viele von ihnen, dass sie es nicht wert sind, eine eigene Meinung, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu haben. Das Resultat daraus ist, dass viele Menschen aufgeben für diese einzutreten. Fremdbestimmung ist schließlich die Folge.
Umso wichtiger ist es, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden und dadurch ein positives Selbstbewusstsein und Selbstbild entstehen kann (vgl. Ochel 1996, 87). Daher ist es bedeutsam, dass es Organisationen gibt, in denen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammenschließen, auf diesen Sachverhalt aufmerksam machen und für ihre Rechte eintreten können. Nur so kann in der Öffentlichkeit nach und nach ein anderes Bild von behinderten Menschen entstehen. Dies ist die Grundvoraussetzung für eine veränderte Haltung, die es zulässt, dass Menschen mit Behinderung ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen können.
3) Gleichwertigkeit
Selbstbestimmt leben bedeutet, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre persönlichen Lebensziele durch freie Entscheidungen verwirklichen können. Dies beinhaltet, dass Verantwortung für das eigene Leben übernommen werden kann (vgl. Harnack 1996, 53). Jugendliche, die sich auf dem Weg zum Erwachsenwerden befinden, übernehmen i.d.R. im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr Verantwortung für ihr Leben. Sie beginnen, selbstständig Geld zu verwalten, gestalten ihren Tagesablauf eigenständig und entscheiden schlussendlich, was sie beruflich in ihrem Leben machen möchten und wo und wie sie wohnen möchten. Dies trifft auf Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht zu. Auch hier werden ihnen Entscheidungen abgenommen:
- Häufig keine eigene Geldverwaltung, stattdessen zugeteiltes Taschengeld
- Lebensalltag ist an die Tagesstruktur der Einrichtung, in der sie leben, angepasst
- Zuteilung des Arbeitsplatzes (oftmals in einer WfB)
- Entscheidung der Wohnform anhand entsprechend angebotener Fördermaßnahmen
Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen auch die Chance erhalten, solche Entscheidungen selbst zu treffen. Dies umfasst ebenfalls, die damit verbundenen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Denn selbstbestimmtes Leben heißt, Entscheidungen zu treffen und auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zu akzeptieren.
Gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten wird jedoch häufig davon ausgegangen, dass sie die Konsequenzen einer Entscheidung nicht abschätzen können. Festgemacht wird dies daran, dass behauptet wird, ihnen fehlten die intellektuellen Fähigkeiten. Allerdings wird dabei außer Acht gelassen, dass eigentlich ein weit reichender Erfahrungsschatz ausschlaggebend dafür ist, ob eine Situation eingeschätzt werden kann oder nicht. Wenn für Menschen mit Lernschwierigkeiten allerdings nicht die Möglichkeit geschaffen wird, dass sie Erfahrungen machen können, sind sie langfristig in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Je mehr Erfahrungen ein Mensch in seinem Leben machen kann, desto besser kann er eigenverantwortlich Entscheidungen treffen und die daraus resultierenden Konsequenzen überblicken und sich dafür entscheiden (vgl. Ochel 1996, 88).
So bedeutet selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Lernschwierigkeiten, dass sie in alle Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Dies umfasst, dass sie die Entscheidung treffen, unabhängig davon, ob sie bei der Entscheidungsfindung Unterstützung benötigen oder nicht.
Eigenständige Lebensführung, wie sie anderen Menschen auch zugestanden wird, beinhaltet einen weiteren wichtigen Aspekt: Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Selbstbestimmt Leben heißt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Gesellschaft integriert sind, d.h. in und mit dieser leben können.
Wenn institutionelle Einrichtungen, wie Wohnanlagen, außerhalb von Städten angesiedelt sind, wie es heutzutage noch häufig der Fall ist, wird die Teilhabe erschwert. Die Teilhabe wird so allein durch die räumlichen Gegebenheiten erschwert, da längere Fahrtwege in Kauf genommen werden müssen, um bspw. Freizeitaktivitäten nachzugehen (vgl. ebd., 88). Dies zeigt, dass in der Gesellschaft weiterhin Veränderungsbedarf besteht.
Zum Schluss lässt sich festhalten, dass Selbstbestimmung für Menschen mit Lernschwierigkeiten besondere Bedeutung zukommt. Die Bedürfnisbefriedigung steht für jeden Menschen im Vordergrund, da sie es uns ermöglicht, Wünsche, Träume und Vorstellungen zu verwirklichen. Dies steigert das eigene Wohlbefinden und die Zufriedenheit des einzelnen ungemein. Dabei müssen Menschen mit Lernschwierigkeiten oftmals noch lernen, dass ihnen das Recht zugestanden wird, Wünsche, Träume, Bedürfnisse und Gefühle zu haben und diese auch zu äußern und ausleben zu können. Gesellschaftlich gesehen, müssen Menschen mit und ohne Behinderung die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten. Nur so wird die Teilhabe am Leben für alle Menschen im gleichen Umfang möglich.
An dieser Stelle wurde geklärt, welche Bedeutung Selbstbestimmung für Menschen mit Lernschwierigkeiten hat. Offen bleibt die Frage, wie und ob es möglich ist, diesem Personenkreis Selbstbestimmung zu ermöglichen. Dies wird im folgenden Abschnitt thematisiert.
2.4 Bedingungen der Selbstbestimmung
Es gibt vier wesentliche Aspekte, die die Möglichkeit zur Selbstbestimmung begünstigen. Wird einer dieser Aspekte nicht berücksichtigt, so kann ein selbstbestimmtes Leben eines Menschen mit Lernschwierigkeiten entweder erschwert oder gar verhindert werden.
a) Individuelle Kompetenzen
b) Interaktion mit anderen Menschen
c) Gesellschaftliche Bedingungen
d) Strukturelle und institutionelle Bedingungen
Der erste Aspekt, die individuellen Kompetenzen der Person, sind die grundlegende Voraussetzung für Selbstbestimmung. Dargestellt wurde bereits, dass Selbstbestimmung eine Befriedigung von Bedürfnissen beinhaltet. Wichtig ist dabei zunächst, dass jeder Mensch Bedürfnisse, Vorlieben, Wünsche, Träume und Vorstellungen in sich trägt (vgl. Friebe / Wetzler 1998, 9). Allerdings sind diese nicht bei jeder Person konkret und fassbar, sodass es schwer fallen kann, zu beantworten, welche konkreten Bedürfnisse vorhanden sind. Von diesem Blickwinkel aus betrachtet, beginnt Selbstbestimmung noch einen Schritt früher. Einigen Menschen muss zunächst die Chance gegeben werden, Vorstellungen und Wünsche zu entwickeln, deren Verwirklichung zu einem selbstbestimmten Leben verhilft. An diesen Schritt gekoppelt ist jedoch auch das Äußern von Bedürfnissen, Wünschen etc. Wenn Selbstbestimmung ermöglicht werden soll, ist es dringend notwendig, dass die Möglichkeit zur Mitteilung dieser Bedürfnisse etc. geschaffen wird. Darauf baut sich der zweite Aspekt auf, ohne den Selbstbestimmung nicht erreicht werden kann. Damit ein Mensch sich mitteilen kann, muss er in Interaktion mit anderen Menschen treten können. Dabei spielt der Interaktionspartner eine entscheidende Rolle. Dieser muss, neben der Bereitschaft, dass er Selbstbestimmung ermöglichen möchte, auch über ausreichend Fachkompetenz verfügen. Er muss, und dies gilt besonders für diejenigen Menschen, die sich nicht sprachlich äußern können, Bedürfnisse erkennen und, wenn nötig, entsprechende Unterstützung anbieten, damit Bedürfnisse erfüllt werden können (vgl. Klauß 1998, 44).
Ein weiterer Aspekt sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die eine hohe Bedeutsamkeit in Hinblick auf Selbstbestimmung von Menschen mit Lernschwierigkeiten haben können. Die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten ist auch heute noch von negativen Aspekten geprägt. Sie werden auch heute in der Gesellschaft als defizitär wahrgenommen, nicht der Norm entsprechend und schließlich auch bemitleidet. Was Menschen mit Lernschwierigkeiten jedoch brauchen, ist eine Gesellschaft, die sie akzeptiert und nicht bemitleidet. Mitleidige Reaktionen, auch wenn sie ernst gemeint sind, neigen zu einer fremdbestimmten Handlungsweise gegenüber diesen Menschen mit einer Lernbehinderung. Sie spiegeln wider, dass Selbstbestimmung nicht zugelassen wird (vgl. ebd., 40).
Der letzte Aspekt sind die strukturellen und institutionellen Bedingungen. Um in Einrichtungen Selbstbestimmung zu ermöglichen und anzuregen, ist es notwendig, dass gewisse Strukturen gegeben sind. Auf der einen Seite sind dies materielle und personelle Gegebenheiten und auf der anderen Seite ein Mitwirkungsrecht der Betroffenen. Beispielsweise ist der Personalschlüssel für die anfallenden Arbeiten in vielen Institutionen zu niedrig. Auch dies erschwert häufig die Umsetzung von Selbstbestimmung auf diesem Sektor. Wenn z.B. ein Mitarbeiter für die morgendliche Versorgung von sechs Bewohnern zuständig ist, bleibt nicht viel Zeit, um die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu ergründen. Demnach darf man in einer solchen Arbeitssituation nicht nur den Mitarbeiter als Hemmnis für die Selbstbestimmung sehen, sondern muss auch die Arbeitsbedingungen kritisch hinterfragen.
Formale Selbstbestimmungsrechte müssen jedoch auch mit den tatsächlichen materiellen Gegebenheiten übereinstimmen. So nützt es Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht viel, wenn formal festgelegt wurde, dass sie die Intimität ihrer Partnerschaft in ihren Zimmern ausleben dürfen, wenn sie in einem Doppelzimmer untergebracht sind. Das Ausleben von Intimität ist selten möglich, wenn eine dritte Person anwesend ist. Das formale Recht auf Selbstbestimmung (hier die Intimität) wäre in diesem Fall vorhanden, jedoch keine Möglichkeit der Umsetzung. Dies macht deutlich, wie eng Selbstbestimmung auch mit materiellen und strukturellen Gegebenheiten zusammenhängt (vgl. ebd., 52).
Wenn man auf die Bedingungen der Selbstbestimmung aufmerksam macht, wirft sich die Frage auf, ob Selbstbestimmung auch an Grenzen stoßen kann.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Selbstbestimmung dann an Grenzen stößt, wenn Rechte und Bedürfnisse anderer Menschen eingeschränkt werden oder sie nicht mit den Normen und Werten der Gesellschaft übereinstimmt (vgl. Dreblow 1999, 128). Beispielsweise muss einem im Wohnheim lebenden Menschen mit Lernschwierigkeiten zugestanden werden, dass er die Musik hören darf, die seinen Vorlieben entspricht. Hört er diese lautstark in einem Raum, der zur Nutzung aller Bewohner gedacht ist, könnten sich andere Bewohner, die sich unterhalten möchten, gestört fühlen. Sie werden somit in ihrem Bedürfnis nach Kommunikation eingeschränkt. Hier muss nach Alternativen gesucht werden (z.B. Kopfhörer, Musik im Zimmer hören), um Rücksicht auf die Bedürfnisse aller Beteiligten zu nehmen. Die Situation müsste anders gehandhabt werden, wenn es sich bei der gespielten Musik um Texte mit rechtradikalem Hintergrund handelte, da dies nicht nur gegen gesellschaftliche Norm- und Wertvorstellungen verstößt, sondern gesetzlich verboten ist.
[...]
[1] In der vorliegenden Arbeit wird beim Begriff Persönliche Zukunftsplanung das „persönlich“ durchgehend groß geschrieben.
[2] Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit, wird in der vorliegenden Arbeit nur die männliche Schreibweise verwendet, mit der jedoch beide Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
[3] Im Folgenden wird der Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten verwendet. Dieser stellt einen Ersatzbegriff für „Geistigbehinderte“ dar.
[4] Teilhabe
[5] Unter Ressourcen sind all die Dinge zu verstehen, die einem Menschen dabei Helfen seine Lebenssituationen zu bewältigen. Dies können bspw. Wissen, Stärken, Fähigkeiten oder Einstellungen sein (vgl: Theunissen 2007, 295)
[6] Leichte Sprache heißt: kurze Sätze, keine Fremd- und Fachwörter, Erklärung von schwierigen Worten und Bilder, die helfen, den Text zu verstehen. Der Verein Netzwerk People First Deutschland fordert, dass mehr in ‚leichter Sprache’ verfasst wird und übersetzt bereits Hefte zu relevanten Themen, die über http://www.people1.de/index.html bezogen werden können.
[7] World Health Organization in Deutsch Weltgesundheitsorganisation
[8] International Classification of Functioning, Disability and Health in Deutsch Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
[9] International Classification of Diseases in Deutsch Internationale Klassifikation der Krankheiten
[10] Bezogen auf die Wohnsituation, möchte ich diesen Sachverhalt in Kapitel 5 weiter ausführen.
- Quote paper
- Christina Scherling (Author), 2008, Persönliche Zukunftsplanung in der Behindertenhilfe - Weg zu mehr Selbstbestimmung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117249