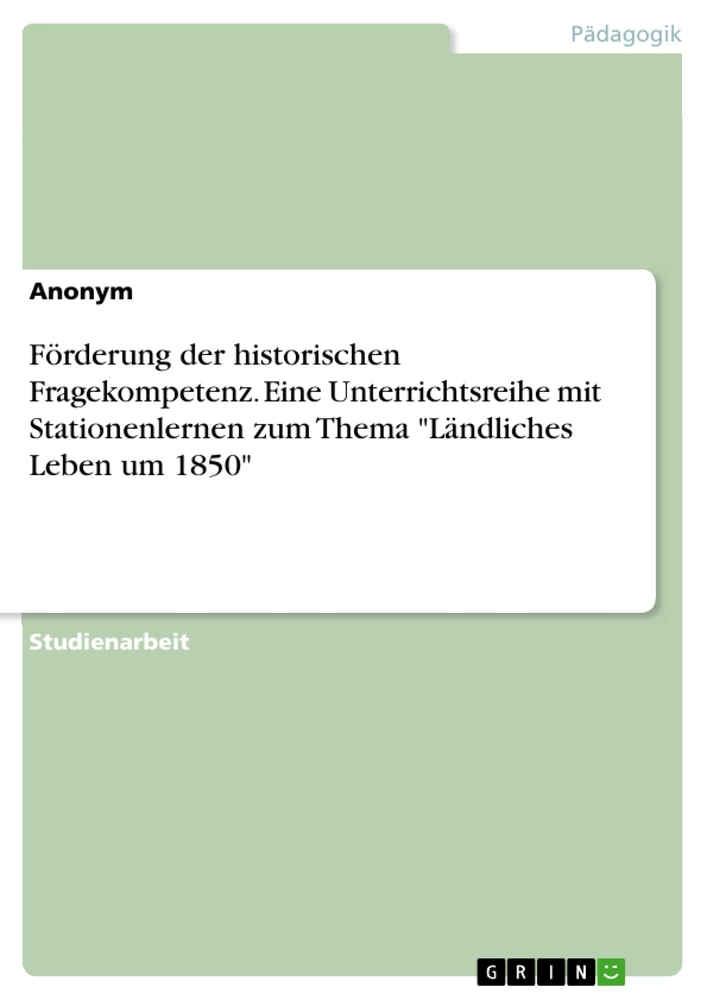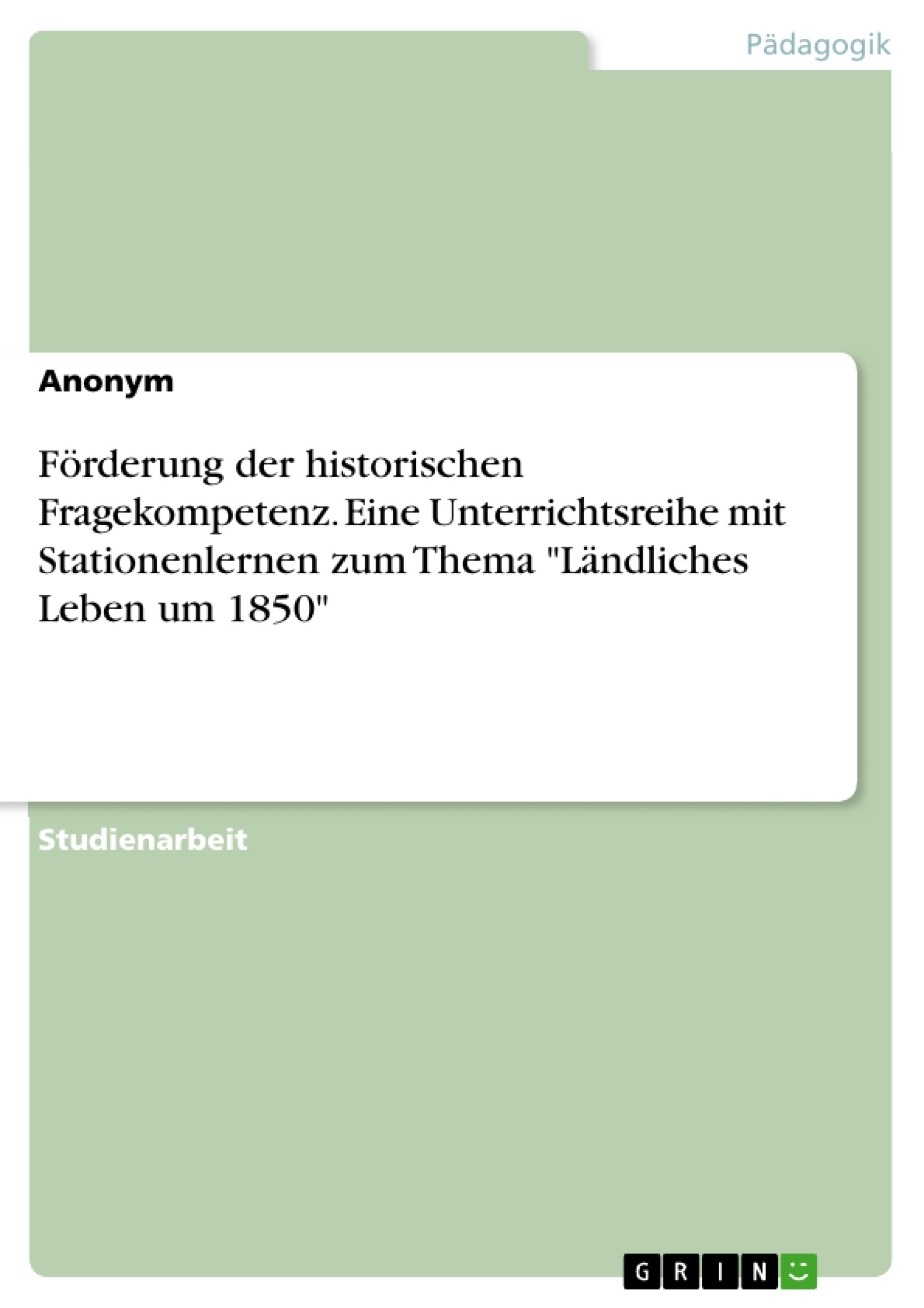In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird die Fragekompetenz von Schüler*innen näher beleuchtet und eine Unterrichtsreihe zum Thema "Ländliches Leben um 1850" hinsichtlich der Förderung der Fragekompetenz vorgestellt. Im schulischen Kontext kann man leider oft feststellen, dass es einen geringen Redeanteil von Schüler*innen gibt und auch das Fragenstellen meistens seitens der Lehrer*innen erfolgt. Die Lehrkräfte stellen die Fragen und die Lernenden bemühen sich, diese angemessen zu beantworten. Da Grundschulkinder jedoch ein beträchtliches geschichtliches Vorwissen und eine natürliche Fragehaltung mitbringen, sollte es grundlegend sein, auf dieses im Sachunterricht einzugehen beziehungsweise von diesem auszugehen. Den Fragen der Kinder sollte mehr Raum zur Verfügung gestellt werden und es sollten Impulse zum Fragenstellen gesetzt werden.
Kompetenzorientierter Unterricht findet immer mehr an Bedeutung. Statt der Vermittlung reinen Faktenwissens wird vermehrt das Schulen spezieller Kompetenzen gelehrt. Die historische Perspektive des Sachunterrichts wird unter anderem durch das Erlernen drei zentraler Kompetenzen gefördert. Dazu zählen die Frage-, Methoden- und Narrationskompetenz, die es ermöglichen, Gelerntes auch außerhalb der Schule in neuen Kontexten anzuwenden.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird der theoretische Hintergrund gebildet und erläutert, was unter dem Fragekompetenzbereich verstanden wird. Danach folgt eine nähere Erklärung der Methode des Stationenlernens, da die Unterrichtsreihe unter anderem mit dem Lernen an Stationen vermittelt werden soll. Anschließend werden praxisnahe Rahmenbedingungen gegeben, die für eine fiktive Klassengemeinschaft gelten können. Darauf folgt eine grobe Skizzierung dieser Unterrichtsreihe und dann eine ausführliche Heranführung an ein Unterrichtsbeispiel zur Förderung der Fragekompetenz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die historische Perspektive im Sachunterricht
- 2.1 Die historische Fragekompetenz
- 2.2 Lernen an Stationen
- 3. Die historische Fragekompetenz in der Praxis
- 3.1 Rahmenbedingungen und Skizzierung der Unterrichtsreihe
- 3.2 Praktische Umsetzung
- 4. Fazit
- 5. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Förderung der historischen Fragekompetenz im Sachunterricht der Grundschule. Die Arbeit analysiert, wie das Lernen an Stationen zur Vorbereitung auf einen außerschulischen Lernort die historische Fragekompetenz von Schüler*innen fördern kann. Der Fokus liegt auf einer Unterrichtsreihe zum Thema „Ländliches Leben um 1850" am Beispiel des Bauernhausmuseums Bielefeld.
- Die Bedeutung der historischen Fragekompetenz im Sachunterricht
- Die Rolle des Stationenlernens bei der Entwicklung der Fragekompetenz
- Praktische Anwendung des Stationenlernens in einer Unterrichtsreihe
- Die Förderung des historischen Denkens und Bewusstseins durch gezieltes Fragen
- Die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart im Kontext des Sachunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Bedeutung von kompetenzorientiertem Unterricht und die zentrale Rolle der Fragekompetenz im historischen Sachunterricht. Die Arbeit stellt das Problem des geringen Redeanteils von Schüler*innen im Unterricht und die Notwendigkeit der Förderung des Fragenstellens heraus.
- Kapitel 2: Die historische Perspektive im Sachunterricht: Dieses Kapitel definiert die historische Fragekompetenz und beleuchtet die Bedeutung weiterer Kompetenzbereiche wie Methoden- und Medienkompetenz sowie Narrationskompetenz. Es wird argumentiert, dass die historische Fragekompetenz den Ausgangspunkt für historisches Denken bildet.
- Kapitel 2.1: Die historische Fragekompetenz: Dieses Kapitel erläutert die historische Fragekompetenz im Detail, definiert ihre Bedeutung im Perspektivrahmen Sachunterricht und beschreibt verschiedene Arten von historischen Fragen. Es wird die Bedeutung der Fragestellung für die Rekonstruktion und Interpretation historischer Ereignisse hervorgehoben.
- Kapitel 2.2: Lernen an Stationen: Dieses Kapitel beschreibt die Methode des Stationenlernens als eine effektive Methode zur Förderung der historischen Fragekompetenz. Es werden die Vorteile des Stationenlernens für die Gestaltung von interaktiven und selbstgesteuerten Lernprozessen hervorgehoben.
- Kapitel 3: Die historische Fragekompetenz in der Praxis: Dieses Kapitel stellt die Rahmenbedingungen und eine Skizzierung einer fiktiven Unterrichtsreihe zum Thema „Ländliches Leben um 1850" vor. Es geht auf die praktische Umsetzung des Stationenlernens im Unterricht ein und illustriert anhand eines konkreten Beispiels, wie die Fragekompetenz von Schüler*innen gefördert werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen historische Fragekompetenz, Stationenlernen, Sachunterricht, ländliches Leben, Bauernhausmuseum Bielefeld, Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart, Unterrichtsreihe, Grundschule, Schüler*innen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Förderung der historischen Fragekompetenz. Eine Unterrichtsreihe mit Stationenlernen zum Thema "Ländliches Leben um 1850", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1172274