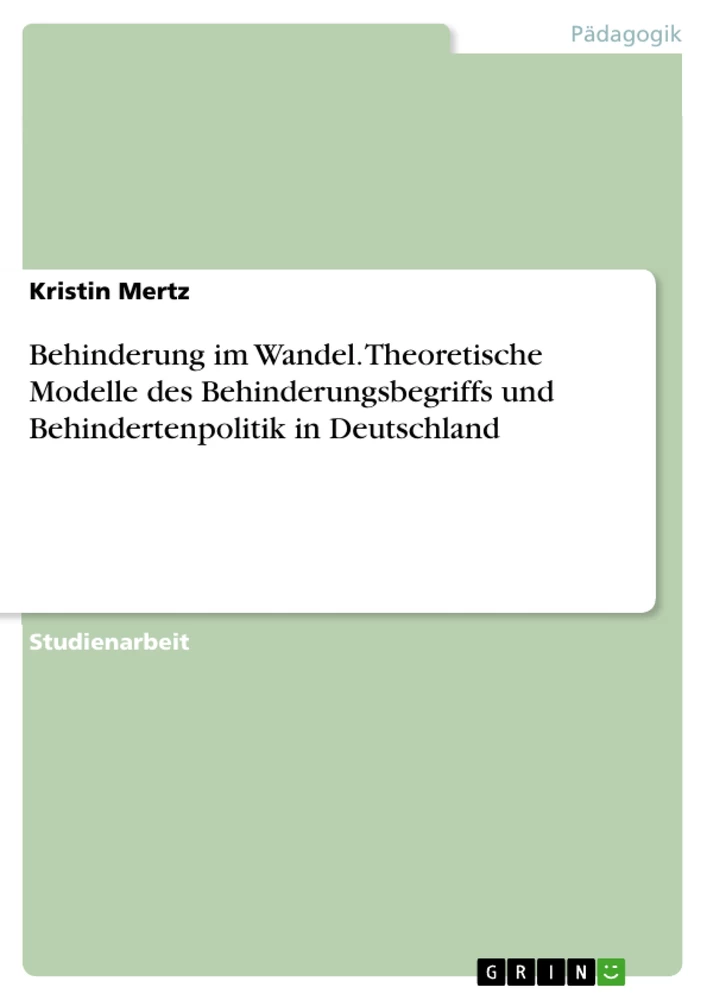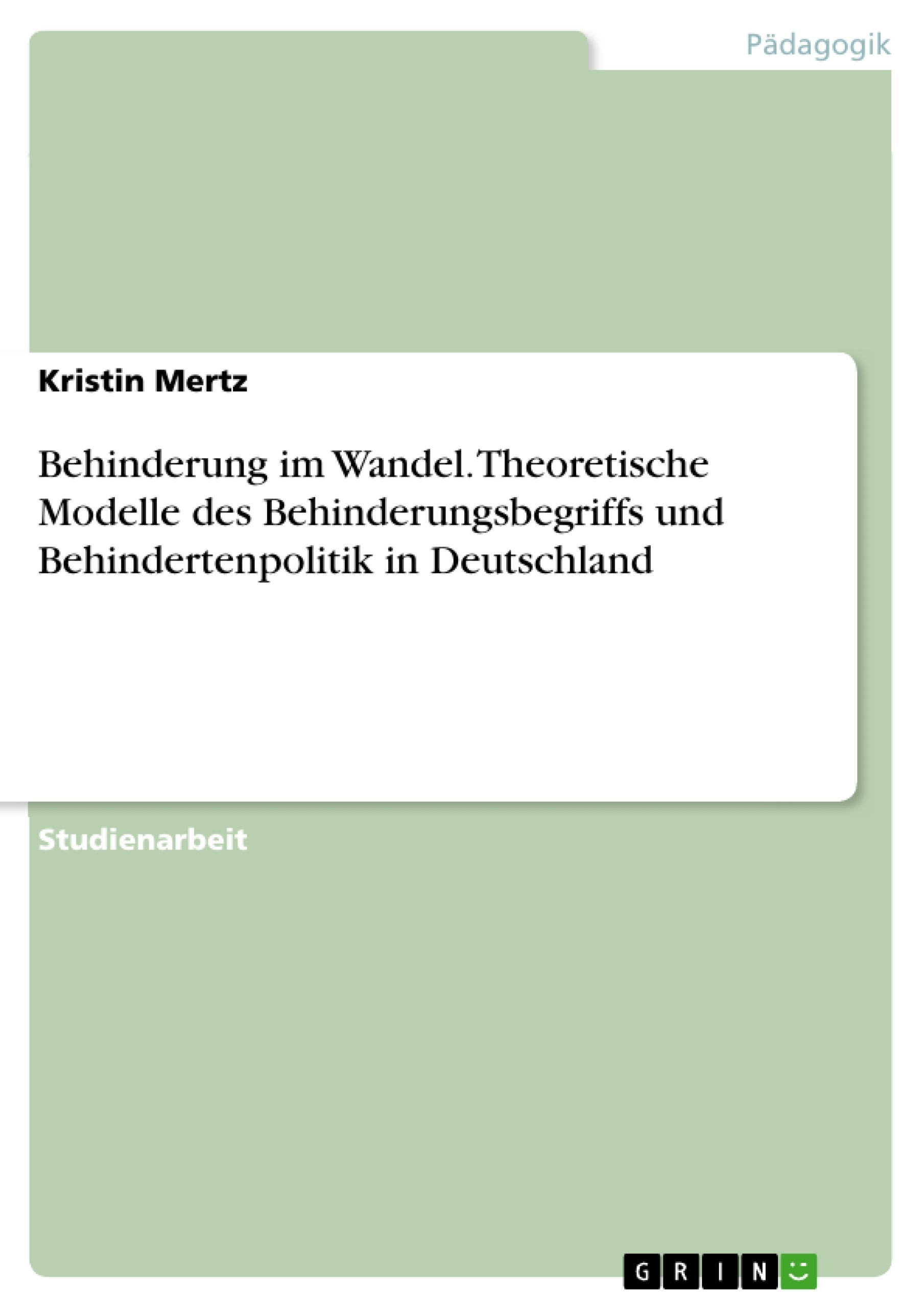Die Arbeit soll den Wandel des Begriffes „Behinderung“ und den Umgang mit diesem Phänomen menschlicher Wirklichkeit in Deutschland näher beleuchten.
Der Begriff der „Behinderung“ hat im 20. Jahrhundert einen deutlichen Wandel vollzogen. Während seit der UN - Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2008 das Paradigma der Inklusion in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und Behinderung als Facette der Normalität betrachtet wird, galt Behinderung lange als persönliche Unzulänglichkeit, welche der Fürsorge durch die Gesellschaft bedurfte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Behinderung: eine systematische Annäherung
- 2. Behinderung: Definitionsversuche
- 2.1 Behinderung aus medizinischer Sicht
- 2.2 Behinderung aus sozialrechtlicher Sicht
- 2.3 Behinderung aus pädagogischer Sicht
- 3. Entwicklung theoretischer Modelle
- 3.1 Behinderung aus individualtheoretischer Sicht
- 3.2 Behinderung aus sozialtheoretischer Sicht
- 3.3 Behinderung aus kulturwissenschaftlicher Sicht und Disability Studies
- 3.4 Kritische Würdigung der theoretischen Modelle
- 4. Entwicklung der Behindertenpolitik in Deutschland
- 4.1 Behinderung im ausgehenden 19. Jahrhundert bis 1930
- 4.2 Behinderung zur Zeit des Nationalsozialismus
- 4.3 Behinderung in den 1950er und 1960er Jahren
- 4.4 Behinderung zwischen 1970 und 1990
- 4.5 Behinderung seit 1990
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Essay beleuchtet den Wandel des Begriffs „Behinderung“ und den Umgang mit diesem Phänomen in Deutschland. Es untersucht die verschiedenen Perspektiven auf Behinderung und deren Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts.
- Definitionen von Behinderung aus medizinischer, sozialrechtlicher und pädagogischer Sicht
- Entwicklung verschiedener theoretischer Modelle zur Erklärung von Behinderung
- Historische Entwicklung der Behindertenpolitik in Deutschland
- Der Einfluss gesellschaftlicher Wertvorstellungen auf den Behinderungsbegriff
- Die Bedeutung des Inklusionsparadigmas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Behinderung: eine systematische Annäherung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und zeigt die Komplexität des Begriffs „Behinderung“. Es betont die unterschiedlichen Perspektiven und die Notwendigkeit einer systematischen Annäherung an das Thema. Die Wechselwirkung zwischen individueller Beeinträchtigung und gesellschaftlicher Teilhabe wird als entscheidender Faktor hervorgehoben, und der stetige Wandel des Begriffs im Kontext gesellschaftlicher Wertvorstellungen und wirtschaftlicher Aspekte wird angekündigt. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 und deren Einfluss auf das Verständnis von Behinderung werden ebenfalls erwähnt.
2. Behinderung: Definitionsversuche: Dieses Kapitel analysiert den vielschichtigen Behinderungsbegriff und den Mangel an einer allgemein anerkannten Definition. Es präsentiert verschiedene Perspektiven: die medizinische Sichtweise, die auf Krankheit und Defizit fokussiert; die sozialrechtliche Sichtweise, die den Anspruch auf soziale Leistungen berücksichtigt und das "Finalprinzip" erläutert; und schließlich die pädagogische Sichtweise, die sich auf die Beeinträchtigung des Lernens und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben konzentriert. Der Kapitel veranschaulicht die unterschiedlichen Schwerpunkte und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Definition von Behinderung.
2.1 Behinderung aus medizinischer Sicht: Die medizinische Perspektive auf Behinderung wird hier näher erläutert. Sie betrachtet Behinderung als ein zu heilendes Übel, orientiert sich an einem Ideal des "gesunden Menschen" und konzentriert sich auf die individuellen Ursachen der Behinderung (angeboren oder erworben). Es werden verschiedene Kategorien von Behinderungen aufgeführt, und die Möglichkeit der Quantifizierung von Behinderungen als wichtige Grundlage für politische Maßnahmen wird hervorgehoben.
2.2 Behinderung aus sozialrechtlicher Sicht: Dieses Unterkapitel beschreibt die juristische Perspektive auf Behinderung, die sich auf die Bestimmung des Personenkreises konzentriert, der Anspruch auf soziale Leistungen hat. Die sozialrechtliche Definition gemäß SGB IX wird erläutert, mit Fokus auf die Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung und gesellschaftlichen Barrieren. Das "Finalprinzip" als zentrale Grundlage der sozialrechtlichen Bewertung wird diskutiert, und die Grenzen der juristischen Definition im Hinblick auf die umfassende Erfassung des Phänomens Behinderung werden deutlich gemacht.
2.3 Behinderung aus pädagogischer Sicht: Der Fokus liegt auf der pädagogischen Betrachtungsweise des Behinderungsbegriffs, die sich mit der Beeinträchtigung von Lernen, sozialem Verhalten, Kommunikation und psychomotorischen Fähigkeiten auseinandersetzt. Der Einfluss des Deutschen Bildungsrates und dessen Definition von Behinderung aus pädagogischer Sicht wird erläutert. Die Bedeutung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als zentrales Element der pädagogischen Perspektive wird betont.
3. Entwicklung theoretischer Modelle: Dieses Kapitel (und seine Unterkapitel) dürfte sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen befassen, die versuchen, den Begriff der Behinderung zu erklären und zu verstehen (individualtheoretische, sozialtheoretische, kulturwissenschaftliche Perspektiven und Disability Studies). Eine kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Modellen und ihren Stärken und Schwächen wird erwartet.
4. Entwicklung der Behindertenpolitik in Deutschland: Dieser Abschnitt wird die Geschichte der Behindertenpolitik in Deutschland behandeln, beginnend mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und bis in die Gegenwart. Es wird erwartet, dass die Entwicklung des Umgangs mit Behinderung in verschiedenen Epochen, inklusive der Zeit des Nationalsozialismus, eingehend untersucht wird. Die unterschiedlichen Paradigmen (von der Fürsorge zur Inklusion) und ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen stehen im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Behinderung, Inklusion, Exklusion, Medizinische Modelle, Sozialrecht, Pädagogik, Disability Studies, Behindertenpolitik, Deutschland, gesellschaftliche Teilhabe, UN-Behindertenrechtskonvention, theoretische Modelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Essay: Behinderung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieses Essays?
Der Essay befasst sich umfassend mit dem Wandel des Begriffs „Behinderung“ und dem Umgang mit diesem Phänomen in Deutschland. Er untersucht verschiedene Perspektiven auf Behinderung und deren Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts, von medizinischen und sozialrechtlichen Definitionen bis hin zu pädagogischen und soziokulturellen Ansätzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der historischen Entwicklung der Behindertenpolitik in Deutschland.
Welche Perspektiven auf Behinderung werden betrachtet?
Der Essay analysiert Behinderung aus medizinischer, sozialrechtlicher und pädagogischer Sicht. Die medizinische Perspektive konzentriert sich auf Krankheit und Defizit, die sozialrechtliche auf den Anspruch auf soziale Leistungen und das "Finalprinzip", und die pädagogische auf die Beeinträchtigung von Lernen und Teilhabe. Zusätzlich werden individualtheoretische, sozialtheoretische, kulturwissenschaftliche Perspektiven und Disability Studies einbezogen.
Wie ist der Essay strukturiert?
Der Essay ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 1 bietet eine systematische Einführung in das Thema. Kapitel 2 analysiert verschiedene Definitionsversuche von Behinderung. Kapitel 3 erörtert die Entwicklung verschiedener theoretischer Modelle. Kapitel 4 behandelt die historische Entwicklung der Behindertenpolitik in Deutschland. Kapitel 5 bildet die Schlussbemerkung.
Welche Epochen der deutschen Behindertenpolitik werden behandelt?
Der Essay untersucht die Behindertenpolitik in Deutschland vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Besondere Aufmerksamkeit wird der Zeit des Nationalsozialismus und der Entwicklung von der Fürsorge zur Inklusion gewidmet.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Essay behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Behinderung, Inklusion, Exklusion, medizinische Modelle, Sozialrecht, Pädagogik, Disability Studies, Behindertenpolitik, gesellschaftliche Teilhabe, UN-Behindertenrechtskonvention und verschiedene theoretische Modelle zur Erklärung von Behinderung.
Welche Bedeutung hat die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 und ihr Einfluss auf das Verständnis von Behinderung werden im Essay erwähnt und spielen eine Rolle im Kontext des Wandels der gesellschaftlichen Wertvorstellungen und des Inklusionsparadigmas.
Was ist das "Finalprinzip" im sozialrechtlichen Kontext?
Das "Finalprinzip" ist eine zentrale Grundlage der sozialrechtlichen Bewertung von Behinderung. Es bezieht sich auf die Auswirkungen der Beeinträchtigung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Welche Rolle spielt das Inklusionsparadigma?
Das Inklusionsparadigma spielt eine wichtige Rolle im Essay und wird als zentrales Element der gesellschaftlichen Entwicklung im Umgang mit Behinderung betrachtet. Es steht im Gegensatz zu früheren Paradigmen der Segregation und Fürsorge.
Wie werden die verschiedenen theoretischen Modelle kritisch gewürdigt?
Kapitel 3 des Essays beinhaltet eine kritische Würdigung der verschiedenen theoretischen Modelle (individualtheoretisch, sozialtheoretisch, kulturwissenschaftlich und Disability Studies), die versuchen, den Begriff der Behinderung zu erklären und zu verstehen. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle werden analysiert.
- Quote paper
- Kristin Mertz (Author), 2018, Behinderung im Wandel. Theoretische Modelle des Behinderungsbegriffs und Behindertenpolitik in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1169210