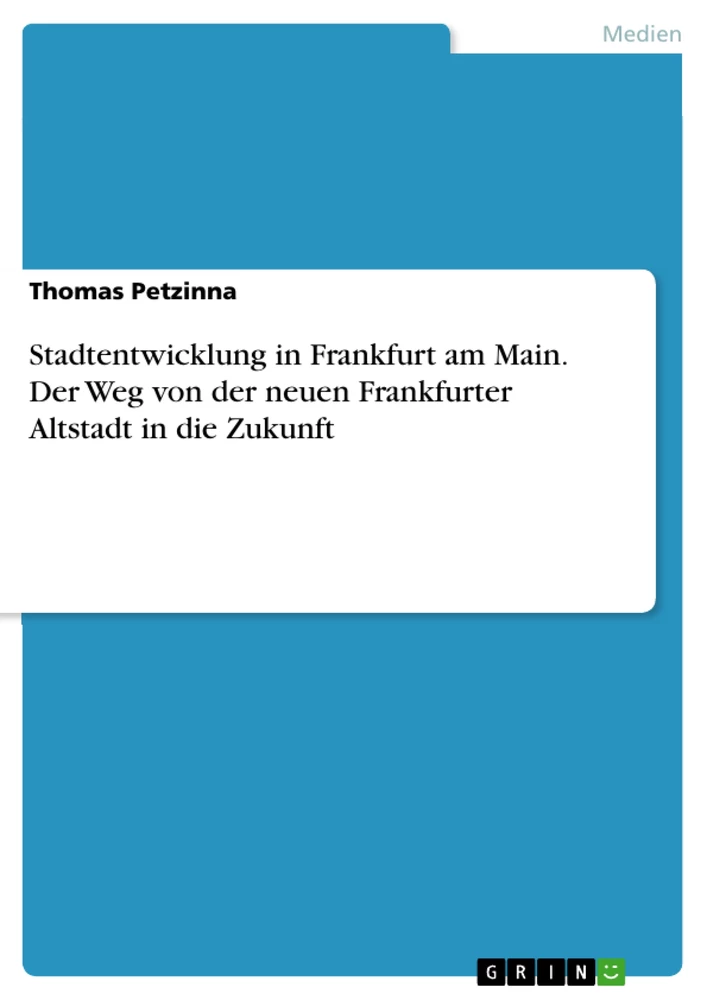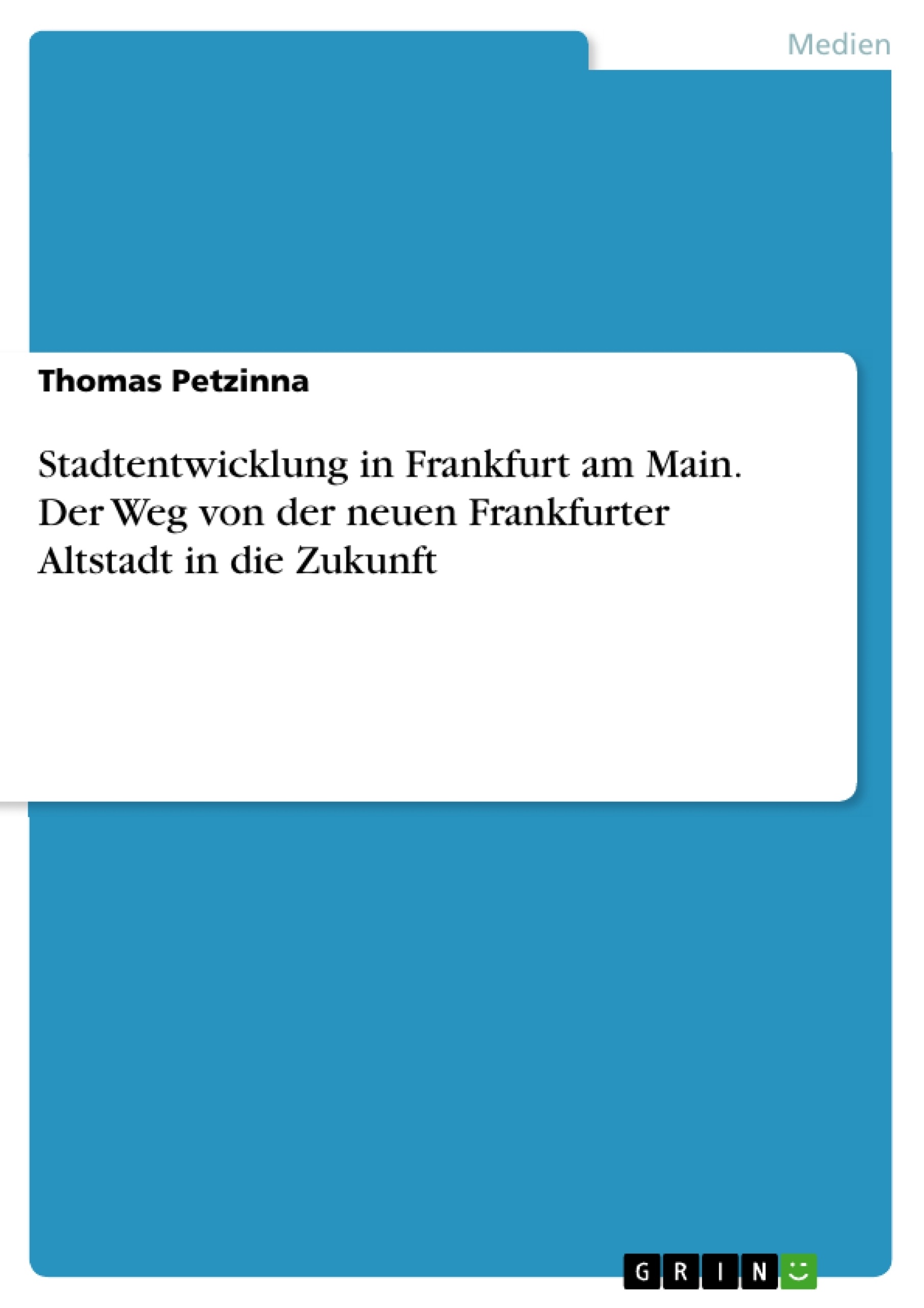Es lohnt sich, einen genaueren Blick auf die spannende Geschichte der Frankfurter Stadtentwicklung zu werfen. Im ersten Teil dieses Buches wird der Weg der Frankfurter Stadtentwicklung vom Aufkommen der klassischen Moderne bis hin zur Zeit des Nationalsozialismus und den verheerenden Kriegszerstörungen skizziert. Danach wird der Blick auf die Wiederaufbauzeit bis hin zur Rekonstruktion der Altstadt gelegt. Es wird nach und nach deutlich werden, warum sich die Menschen immer wieder nach einem intakten Stadtkern sehnten und diese Sehnsucht in den Wiederaufbau eines Teils der Altstadt mündete. Nach einer kritisch-reflektierenden Betrachtung von altstädtischer und moderner Architektur im Mittelteil werfen wir im Schlussteil des Buches noch einen Blick in die spannende Zukunft der vielschichtigen Metropole am Main.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. DIE ARCHITEKTUR DER STADT
1.1. Wahrhaftiges Frankfurt am Main?
1.2 Die moderne Tradition der Stadtzerstörung
1.3 Rationelles Bauen nach dem Ersten Weltkrieg
1.4 Der Aufbruch in die Moderne
2. DIE STADTBAUGESCHICHTE IM KONTEXT DES WIEDERAUFBAUS
2.1 Wiederaufbau als aufgelockerte, funktional-gegliederte Stadt
2.2 Neuanfang als Argument eines modernen Wiederaufbaus
2.3 Moderner Wiederaufbau im Zeichen der Wohnungs- und Materialnot
2.4 Wie Kriegstraumata den Stadtumbau beflügelten
2.5 Kriegslücken als Abrissbeschleuniger
2.6 Stadtumbau durch Entkoppelung der Besitzverhältnisse
2.7 Wie der Neuaufbau vielfach den Bürgerwillen überging
2.8 Eine Frage des Zeitgeists
3. DIE STADT ZWISCHEN NACHKRIEGSMODERNE UND REKONSTRUKTION
3.1 Die 50iger Jahre: Vom Neuaufbau zum Wirtschaftswunder
3.2 Die 60iger Jahre: Die Autogerechte Stadt
3.3 Die 70iger Jahre: Die Stadt der Großprojekte
3.4 Die 80iger Jahre: Die postmoderne Stadt
3.5 Die 90iger Jahre: Die XXL-Stadt
3.6 Die 2000er Jahre: Investorenarchitektur in der globalisierten Stadt
3.7 Die Geschichte des DomRömer-Projektes
4. Die größten Fakten und Mythen zur neuen Frankfurter Altstadt
4.1 Rekonstruktionen und die Altstadt
4.1.1 Ist mit der neuen Altstadt ein „Disneyland“ entstanden?
4.1.2 Sind Rekonstruktionen nicht eigentlich verboten?
4.1.3 War der Altstadtwiederaufbau zu teuer?
4.1.4 War die historische Altstadt ein Viertel ohne hochwertige Architektur?
4.1.5 Wurde die neue Altstadt für Touristen statt für die Bürger gebaut?
4.1.6 Hat man beim Altstadtprojekt die Expertenmeinung übergangen?
4.2 Die Altstadtlüge
4.2.1 Verklärt der Altstadtwiederaufbau die Geschichte?
4.2.2 Steht die Altstadt für Naziarchitektur?
4.3 Altstadt vs. Moderne
4.3.1 Ist die Moderne in der Altstadt zu kurz gekommen?
4.3.2 Wurde für die neue Altstadt hochwertige, moderne Architektur abgerissen?
4.3.3 Will in der engen, dunklen Altstadt überhaupt jemand leben?
4.3.4 Ist nicht eigentlich die Skyline, statt die Altstadt, identitätsstiftend für Frankfurt?
4.4 Altstadt: Resümee und Ausblick
4.4.1 Ist wirklich alles gut?
4.4.2 Die Altstadt ergänzen
5. DIE MODERNE STADT IM FOKUS
5.1. Städtebau: Der Abgesang der Nachkriegsmoderne
5.2 Nachhaltigkeit, Ortslosigkeit und Reproduzierbarkeit moderner Bauten
5.3 Moderne Bauten schützen, weil Sie schön sind?
5.4 Warum Moderne nicht gleich Moderne ist
6. KRITERIEN FÜR DIE ZUKUNFTSFÄHIGE STADT 2.0
6.1 Die Attraktivität der Stadt steigern
6.2 Kriterien für die Stadtplanung
6.3 Kriterien für die Bebauung in der Stadt
6.4 Kriterien für die Stadtbildpflege
6.5 Kriterien für die Stadtreparatur
6.6 Kriterien für die Markenbildung der Stadt
7. AUSBLICK: QUO VADIS FRANKFURT AM MAIN?
7.1 Die Weiterentwicklung der Stadt
7.2 Wohnungs- und Gewerbeflächenmangel
7.3 Die Bauwende
7.4 Die Verkehrswende
7.5 Sterbende Innenstädte: Der Weg aus der Krise
Fazit und Ausblick
Quellen- und Literaturverzeichnis
Prolog
Mit dem DomRömer-Projekt wurde 2018 die „Neue Frankfurter Altstadt“ eröffnet. Fertiggestellt wurde damit ein Jahrhundertprojekt aus Rekonstruktionen und Neubauten, welches an die bewegte Geschichte Frankfurts erinnert. Noch vor einigen Jahrzehnten war ein Wiederaufbau im Herzen der Frankfurter Altstadt in dieser Form kaum vorstellbar. Frankfurt war zu dieser Zeit als kalte Bankenstadt verschrien und galt als nicht besonders sehenswert. Fragen zum Ruf bzw. Image einer Stadt werden uns in diesem Buch an vielen Stellen beschäftigen. Das Image einer Stadt ist mitentscheidend, ob Menschen z. B. in eine Stadt ziehen, diese besuchen oder dort investieren. Frankfurt hat auf jeden Fall seine Ausstrahlung und sein Image in den letzten Jahrzehnten – auch durch den Wiederaufbau der historischen Altstadthäuser – deutlich verbessert. Neben dem Image, ist die Bekanntheit einer Stadt ein messbares Kriterium im internationalen Wettbewerb der Städte. Obwohl Frankfurt noch nicht einmal eine Million Einwohner vorweist, ist sie als Stadt eine überaus bekannte „Marke“. Neben dem internationalen Flughafen kennt man insbesondere die weitverbreiteten „Frankfurter Würstchen“ – im Ausland schlicht „Frankfurter“ genannt. Die weltweit bekannten Würste haben eine lange Tradition und stehen in direkter Verbindung mit der bewegten Frankfurter Geschichte. Ab 1562 wurden nicht nur die Könige des Heiligen Römischen Reiches in Frankfurt am Main gekrönt, sondern auch die Kaiser. Diese zogen zeremoniell in der Altstadt über den „Krönungsweg“ zu ihrer Krönung in den Dom und anschließend wieder zum feierlichen Bankett zurück in den Römer. Aus dem Gerechtigkeitsbrunnen am Römerberg floss der Wein und die Metzgerzunft drehte an diesem Festtag den Ochsenspieß für den Kaiser und das feiernde Volk. Die besagten Frankfurter Würstchen wurden dabei als „Füllsal“ zum Ochsenspieß beigegeben. An normalen Tagen wurden die Würstchen auf offenen Verkaufsständen – den so genannten „Schirnen“ – unter die Leute gebracht. Messegäste verbreiteten die praktische Wurstspeise später in der ganzen Welt. Die bekannteste Schirn befand sich in dem im 14. Jahrhundert erbauten Neuen Roten Haus. Das in der deutschen Fachwerklandschaft einzigartige, auf nur drei Holzstelzen stehende Eckhaus, markierte an einer altstädtischen Wegegabelung den Eingang zum damaligen Metzgerviertel. Über hunderte Jahre lang, stand das mittelalterliche Fachwerkhaus an dieser markanten Stelle, bevor es im Jahr 1944 im Feuersturm des Bombenkrieges verbrannte. Ausgelöscht wurde damit nicht nur das außergewöhnliche Altstadthaus, sondern auch seine jahrhundertealte Geschichte. Selbst als 1986 die Kunsthalle „Schirn“ in der Altstadt eröffnet wurde – und mit ihrem Namen an die volkstümlichen „Schirnen“ erinnerte – konnten wahrscheinlich die wenigsten Menschen etwas mit der Bezeichnung anfangen. Erst über dreißig Jahre später, mit dem DomRömer-Projekt, wurde das Haus und seine Historie wieder einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht. Das Neue Rote Haus wurde schließlich rekonstruiert und beherbergt heute wieder – wie in alten Zeiten – eine Metzgerei mit einem überdachten Verkaufsstand vor dem Haus. Dieser Ort bietet als stadtgeschichtlicher Erinnerungsbau somit einen anschaulichen “Link” in die Geschichte. Ein Ort, der durch die verheerenden Kriegszerstörungen verloren ging und der erst durch den jüngsten Wiederaufbau eines Teils der Altstadt wieder sichtbar und erfahrbar geworden ist.
Mit der Rekonstruktion eines Teils der Altstadt wurde auch die Geschichte wieder lebendig und es wurden Dinge wieder erlebbar, die ansonsten nur auf alten, schon vergilbten Postkarten zu sehen waren. Der Ort ist besonders, denn das aufgebaute Altstadtgebiet gehört zu den ältesten Siedlungsflächen Frankfurts. Der Domhügel und der Samstagsberg in der Nähe der Furt, erhoben sich als hochwassersichere Lage über die Niederung des Mainufers.1 An dieser zentralen Stelle ist die wieder aufgebaute Altstadt vielleicht auch eine Art Freilichtmuseum. Es ist sicherlich kein überflüssiges „Disneyland“, wie es manche Kritiker des Altstadtwiederaufbaus bezeichnen. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, ob der Aufbau eines Teils der Altstadt wirklich unbedingt nötig war. Immerhin hat er viel Geld gekostet und die Stadt hätte die eingesetzten Mittel zum Beispiel auch für den Bau von weiteren Schulen und Kindergärten verwenden können. Es lohnt sich also einen genaueren Blick auf das „Für und Wider“ des 2018 abgeschlossenen DomRömer-Projektes zu werfen. Viele, vor dem Wiederaufbau gestellte Prognosen, haben sich nicht erfüllt. Andere Prognosen wurden übererfüllt. Es gibt viele Mythen zum Wiederaufbau, die man ohne große Mühe mit Fakten stärken oder widerlegen kann. Hat also Frankfurt mit den rekonstruierten Bauten sein historisches Herz wiedererhalten? Oder hätte man sich den mühsamen Wiederaufbau auch schenken können? Wir werden es sehen. Im ersten Teil dieses Buches wird der Weg der Frankfurter Stadtentwicklung vom Aufkommen der klassischen Moderne bis hin zur Zeit des Nationalsozialismus und den verheerenden Kriegszerstörungen skizziert. Danach wird der Blick auf die Wiederaufbauzeit bis hin zur Rekonstruktion der Altstadt gelegt. Es wird nach und nach deutlich werden, warum sich die Menschen immer wieder nach einem intakten Stadtkern sehnten und diese Sehnsucht in den Wiederaufbau eines Teils der Altstadt mündete. Nach einer kritisch-reflektierenden Betrachtung von altstädtischer und moderner Architektur im Mittelteil, werfen wir im Schlussteil des Buches noch einen Blick in die spannende Zukunft der vielschichtigen Metropole am Main.
1. DIE ARCHITEKTUR DER STADT
Es gibt gewiss schönere Städte als Frankfurt am Main. Doch dafür kann die Stadt mit einer hohen architektonischen Vielfalt punkten: Das Repertoire reicht von herrschaftlichen Gründerzeitbauten bis hin zu emporschießenden Wolkenkratzern der Moderne. Jede Zeitepoche hat in Frankfurt ihre individuellen Spuren hinterlassen. Es ist eine schnelllebige Stadt im ständigen Wandel: Wie Berlin scheint auch Frankfurt dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein.
1.1 Wahrhaftiges Frankfurt am Main?
Wer einmal quer vom Hauptbahnhof zur Frankfurter Innenstadt läuft, der hat auf diesem Weg nahezu alle architektonischen und städtebaulichen Höhepunkte und Verfehlungen der letzten Jahrhunderte gesehen. Wie in einem Brennglas, bündelt die Stadt die unterschiedlichen Strömungen und Epochen der Baugeschichte auf einem übersichtlichen, kompakten Areal. Frankfurt bietet bereits am Eingangstor zur Stadt, dem Vorplatz des Hauptbahnhofes, ein epochenreiches Sammelsurium von stilreichen Bauten und fast stümperhaften, städtebaulichen Verunstaltungen. Lieblos gestaltet, bietet das Entree der Stadt ein hässliches Chaos aus Fahrspuren, Autoparkflächen und tristen Laufflächen für die aus dem Bahnhof herausströmenden Fußgänger. Gegenüber dem Hauptbahnhof sind große Hotels und Geschäftshäuser aus der Gründerzeit aufgereiht. Einige haben, durch Bombentreffer des Krieges, ihre krönende Spitze verloren. Über 70 Jahre später präsentiert sich dort immer noch eine verstümmelte Dachlandschaft. Auf der linken Seite wird die gründerzeitliche Historismusarchitektur durch einige triste Betonklötze aus der Nachkriegszeit gestört. Hier hat man in den Nachkriegsjahren, völlig sinnlos, dass nur wenig kriegszerstörte Jugendstiltheater Schumann und das opulente Hotel Fürstenhof Carlton abgerissen. Aber es hätte noch schlimmer kommen können: In den 70iger Jahren gab es, dem Zeitgeist entsprechend, Pläne eine neue Hochstraße vom Baseler Platz zur Messe zu bauen. Die historischen Gleishallen des Hauptbahnhofes wollte man dafür abreißen und rund um den Bahnhof Hochhäuser bauen. Dieser unsinnige und geradezu größenwahnsinnige Plan konnte sich zum Glück nicht durchsetzen. (1)
Hat der Fußgänger den chaotischen Vorplatz hinter sich gelassen und läuft durch das lebhafte Bahnhofsviertel, so findet er ein relativ geschlossenes Gründerzeitviertel vor. Wer jedoch genauer hinsieht, oder sich Fotos aus der Erbauungsphase anschaut, der sieht, dass auch hier vieles unschön verändert wurde. Bei einigen Bauten wurde im Laufe der Zeit der Zierrat abgeschlagen und die alten Türen herausgerissen. Die stilreichen Sprossenfenster wurden teilweise durch einfache Ganzglasfenster mit Plastikrahmen ersetzt, die Fensterläden herausgerissen und bei einigen Gebäuden sind die Gesimse unter dicken Wärmedämmungsplatten verschwunden. Eine Reihe von Gründerzeithäuser wurden zudem mit grellen Ladeneinbauten verstümmelt, andere wurden mit wild angebrachter Leuchtreklame „verschönert“. Es befindet sich kaum ein Gebäude auch nur annähernd im Originalzustand. Hinzu kommt eine größtmögliche Disharmonie im Verkehrsraum: Mit Aufklebern zugekleisterte Wälder von Verkehrsschildern, hässliche mit Graffiti beschmierte Stromkästen und achtlos auf den Bürgersteig abgestellte E-Scooter, machen die weitere Strecke zu einem Hindernislauf. Trotz aller Bausünden weist das Bahnhofsviertel durch seine dichte Bebauung und durch das vielfältige, gastronomische Angebot eine hohe Lebendigkeit auf.
Die Hauptschlagader des Viertels ist sicherlich die Kaiserstraße. Läuft man diese in Richtung Innenstadt, so findet man im Laufe des Weges links und rechts der Straße immer mehr Bauten aus der Nachkriegszeit. Die relative, bauliche Geschlossenheit der Gründerzeit ist jetzt endgültig vorbei. Wie an einer Perlschnur aufgereiht sieht man jetzt – zwischen einigen vereinfacht wieder aufgebauten Altbauten – eine Reihe von Bausünden aus den 60iger und 70iger Jahren. Fast die ganze Innenstadt besteht aus dieser heterogenen Mischung von wenig ansprechenden Glas- und Betonbauten. Eine überwiegend triste Nachkriegsarchitektur, wie man sie in den meisten wiederaufgebauten Städten in Deutschland sieht. Eine ganzheitlich durchdachte Stadtplanung mit gestalterischen Vorgaben, ist nicht zu erkennen. Doch selbst die relativ einheitlich in den 50iger Jahren aufgebauten Siedlungen in der südlichen Altstadt, bieten heute kaum noch eine städtebauliche Einheit oder wirken für ihre Zeit authentisch. So wurden im Laufe der Zeit bei einigen Bauten die filigranen, goldenen Fensterrahmen aus der Ladenfront herausgerissen, moderne, gläserne Aufzugstürme neben den Eingang gesetzt oder die schlichten Konstruktionen mit grotesken Dachgeschossen aufgestockt. Der diskrete Charme der 50iger Jahre ist in der Innenstadt genauso wenig zu erkennen, wie irgendeine andere Bauepoche der vergangenen Jahrzehnte.
Im Frankfurter Zentrum herrscht, baulich gesehen, ein großer Stil-Mischmasch. Eine Ausnahme in ihrer gestalterischen Geschlossenheit bietet die 2018 eröffnete Neue Altstadt: Hier ist bei einigen Rekonstruktionen, bzw. schöpferischen Neubauten, eine gute Annäherung an den dokumentierten Stand mit Stichtag 1944 gelungen. Wer den Erbauern der Neuen Frankfurter Altstadt vorwirft, dort sei eine unauthentische „Fake“-Architektur entstanden, der muss sich fragen lassen, ob andere Quartiere oder Bauten der Nachkriegszeit – die teilweise sogar unter Denkmalschutz stehen – dann nicht auch unauthentischer „Fake“ sind. Eine uneingeschränkte Wahrhaftigkeit kann es nicht geben: Jede Straße, jede Siedlung, jedes Haus, hat sich in den Nachkriegsjahren in der Stadt verändert. Nichts ist mehr so wie es ursprünglich einmal war. Frankfurt hat insbesondere durch das wilde bauliche Durcheinander im Zentrum, ein unruhiges Stadtbild mit oftmals kümmerlichen Resten traditioneller Architektur und verhunzten Nachkriegsbauten. Selbst die meisten zeitgenössischen Wolkenkratzer in der Stadt präsentieren sich nicht mehr so wie in ihrer Erbauungszeit: Ganze Foyers und Sockelbereiche sowie Fassaden haben mittlerweile durch nachträgliche Umbauten ein neues, oftmals unharmonisches Gesicht erhalten. So wird es übrigens auch der neuen Altstadt ergehen: Neben der fortschreitenden Patina werden wir in den nächsten Jahrzehnten vermutlich auch einige bauliche Veränderungen erleben. Das ist völlig normal und war schon immer so: Die Architektur ist ein sich ständig veränderndes Kontinuum in der Stadt.
1.2 Die moderne Tradition der Stadtzerstörung
Die städtebauliche Heterogenität von Frankfurt am Main ist wirklich bemerkenswert. Zugegebenermaßen hatte die Stadt nicht nur durch Kriegseinwirkungen und Nachkriegsabrisse gewaltige Veränderungen erfahren, sondern schon um die Wende zum 20. Jahrhundert begann mit der Gründerzeit ein gewaltiger Stadtumbau. Mit dem Abriss der Judengasse und dem Bau der Braubachstraße wurde tief in die Substanz der Altstadt eingegriffen. 1904 bis 1910 schlug man vom Haupt- zum Ostbahnhof, eine Verkehrsachse durch das Zentrum. Neben diesem Durchbruch wurde auch noch das Rathaus erheblich erweitert. Dort wo baugeschichtlich bedeutsame Bauten standen, wurde zwischen 1900 und 1908 der Neubau des Rathauses verwirklicht.
Doch unter dem Strich gesehen, ging natürlich die meiste Bausubstanz im Zweiten Weltkrieg und in der expansiven Nachkriegszeit verloren. Allerdings teilt Frankfurt dieses Merkmal mit vielen anderen Städten in Deutschland, die durch Kriegseinwirkung und Nachkriegszerstörung ein unruhiges Stadtbild mit fragmentierten Strukturen erhalten haben. Neben den Städten in Deutschland haben noch einige andere, im Weltkrieg zerbombte Städte in Europa – wie London und Rotterdam – ein zerfasertes Stadtbild mit einer nach dem Krieg, modern überformten Innenstadt vorzuweisen. Doch die Mehrheit der großen und kleinen Städte in Europa, haben ihr historisches Antlitz bewahrt: Wer Städte wie Barcelona, Paris oder Rom besucht, der findet dort überwiegend in sich geschlossene, harmonische Stadtbilder mit intakten baulichen Ensembles vor.
Neben den vielen Kriegszerstörungen, mussten die meisten Städte auch einige Architekturströmungen und -moden über sich ergehen lassen. Insbesondere die Vertreter der Nachkriegsmoderne, sind nicht immer zimperlich mit der historisch gewachsenen Stadt umgegangen. So finden wir Bausünden aus den sechziger und siebziger Jahren nicht nur in vielen geschichtsreichen Städten in Deutschland, sondern z. B. auch in Stockholm, Kopenhagen und Zürich. Doch auch diese europäischen Metropolen weisen insgesamt gesehen, trotz einiger Wunden, einen insgesamt harmonischen Charakter auf. Das ist erstaunlich, denn insbesondere die vor über hundert Jahren aufgekommene Moderne wollte eigentlich länderübergreifend Tabula rasa mit den traditionsreichen Städten machen. Bereits 1908, im Todesjahr des Jugendstilarchitekten Joseph Maria OIbrich, schrieb der österreichische Architekt Adolf Loos mit klein geschriebenen Buchstaben, in seinem berühmten Aufsatz „ Ornament und Verbrechen “ folgende Sätze: „Wo werden die arbeiten Olbrichs nach zehn jahren sein? Das moderne ornament hat keine eltern und keine nachkommen, hat keine vergangenheit und keine zukunft. Es wird von unkultivierten menschen, denen die größe unserer zeit ein buch mit sieben siegeln ist, mit freuden begrüßt und nach kurzer zeit verleugnet.“ (2)
Der im Aufsatz geschmähte Olbrich vollendete kurz vor seinem Tod noch den Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe in Darmstadt und zeigte damit noch einmal sein ungewöhnliches Können. 2021 wurde das Jugendstilensemble auf der Mathildenhöhe sogar zum UNESCO Welterbe erklärt. Loos und viele andere Vertreter seiner Zeit, lagen falsch mit ihrer Einschätzung, dass ornamentbehaftete Bauten bald überall verschwinden würden. Für sie waren Ornamente Vergeudung von Material, Geld und Arbeitskraft. Welche Fehleinschätzung! Die Gründerzeitbauten mit ihrem Fassadenschmuck gehören bis in die heutige Zeit zu den begehrtesten und teuersten Gebäuden auf dem Immobilienmarkt.
Der angebliche Schandfleck
Viele Bauensembles wie die erwähnte Mathildenhöhe in Darmstadt oder der Frankfurter Römer werden mit einem großen Aufwand gehegt und gepflegt. Doch Abseits von der Pflege und dem Erhalt überregional bedeutender Baudenkmäler, herrscht in Deutschland jedoch eine lange Tradition der Stadtzerstörung. Die Großstadt als ungesunder, chaotischer Moloch, der durch Ordnung und Gliederung geheilt werden muss – diese Vorstellung war bereits bei den Stadtreformern der 1920er Jahre anzutreffen. Später, ausgedrückt mit der manipulativen Sprache der NS-Zeit, wurden unliebsame Altstadtviertel dann zynisch als „ Schandfleck “ tituliert. Diese herabsetzende Rhetorik hat bis in die heutige Zeit vielfach überlebt: Immer noch jubilieren viele Politiker und lokale Medien, wenn ein angeblicher „Schandfleck“ aus dem Stadtbild verschwindet. Und so gelangen krumme, ungepflegte Fachwerkhäuser und von Eigentümern verwahrloste Gründerzeitbauten regelmäßig unter die Abrissbirne. Dabei handelt es sich oftmals um charmante, geschichtsreiche und sanierungsfähige Bauten, wie sie überall in den europäischen Städten anzutreffen sind. Keiner, weder die stolzen Bürger in diesen Städten, noch die Touristen, würden auf die Idee kommen diese reizvollen mit Patina überzogenen Altbauten abzureißen. Im Gegenteil: Viele Urlauber gönnen sich im Ausland einen Zweitwohnsitz und restaurieren dort mit viel Liebe zum Detail alte Landhäuser, Stadtchalets und heimelige Altstadthäuser. Doch in Deutschland regiert vielerorts der erbarmungslose Ordnungs- und Erneuerungswahn: In den Städten werden historische Gaslaternen abmontiert, charakteristische Kopfsteinpflaster herausgerissen und stilprägende Verzierungen von Altbauten entfernt. Die Gründlichkeit mit der Häuser insbesondere in den sechziger und siebziger Jahren entstuckt und anschließend glatt verputzt wurden, ist beispielslos. Heutzutage verschwinden stadtbildprägende Fassaden zudem hinter überbordendem Dämmmaterial. Kaum ein Land in Europa kann mit diesem gestalterischen Vernichtungswerk in den Städten mithalten.
Deutschland gönnt sich kaum ein Kleinod in der Stadt, keine krumme Altbauzeile und kein abgewohntes Haus. Glattpolieren, abreißen, moderne Kontraste einbringen: So hat man in den letzten Jahrzehnten, die letzten intakten Altbauviertel mit Gewalt in die Moderne überführt. Von den Denkmalschützern kommt oftmals wenig widerstand, wenn wieder mal ein angeblicher Schandfleck verschwindet. Alles das geschieht, obwohl nach diversen Umfragen zu urteilen, die meisten Deutschen einen Altbau einem modernen Neubau vorziehen würden. Woran liegt es also, dass so viel alte, schützenswerte Bausubstanz nicht erhalten oder saniert, sondern weggerissen wird? Es ist wohl eine besondere Mischung aus dem ständigen Veränderungswillen der Stadtplaner, dem Renditedruck der Investoren und einer tiefgreifenden Ordnungs- und Modernisierungsmentalität, die dazu führt, dass viele Altbauten für immer verschwinden. Dabei ist ressourcenschonendes Bauen mit dem Slogan „Sanieren statt abreißen“ zurzeit in aller Munde. Doch kaum einer der modernen Architekturgelehrten schreit auf, wenn z. B. ein alter Gründerzeitbau abgerissen wird. Reflexartige Proteste gibt es in der Regel nur wenn ein angeblich erhaltenswertes Betonmonster aus den 60iger oder 70iger Jahren geschliffen wird. Wer das Thema Nachhaltigkeit wirklich glaubwürdig vertreten möchte, der sollte sich nicht nur für Nachkriegsbauten, sondern auch für den Erhalt von Altstadthäusern und Gründerzeitbauten einsetzen.
1.3 Rationelles Bauen nach dem Ersten Weltkrieg
Der städtebauliche Ordnungswille ist wohl auch ein Kind der rational gesteuerten Baulehre, die besonders in Deutschland schon sehr lange präsent ist. Die Vertreter der klassischen Moderne, sahen bereits lange vor dem ersten Weltkrieg eine neue Zeit aufkommen, die die traditionelle Architektur aus den Städten regelrecht wegfegen sollte. Der rasante technische Fortschritt in dieser Zeit brachte neue, bauliche Ausdrucksformen hervor und veränderte die Städte. Doch erst der Erste Weltkrieg brachte endgültig die Grundfesten der traditionellen Weltordnung ins Wanken: Staaten verfielen, Kaiser und Könige dankten ab und viele Menschen kehrten orientierungslos aus dem Weltkrieg zurück. Die soziale Not war groß: Neben der Arbeitslosigkeit herrschte vor allem eine große Wohnungsknappheit. Funktional einfache, Material sparende, schnell ausführende Baumethoden waren nun in Zeiten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Misere gefragt. Die aus dem Krieg zurückgekehrten Architekten waren zur Stelle und setzten ihre neuen, reformistischen Pläne mit modernen Bauformen nun mit aller Gründlichkeit im damaligen Deutschen Reich konsequent um. Rational geplante Häuser und Siedlungen im Sinne eines reduzierten, industriellen Bauens gingen in Serie. Gleichzeitig wurde der überbordende Zierrat des Historismus als überflüssiges Relikt des Wilhelmismus abgelehnt. Eine neue Zeit mit einem neuen, sozialen Welt- und Menschenbild schien gekommen. Die Form sollte nun der Funktion folgen. Geniale Baumeister und Universaltalente wie Peter Behrens betraten die Bühne. Dieser verwirklichte z. B. zwischen 1920 und 1924 mit dem technischen Verwaltungsgebäude der Hoechst AG, im heutigen Frankfurt-Höchst, eine bis in die heutige Zeit beeindruckende Kathedrale des Expressionismus.
Der Siegeszug der Moderne, mit ihren funktionalen Lösungen, war in den zwanziger Jahren nicht aufzuhalten. Alleine der Begriff „ Moderne “ symbolisierte schon Fortschritt. Doch eine zunehmend, geradezu orthodox propagierte Formensprache der Moderne, wurde für einige Architekten mit ihren dogmatischen Prinzipien zu einer eigenen Religion der Erkenntnis und der Wahrhaftigkeit. Unter dem Leitmotiv der modernen Erneuerung war die Herabsetzung der traditionellen Architektur und ihrer Architekten von Anfang an ein Werkzeug von einigen selbstverliebten Modernisten. Alles was vor der Moderne gebaut war, war in dieser Denkweise altmodischer Schund, ohne Funktion und Wert. Die Existenzberechtigung der klassischen Architekturlehre wurde komplett in Frage gestellt. Ein Abriss oder Verlust der Bauten der vergangenen Bauepochen war aus Sicht der traditionsfeindlichen Modernisten begrüßenswert. Mit Schmähschriften gegen Architekturkollegen versuchten die Pioniere der Moderne in ihrem blinden Fortschrittsglauben die angebliche Rückständigkeit und Einfältigkeit der bisherigen Stadtbaukunst zu unterstreichen.1 Auch der exzentrische Vordenker des Bauhauses Walter Gropius, grenzte sich in seinen Schriften mit allen Mitteln von der bisherigen Architektur ab und propagierte eine Überlegenheit des aufkommenden, neuen Stils. In seinem Vorwort zu seinem 1925 erschienen Bauhausbuch „ Internationale Architektur “ beschwor er als Anhänger eines industriellen Bauens, das Ende der ästhetischen Architektur: „Die unerlässliche Verbindung mit der fortschreitenden Technik, ihren neuen Baustoffen und neuen Konstruktionen verlor sich in diesem Niedergang, der Architekt, der Künstler blieb, ohne die souveränen Möglichkeiten der Technik zu beherrschen, im akademischen Ästhetentum hängen, ward müde und konventionsbefangen und die Gestaltung der Behausung und der Städte entglitt ihm. Diese formalistische Entwicklung, die sich in den schnell einander ablösenden "Ismen" der vergangenen Jahrzehnte spiegelte, scheint ihr Ende erreicht zu haben.“ (3) Einer der Vordenker der Moderne, der besonders auch in Frankfurt tätige Architekt Ernst May, bezeichnete Altstadtbauten sogar einmal als „faule gotische Zähne“, die gezogen werden müssten. (4)
Eine weitverbreitete Respektlosigkeit vor den Architekten der klassischen Formensprache und vor traditioneller Architektur ist bis in die heutige Zeit zu spüren. Besonders die avantgardistischen Wegbereiter der Moderne trugen ihre neuen städtebaulichen Ideen, mit einer fast schon arrogant nach Außen getragenen Überheblichkeit vor, die abschätzig alles Dagewesene vor der Moderne verunglimpfte und als „ewiggestrige“, veraltete Formsprache abstempelte. Wer sich nicht an dem neuen, modernen Architekturkanon hielt, wer weiterhin historistisch baute, der schuf demnach nicht nur ablehnenswerte Häuser, sondern galt sogar als Gegner der neuen reformistischen Gesellschaft. Manchmal gab es bei der Umsetzung modernistischer Siedlungen auch Kollateralschäden ganz anderer Art. So baute Ernst May seine Trabantensiedlung Römerstadt im Frankfurter Niddatal und planierte dabei nicht nur einen Teil der ökologisch wertvollen Talhänge, sondern auch bedeutende Reste der antiken Siedlung Nida. (5) Doch May war nicht nur zerstörerisch am Wirken, sondern bereicherte, mit seinem 1925 bis 1930 außerhalb des Zentrums gebauten „ Neuen Frankfurt “, die Stadt mit einem umfassenden Stadtentwicklungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau. Schlichte, aber funktional durchdachte Wohnblöcke entstanden. Bei allem sozialen Eifer zogen May und seine Mitstreiter jedoch nicht selber in solche, einfachen Wohnblöcke ein. Sie bezogen attraktiv gelegene Villen am Ginnheimer Hang. Auf Grund der bevorzugten Lage und der großzügigen Wohnungsgrößen nahm die Bebauung am Ginnheimer Hang eine Sonderstellung unter den Siedlungen des Neuen Frankfurts ein. Die exklusive Wohnlage war von Anfang an dem bürgerlichen Mittelstand und einer intellektuellen Elite vorbehalten. Neben May zog u.a. der Architekt Martin Elsaesser in das Viertel. Dieser passte sein funktionales Wohnhaus mit einer charakteristischen Klinkerfassade und schneeweißen Sprossenfenstern an seine ästhetischen Bedürfnisse an. (6) Selbst die größten Verfechter der Moderne ordneten sich der Konformität ihrer entworfenen Siedlungen nicht unter.
Insgesamt gesehen bewegte sich die klassische Moderne in Frankfurt am Main auf einem hohen, gestalterischen Niveau. Gebaut wurde in dieser Zeit u.a. der Mousonturm –1 mit einer Höhe von 33 Metern, Frankfurts erstes Hochhaus welches 1926 fertiggestellt wurde. Wenig später, 1927, wurde das Hauptzollamt an der Ecke Dom-/Braubachstraße im Bauhausstil errichtet. Der Bau wurde 2006 zum Haus am Dom umgebaut. 1928 entstand die lichtdurchflutete Großmarkthalle von Martin Elsaesser, die 2010 für den EZB-Neubau teilweise mit einem modernen Querriegel durchbrochen wurde. Bis zur Machtergreifung der Nazis wurde auch noch 1928-31 das "I.G.-Farben-Haus" von Hans Poelzig errichtet – heute ein Gebäude der Goethe-Universität. Doch man machte sich auch schon in dieser Zeit einige Sorgen um die historische Bebauung in der Stadt, denn die moderne Stadtplanung verschlang mit ihren neuen Bauten aus Beton, Glas und Stahl einige alte Zeugnisse der Geschichte. Mit einer Neufassung des Ortsstatus gegen Verunstaltung wurde 1932 die Zahl der geschützten Bauwerke in der Innenstadt schließlich deutlich erweitert.
1.4 Der Aufbruch in die Moderne
Im Jahr 1933 erreichte der Siegeszug der modernen Architektur mit der proklamierten „ Charta von Athen “ seinen vorläufigen Höhepunkt. Die Ideen und Gedanken, die auf dem IV. Kongress der CIAM (Internationaler Kongress für neues Bauen) in Athen mit der Charta verabschiedet wurden, bildeten ein neues, städtebauliches Manifest mit programmatischen Thesen für die moderne Stadtplanung. Unter der Federführung des Architekten Le Corbusier wurde darin die „funktionale Stadt“ zum Leitbild für die moderne Stadtplanung erklärt. Das Leitbild beinhaltete nicht nur eine Ablehnung der dichten gründerzeitlichen Stadt, sondern einen radikalen Bruch mit allen städtebaulichen Traditionen. Wesentliche Elemente waren neben der Entflechtung der städtischen Funktionen, eine offene Bebauung sowie eine autogerechte Stadt.1 Die darin propagierte Moderne gewann im Wesentlichen ihre Kraft aus der Stadtfeindschaft. Die Stadt galt für die avantgardistischen Vordenker der Moderne als verschmutzt und unhygienisch und sollte daher „aufgeräumt werden“ und freie Fahrt für den wachsenden Automobilverkehr bieten. Die Lichtgestalt der Moderne, Le Corbusier, plante nicht nur monumentale Idealstädte, sondern träumte zugleich auch von einer Neuordnung der Gesellschaft. (7)
Die erfolgssicher auftretende, männerdominierte Architekturmoderne hatte den Anspruch, möglichst viele Bereiche des menschlichen Alltags zu durchdringen und auch idiologisch zu Wirken. Viele der revolutionären Architekten schwankten in ihrer Gesinnung zwischen Bolschewismus, Nationalismus und Demokratie. Einige verschlug es in die Sowjetunion, andere nach Indien oder Afrika. Was alle miteinander verband, waren die Ideen der Charta von Athen. Die Charta wurde mit ihren visionären Ansätzen zum unbestrittenen Leitbild der zeitgenössischen Stadtplaner und Architekten auf der ganzen Welt. Ganz im Sinne der Charta entwarfen die modernen Planer Ideen für streng gerasterte Städte mit abstrakten Solitären und monumentalen Verkehrsachsen. Doch es gab das Problem, die modernistischen Phantasien in die Realität umzusetzen, denn die Zentren der meisten europäischen Metropolen waren spätestens in den Anfangsjahren des zwanzigsten Jahrhunderts so gut wie fertiggestellt. Das in den zwanziger und dreißiger Jahren aufgekommene Modell einer aufgelockerten Stadt konnten Stadtplaner deshalb in der Regel nur noch in neuen Vorortsiedlungen verwirklichen. Erst mit den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs ließen sich die modernen Ideen auch in den historischen Kernen von bombenzerstörten Städten realisieren. Plötzlich gab es, in vorher dicht bebauten Zentren, eingeebnete Freiflächen und die radikalen Pläne einer aufgelockerten Stadt, die ansonsten vermutlich größtenteils in der Schublade verschwunden wären, wurden dann doch noch in zahlreichen Städten wie Hannover, Kassel und Frankfurt am Main nach dem Krieg verwirklicht.
2. DIE STADTBAUGESCHICHTE IM KONTEXT DES WIEDERAUFBAUS
Der Wiederaufbau nach dem Krieg, in eine scheinbar unbelastete Moderne, hat die Städte in Deutschland nachhaltig geprägt. Doch während der Wiederaufbaueuphorie wurden viele städtebauliche Fehler gemacht. Insbesondere der zweifelhafte Umgang mit dem historischen Bauerbe und die auf das Auto zugeschnittene Stadtplanung müssen kritisch hinterfragt werden.
2.1 Wiederaufbau als aufgelockerte, funktional-gegliederte Stadt
In Deutschland hatte der Zweite Weltkrieg nicht nur unsägliche Zerstörungen in die Städte gebracht, sondern auch zu einem Aderlass bei den zeitgenössischen Architekten geführt. Ein Großteil der Architekturelite wurde verschleppt, umgebracht oder ins Ausland verjagt. Der Wiederaufbau in den Städten wurde in der Folge vielfach Mitläufern und opportunistischen Karrieristen überlassen, die über alle politischen Systeme hinweg, während und nach der Nazizeit an den Schalthebeln der Stadtplanung saßen. Zudem hatte Deutschland durch den Weltkrieg eine ganze Generation von Nachwuchsarchitekten verloren, die gefallen oder in Gefangenschaft waren. Die Architektur konnte sich in diesen düsteren Jahren dementsprechend nicht weiterentwickeln und knüpfte stilistisch wieder an die Vorkriegszeit an.
Viele der in der Nazizeit tätigen Architekten und Stadtplaner, die den Krieg überlebt hatten, waren nach 1945 immer noch den städtebaulichen Planungen des Nationalsozialismus zugewandt. Hitlers Handlanger hatten nicht nur Pläne für eine monströse Reichshauptstadt „Germania“ erstellt, sondern planten auch schon für die Zeit nach dem Krieg. Barbara-Ann Rieck stellte im Tagesspiegel dazu fest: „Weniger bekannt dagegen – und das ist eine nationale Verdrängungsleistung – ist die Tatsache, dass die Grundlagen für die Wiederaufbauplanung in der deutschen Nachkriegszeit noch in Speers Behörde gelegt wurden – theoretisch und teilweise auch praktisch.“ (8) Einige bekannte Architekten wurden während des Krieges im Wiederaufbaustab von Hitlers Baumeister Albert Speer berufen und bekamen in dieser Zeit eine oder mehrere Städte für die Wiederaufbauplanung übertragen. Viele dieser selbstbewusst auftretenden Planer und Architekten fanden nach Kriegsende genau in diesen Städten eine gehobene Anstellung und führten in den Stadtbauämtern die teilweise bereits in Speers Arbeitsstab entwickelten Konzepte für funktional gegliederte, aufgelockerte sowie autogerechte Städte aus. Bereits 1944 verfassten Roland Rainer, Johannes Göderitz und Hubert Hoffmann das Buch „ Die gegliederte und aufgelockerte Stadt “, dass in einer neuen Fassung 1957 schließlich zu einem städtebaulichen Standardwerk avancierte. Der lockere Aufbau mit großen Freiflächen, sollte dabei die Stadt auch vor künftigen, kriegerischen Feuerbrünsten schützen. Die dichte, enge historische Stadt wurde damit für immer ad acta gelegt. Doch die Nachkriegsplaner wollten nicht nur neue städtebauliche Gedanken verwirklichen, sondern auch einen moralischen Neuanfang manifestieren. Die verächtliche Vergangenheit sollte abgestreift werden und ein Aufbruch in die glorreiche, unbelastete, moderne Architektur bestritten werden. Viele der damaligen Protagonisten des Wiederaufbaus, die Monate zuvor noch eifrige Helfer des Nazibaumeisters Speer waren, sprachen sogar von einem „demokratischen Aufbruch“, der mit dem modernen Stadtumbau initiiert werden sollte. So wurden die nach dem Krieg verwirklichten luftig-transparenten Gebäude für ein offenes, neues, demokratisches Deutschland oftmals auch als Weißwaschung der eigenen Biografie genutzt.
Der Neuaufbau in Frankfurt am Main
In den meisten deutschen Städten konnten die Planer, durch Enteignungs- und Wiederaufbaugesetze, nach Kriegsende städtebaulich frei planen. Auf historisch gewachsene, kleinteilige Grundstückparzellen wurde dementsprechend keine Rücksicht genommen. Auch althergebrachte Formen und Materialien wurden von den Protagonisten des Wiederaufbaus weitgehend abgelehnt. Der Neuanfang sollte auch als ein „ Bruch mit der Geschichte “ deklariert werden, ohne in irgendeiner Weise an der Zeit des Nationalsozialismus oder an der historischen Geschichte überhaupt anzuknüpfen. In dieser Gedankenwelt kamen Rekonstruktionen nicht vor. Auch in Frankfurt am Main lehnten die Vertreter der modernen Baulehre diese kategorisch ab. Es gab nur wenige Ausnahmen: Als schlichtes und zurückhaltendes Symbol des Neuanfangs wurde die Paulskirche 1948 vereinfacht wiederaufgebaut. Auch der Frankfurter Römer wurde von 1947 bis 1952 wieder hergerichtet.
Ein besonderes Kapitel ist mit dem prächtigsten Altstadtbau – dem im zweiten Weltkrieg zerstörten Salzhaus – verbunden. 1950/51 wurde, trotz guter Dokumentation und Quellenlage, das Haus nicht wieder rekonstruiert. Es wurde auch nur einen kleinen Teil der im Krieg eingelagerten Schnitzfassade des Renaissance-Hauses wieder in einen schlichten Nachkriegsneubau eingebaut. Große Originalteile, des ursprünglich um etwa 1600 errichteten Hauses, sind bis heute in den städtischen Depots eingelagert. Auf den erhaltenen Sockel des Salzhauses baute man einen Phantasiebau, der so niemals in der Altstadt stand. Mit der wilden Collage aus Alt und Neu wollte man wohl entsprechend der damaligen Expertenmeinung, den Bruch mit der Geschichte ausdrücken. Doch bedurfte es eines sichtbaren Bruchs bei diesem Frankfurter Wahrzeichen? War nicht das kriegszerstörte Frankfurt mit der völligen Auslöschung der Altstadt schon ein eindeutig sichtbarer Bruch des Stadtbildes? Das in den 50iger Jahren errichtete Salzhaus steht längst unter Denkmalschutz. Es gilt als gelungenes Zeugnis des Wiederaufbaus und steht bei vielen Kulturhistorikern und Denkmalschützern, im Gegenteil zu den Bauten der Neuen Altstadt, außerhalb jeglicher Kritik. Das ist sehr verwunderlich, denn beim Neuaufbau des Salzhauses wurde noch nicht einmal das immer wieder vorgebrachte Prinzip der modernen Denkmalpflege „ konservieren statt restaurieren “ eingehalten, denn beim Neuaufbau des Salzhauses wurde der erhaltene rückwärtige Giebel des Salzhauses samt gotischen Wandbilder abgerissen. (9) Selbst die vorhandene Substanz des geschichtsreichen Hauses wurde somit grob zerstört. Auch wenn das heutige Salzhaus insgesamt gesehen noch zu den besseren Nachkriegsbauten gehört, so hat es außer einer Ähnlichkeit in der Kubatur nichts mehr mit seinem Vorgängerbau zu tun. Es ist zu weit weg vom Original. Das heutige Salzhaus ist dementsprechend keine Sehenswürdigkeit mehr. Die wenigen wieder eingebauten Schnitzfassaden gehen in der unproportionierten und damit unharmonischen Fassade unter. Nur Experten sehen überhaupt die alten Elemente des Hauses und den gewünschten „ Bruch mit der Geschichte “. Für alle anderen Betrachter sieht das heutige Salzhaus wie ein beliebiger, simpler Nachkriegsbau aus. Ein Nachkriegsbau der sich einreiht im typischen, reduzierten Stil der Wiederaufbauzeit.1 1 1 1
Neben dem Salzhaus gab es noch andere, heftig geführte Wiederaufbaudiskussionen in Frankfurt. Ideologisch umkämpft war die Rekonstruktion des Goethe-Hauses, das 1947 bis 1951 unter erheblichen Widerstand der Stadtplaner rekonstruiert wurde. Zu den Rekonstruktionsgegnern gehörte auch Walter Dirks, Mitherausgeber der Frankfurter Hefte, der 1947 in einem Schreiben an den Magistrat dafür plädierte die Endgültigkeit der Zerstörung zu akzeptieren und den Mut „zum Abschied nehmen“ zu haben. Der Pazifist Dirks empfand eine Rekonstruktion als Täuschung, die die Spuren des Nationalsozialismus und damit der eigenen Schuld auslöschen würde. Doch das kriegszerstörte Goethe-Haus war schon lange kein authentisches Original mehr, sondern eine Rekonstruktion des Zustandes von 1756 aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (10) So gab es am Ende eine Rekonstruktion eines mehr oder weniger rekonstruierten Hauses. Neben dem Goethe-Haus wurden bis 1954 wurden zudem noch, äußerlich originalgetreu, die Katharinenkirche und die Hauptwache wiederaufgebaut. Letztere wurde 1967 beim U-Bahnbau an die heutige Position verschoben. Den Abschuss der Dekade des Wiederaufbaus bildete das gotische „ Steinernde Haus “ in der Altstadt, welches 1959 bis 1962 rekonstruiert wurde.
Doch während auf der einen Seite zaghaft rekonstruiert wurde, wurde auf der anderen Stelle ungehemmt abgerissen: Trotz der apokalyptischen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges opferten die Frankfurter Stadtplaner nach dem Krieg große Teile der noch vorhandenen historischen Bausubstanz für moderne Verkehrs- und Bauprojekte. Selbst im relativ wenig zerstörten Bahnhofsviertel wurden mehr Bauten nach dem Krieg abgerissen, als im Weltkrieg zerstört wurden. Besonders für den aufkommenden Autoverkehr waren die Nachkriegsplaner bereit, die Stadt völlig umzugestalten. Die neue, autogerechte Fluchtlinienplanung sah vor, den Verkehr nicht in einem Ring um die Stadt zu führen, sondern direkt durch das historische Zentrum zu leiten. In diesem Sinne wurde 1952/53 mit der Berliner Straße eine Verkehrsschneise mitten durch die Altstadt gelegt. Die Ruine der Weißfrauenkirche und südliche Teil des „ Großen Hirschgrabens “ sowie Reste des historischen Nürnberger Hofes wurden für die neue1 Verkehrsmagistrale willig geopfert. Ein ähnliches Schicksal ereilte die zur Predigergasse weisende, barocke Fassade des Arnsburger Hofs. Der Rest des kriegszerstörten Baus wurde mit der neuen Nord-Süd-Achse, der Kurt-Schumacher-Straße, überbaut. Obwohl Frankfurt am Main in den 50iger Jahren noch mit Ruinengrundstücken übersät war und Wohnungsnot herrschte, nahmen sich die „Modernisierer“ aus Politik und Stadtplanungsamt auch die heutige „ Fressgass “ (Kälbacher Gasse/Große Bockenheimer Straße) für eine vierspurige Straßenverbreiterung vor und rissen 1952-56 die komplette nördliche Vorkriegsbebauung ab. Der Magistrat erwarb vorab die Gebäude oder enteignete die Inhaber. Die Bebauung war großflächig angelegt und zerstörte damit auch die gewachsene Struktur des Viertels: statt 100 Läden gab es nach diesem Stadtumbau nur noch 50 Läden auf dem traditionsreichen Straßenzug. Auch in der Biebergasse wurden für diese unsinnige Straßenverbreiterung mehrere kriegsunzerstörte Altbauten auf der südlichen Straßenseite abgerissen – u.a. der großstädtische Fachwerkbau Biebergasse 10 aus dem 17. Jahrhundert. Am Goetheplatz wurde das sehenswerte Haus „ Drei Hasen “ geopfert und selbst der Opern- und Rathenauplatz wurde autogerecht umgestaltet, damit der Verkehr über die Zeil und die Freßgass zur Bockenheimer Landstraße ungehemmt „fließen“ konnte. Die ganze Abrissorgie war völlig überhastet, denn nur wenige Jahre später wandelte man die neue Schnellstraße in eine Fußgängerzone um.
Der Hass der Architekten auf die „alte Stadt“ des Kaiserreiches und des gescheiterten Deutschlands war nach dem Krieg groß. So als wenn die alten Bauten schuld am Untergang der Stadt wären, wurde das historische Bauerbe in der Folge degradiert und missachtet. Als demonstrativen Akt für die neue Offenheit der Universität ließ 1953 der Architekt Ferdinand Kramer z. B. das neobarocke Portal des Jügelbaus auf dem Bockenheimer Uni-Camus abreißen und baute stattdessen ein schlicht-modernes Hauptportal ein. Kramer war nach seiner Emigration von 1952 bis 1964 Baudirektors der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität und entwarf zusammen mit seinen Mitarbeitern insgesamt 23 Universitätsbauten. Viele seiner Bauten sind mittlerweile verändert bzw. wurden sogar abgerissen. Die meisten der noch vorhandenen Gebäude haben heute eine andere Nutzung und stehen mittlerweile unter Denkmalschutz. In den fünfziger Jahren gab es nach dem größenwahnsinnigen Nationalsozialismus nicht nur einen Hass auf die althergebrachte Stadt, sondern als Gegenreaktion auf die größenwahnsinnigen Stadtplanungen der Braunhemden auch eine neue Bescheidenheit, die architektonisch und städtebaulich ausgedrückt werden sollte. Die in der Wirtschaftswunderzeit errichteten Bauten der „ grauen Architektur “ waren in der Mehrzahl karg und funktional modern gestaltet. Doch sie hatten teilweise auch eine Maßstäblichkeit und Filigranität, die später in den sechziger und siebziger Jahren nicht mehr erreicht wurde. Einige Gebäude wurden sogar für Frankfurt stadtbildprägend, wie das 1953 erbaute Rundschau-Haus, welches 2006 abgerissen wurde. Dieses Schicksal ereilte mittlerweile einige Bauten aus den fünfziger Jahren. Trotzdem gibt es heutzutage beileibe keinen Mangel an Bauten der Wiederaufbauzeit in der Stadt. Alleine das riesige, in der westlichen Altstadt gelegene Areal zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Neue Mainzer Straße, ist von einem breiten Bestand von Gebäuden aus dieser Zeit1 geprägt.
2.2 Neuanfang als Argument eines modernen Wiederaufbaus
Die Rücksichtslosigkeit, mit der die kriegszerstörten Städte in Deutschland modern umgeformt wurden, sorgt in der heutigen Zeit für Kopfschütteln. Doch getragen von einer großen Euphorie und Aufbruchsstimmung, wollten die fortschrittsgläubigen Architekten und Stadtplaner direkt nach Kriegsende ihre Vorstellungen von einer modernen Stadt schnell und um jeden Preis verwirklichen. Es gab aber in dieser Zeit auch viele kritische Stimmen: Der Wiederaufbau von Frankfurt am Main, der ohne Rücksicht auf den historischen Grundriss der Stadt ihren modernen Stempel aufdrückte, empörte nach dem Krieg viele Bürger. Doch den Kritikern wurden ideologische Totschlagargumente entgegen geschleudert: So sei ein historisch gerechter Wiederaufbau eine Anknüpfung an die unheilvolle NS-Geschichte oder es sei eine geschichtliche Lüge, die die Tatsache der selbst verursachten Kriegszerstörung zu vertuschen versuche. Moderne Architektur stehe dagegen für einen Neuanfang, mit der die negative Geschichte überwunden werden könne. Während beispielsweise im Nachkriegs-Polen der historisierende Wiederaufbau die geschichtsträchtige polnische Identität fördern sollte, sahen die Wortführer in Deutschland durch einen modernen Wiederaufbau dagegen die Möglichkeit, die alte Identität abzustreifen und in ein neues „geschichtlich unbelastetes Zeitalter“ aufzubrechen. Zudem empfanden viele Protagonisten des modernen Wiederaufbaus in Deutschland, dass die Verleugnung des historischen Erbes eine notwendige und geeignete Form der "Sühne" aufgrund der unendlichen Kriegsverbrechen sei. Die Paulskirche ist ein Beispiel für ein Sühnedenkmal, das durch den nüchternen Innenraum die Erinnerung wachhalten soll.
In Frankfurt setzten sich, wie in vielen anderen Städten auch, die Befürworter eines modernen Neuaufbaus durch. Die historische Altstadt wurde in diesem Sinne nicht wiederaufgebaut. Viele der vorgebrachten und immer wieder propagierten, moralischen Argumente für einen radikalen Neuaufbau in Deutschland waren jedoch mehr als scheinheilig, denn oftmals spielten nach Kriegsende auch finanzielle Aspekte eine Rolle. So arbeiteten mitunter die Trümmer- und Bauschuttverwerter, Stadtvertreter, Planer und Bauunternehmer Hand in Hand, um beim modernen Wiederaufbau möglichst viel Profit zu erzielen – und da störten die zum Teil wiederaufbaufähigen Ruinen. Während historische Bauten, die nicht von "Kriegsschuld" belastet waren – und teilweise sogar von enteigneten Besitzern stammten – ungehemmt abgeräumt wurden, blieben erstaunlicherweise viele Bauten aus dem Dritten Reich nach dem Krieg in Deutschland stehen.
Mit dem gnadenlosen Abriss der alten Bausubstanz und dem erschaffen einer neuen „modernen“ Stadt, wollte man die NS-Zeit abstreifen und lenkte gleichzeitig auch von der eigenen Kriegsschuld ab. Es sollte Schluss mit dem Erinnern gemacht werden. Insbesondere die Altstadt war den Protagonisten des Wieder- bzw. Neuaufbaus ein Dorn im Auge. Doch die jahrhundertealten Altstädte waren weder ein Werk der Nazis, noch waren diese deren baulicher Ausdruck. Im Gegenteil: Die mittelalterliche Frankfurter Altstadt wollten die ideologisch verbohrten Herrscher im Dritten Reich im Rahmen einer so genannten Altstadtgesundung „ säubern “, denn hier wohnten viele Arme und Arbeiter, die mehr auf der Seite der Kommunisten als auf der Seite der Nationalsozialisten standen.1 Die Altstadt galt als ungesunder Moloch, der durch Abriss, Neuordnung und neuen Städtebau „geheilt“ werden sollte. Auch die schmuckreiche Architektur in der Altstadt gefiel den Nazis nicht. Die architektonischen Vorstellungen des NS-Regimes gingen in Richtung eines nackten Klassizismus, der keine Ornamente vorsah. Deshalb wurde auch viele Historismusbauten im Dritten Reich entstuckt, um diese „ zu entschandeln “. Auch die Frankfurter Altstadthäuser sollten glattgebügelt werden, was dann während der „Altstadtsanierung“ in den dreißiger Jahren auch an einigen Bauten vollzogen wurde.
Es gilt also immer zu Bedenken: Täter im Nationalsozialismus waren nur die betreffenden Menschen und nicht althergebrachte Bauten, die weit vor der Nazizeit errichtet wurden. Eine Kriegsschuld kann niemals mit der Beseitigung alter Gebäude und einer radikalen, baulichen Erneuerung getilgt werden. Im Gegenteil: Hier wurde auch eine gefährliche Geschichtsverfälschung betrieben. Man wollte alle Kriegsspuren der Vergangenheit gründlich beseitigen und so auch die Erinnerung an diese Zeit mit ihren unendlichen Kriegsverbrechen schnell verblassen lassen. Moderne Nachkriegssiedlungen in der Altstadt sind keine Erinnerungsorte, auch wenn das bis heute vielfach behauptet wird. Wenn es wirklich um das mahnende Erinnern an die unheilvolle Geschichte gegangen wäre, dann hätte man konsequenterweise die Altstadt nicht modern überbauen dürfen, sondern als mahnendes Trümmerfeld konservieren müssen. Doch nach dem Krieg wollte man möglichst schnell das Geschehene vergessen machen, um einen Neuanfang zu schaffen.
2.3 Moderner Wiederaufbau im Zeichen der Wohnungs- und Materialnot
Ein weiteres fadenscheiniges Argument, das immer wieder von den Befürwortern einer radikalen Neuordnung der Städte hervorgebracht wird, ist die große Wohnungsnot, die nach dem Krieg herrschte. Doch das Argument der Wohnungsnot verklärt die Leistungen des "Wiederaufbaus" nach dem Ende des Krieges. Wenn es den Planern nur um die Wohnungsnot gegangen wäre, dann hätten diese die Innenstädte verdichtet aufgebaut und es wären zudem keine erhaltenswerten und noch bewohnbaren Häuser bei der Trümmerbeseitigung mit abgeräumt worden. Gerade die Materialnot wird immer wieder als Argument für den schlichten Wiederaufbau genannt. Doch auch diese Argumentation ist nicht ganz stimmig, denn Material hätte man sparen können, wenn man viel mehr teilzerstörte Häuser wiederhergerichtet, aufgestockt und weitergenutzt hätte, statt diese abzuräumen. Die so genannte „ Trümmerbeschlagnahme-Anordnung “ vom 20. Dezember 1945 ordnete die Beschlagnahme sämtlicher angefallener Gebäudetrümmer auf dem Frankfurter Stadtgebiet an. Die Trümmer gingen mit der Beschlagnahme in den Besitz der Stadt über. Von der Beschlagnahme waren auch Gebäude betroffen, die noch standen, aber zu mehr als 70 Prozent beschädigt waren. So wurden viele Häuser gegen den Willen von vielen Frankfurter Haus- und Grundstücksbesitzer übereilig abgeräumt.
Statt einer verdichteten Stadt finden wir als Hinterlassenschaft des Wiederaufbaus in zentraler Stadtlage aufgelockerte Siedlungen mit Kamm- und Zeilenbauten sowie großen Leerräumen, Grünflächen und Autoschneisen. Dieser unnötig verschenkte Wohnraum fehlt bis heute in der von Wohnungsmangel geprägten Stadt. Lehrbuchgetreu wollten die Nachkriegsplaner die Funktionen Wohnen und Arbeiten trennen. So radierte man auch noch viele nach Kriegsende noch existierende Kleinbetriebe in den Innenstädten aus. Den Planern ging es bei dem Wiederaufbau vielfach nicht um den bestmöglichen Umgang mit den noch vorhandenen Ressourcen, sondern um die Verwirklichung ihrer schon vor Kriegsende gereiften, städtebaulichen Visionen einer dezentralen, durchgrünten „Stadtlandschaft“. Ein zentraler Leitfaden für den Städtebau der Nachkriegszeit war das 1948 vom früheren Stettiner Stadtbaumeister Hans Bernhard Reichow veröffentlichte Buch mit dem Titel "Organische Stadtbaukunst. Von der Großstadt zur Stadtlandschaft" – die bereinigte Fassung einer Publikation aus dem Jahr 1941. Die abstrakten Reißbrettplanungen der Nachkriegszeit waren oftmals auch ökonomisch gesehen unsinnig, denn diese nutzten die vorhandenen, infrastrukturellen Ressourcen nicht. Dort wo einst voll erschlossene Straßen verliefen, waren nach dem Krieg unter den Trümmerbergen noch viele Unterkellerungen vorhanden und zudem die Rohrleitungen größtenteils noch intakt. Den Wiederaufbauplanern war das egal: Sie zeichneten auf ihren grobschlächtigen Plänen ganze Straßen und Quartiere völlig neu, so, als wenn sie diese auf eine noch nie bebaute, grüne Wiese setzen würden.
Es ist ein weit verbreitetes Ammenmärchen, dass unsere wiederaufgebauten Innenstädte so hässlich sind, weil nach dem Krieg ein großer Mangel herrschte. Unmittelbar nach dem Krieg herrschte natürlich eine unendliche Materialnot, so dass die Menschen in provisorisch errichteten Behelfsunterkünften untergebracht wurden. Bekannt geworden sind z. B. die so genannten Nissenhütten aus Wellblech. Doch in der unmittelbaren Aufbauzeit der fünfziger Jahre gab es schon wieder ausreichend Baumaterial. So wurden von dem von den Trümmerverwertungsgesellschaften wiederaufbereiteten Schutt z. B. Millionen Voll- und Hohlblocksteine hergestellt. D.h. die Stadt wurde quasi aus ihrem eigenen Trümmerschutt wieder errichtet. Die meisten Häuser in den 50iger Jahren waren sparsam und schlicht gehalten. Doch es ging bei der Gestaltung nicht nur darum Material zu sparen, sondern es war auch der Baustil der Zeit, die Häuser mit schmucklosen Fassaden zu gestalten. Selbst bei der Debatte um das Goethe-Hauses in Frankfurt ging es den Rekonstruktionsgegnern nicht um den Materialverbrauch, sondern um die angebliche „ Geschichtskittung “, die mit einem originalen Wiederaufbau einher gehen würde. Sehr interessant ist auch die Nachkriegsgeschichte der Katharinenkirche. Beim 1954 abgeschlossenen Wiederaufbau entschied man sich, entsprechend dem Lebensgefühl der 1950er Jahre, bewusst für eine schlichte, karge Ästhetik des Innenraumes. Auch bei dieser Entscheidung spielte der Materialmangel kaum eine Rolle.
Die Rekonstruktionen in den Nachkriegsjahren beschränkten sich zumeist auf Kirchenbauten. Bei diesen wunderbaren Wiederaufbauleistungen sieht man, dass im Nachkriegsdeutschland der handwerkliche Sach- und Fachverstand für Rekonstruktionen vorhanden war und wenn der Wille da war auch genügend Geld und Material bereitgestellt wurde. Spätestens in den 60iger Jahren, gab es in Deutschland wieder eine von Wohlstand gezeichnete Wirtschaft und einen Materialüberfluss – doch auch in dieser Architekturperiode knüpfte man, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr an die qualitätsvolle Baukultur früherer Zeiten an. Die Materialnot der Nachkriegsjahre ist also nicht an der städtebaulichen Misere der deutschen Innenstädte schuld. Nicht zuletzt muss man beim Thema Materialnot auch auf die Wiederaufbauleistung von Polen verweisen. In den zerstörten Städten gab es eine noch größere Material- und Finanznot als in Deutschland und trotzdem wurden dort nach dem Krieg viele Altstädte liebevoll rekonstruiert.
2.4 Wie Kriegstraumata den Stadtumbau beflügelten
Die verheerenden Folgen des Luftkriegs sind ein weitgehend unverarbeitetes und tabuisiertes Trauma der Kriegsgeneration. Auch die deutsche Nachkriegsliteratur hat sich vor einer Thematisierung des Bombenkriegs in den Städten, weitgehend gedrückt wie bereits der Literaturhistoriker W.G. Sebald Ende der 90iger Jahre in seinen Veröffentlichungen anmerkte. (11) Durch das Verdrängen und Verschweigen der Weltkriegszerstörungen, herrscht vielfach ein Unwissen in der Gesellschaft. Viele Bürger und Besucher der Städte in Deutschland wissen nicht, wie schön diese vor den Zerstörungen einmal aussahen. Da auch in den Städten selbst oftmals wenig über die Ausmaße des Luftkriegs informiert wird, nehmen viele Menschen das banale Nachkriegsstadtbild der Städte als unveränderbar und gegeben hin.
Fest steht, dass die Erlebnisse der Bombennächte den Blick der Kriegsgeneration auf die Stadt verändert hat. Insbesondere die Auswüchse der Stadtzerstörungen in der Nachkriegszeit sind mit Sicherheit auch ein Ausdruck der traumatischen Bewusstseinsstörung, die die Kriegsgeneration in der Folge des Zweiten Weltkriegs davongetragen hat. Der Bombenkrieg hat die Überlebenden, darunter natürlich auch Architekten und Stadtplaner, nachhaltig traumatisiert. Die bedingungslosen Zerstörungen des Weltkrieges und die kompromisslosen Aufräumarbeiten während der "Enttrümmerung" haben zudem vielfach ein fragmentiertes Stadtbild und damit einhergehend eine Egalität bei den Menschen hinterlassen. Die Menschen im Land haben also eine ausgeprägte Erfahrung, ihre kulturellen Schätze zu verlieren. Wer täglich in den Städten den Bombenkrieg mit brennenden Häusern, Feuerstürmen und einstürzenden Ruinen erlebt hat, für den sind die Häuserabrisse in der Nachkriegszeit leicht hinnehmbare, fast emotionslos hingenommene Bagatellschäden. Gerade viele Architekten mit Kriegserfahrungen, hatten nach dem Krieg nur ein Achselzucken übrig, wenn die Abrissbirne mal wieder geschwungen wurde. Ein sensiblerer Umgang mit dem vielschichtigen Stadtgefüge zog erst Mitte der 70iger Jahre wieder in die Städte ein. Eine neue Generation, ohne traumatische Kriegserfahrungen, bestimmte in dieser Zeit zunehmend den städtebaulichen Diskurs und sorgte in der Folge für einen nachhaltigerer Umgang mit der Baukultur.
2.5 Kriegslücken als Abrissbeschleuniger
In "kriegsverwundeten" Städten ist es wesentlich leichter weitere Eingriffe, z. B. für ein neue Autotrassen oder für Neubauprojekte vorzunehmen, wie in intakten Städten. Die Hemmschwelle für Stadtzerstörungen liegt bei Planern, Stadtverordneten und Bürgern in kriegszerstörten Quartieren viel niedriger, als in historisch unversehrten Stadtvierteln. Es reicht, wenn in einer geschlossenen Altbauzeile ein einziges Haus fehlt. Wird an dessen Stelle ein moderner Neubau eingefügt, so ist bei Nachbarbesitzern die Versuchung groß ebenfalls ihren Altbau durch einen zumeist großvolumigen Neubau zu ersetzen. Ein Domino-Effekt für Veränderung und Eingriffe in die Bausubstanz entsteht. Fehlen gleich mehrere Altbauten oder sogar ein prägnanter Eckbau in einer Straße, so opfert man auch schnell die weiteren Altbauten, z. B. für ein Straßenbauprojekt. Steht nur noch ein einziger Altbau in einer Straße, so ist das Schicksal dieses Hauses so gut wie besiegelt: Häufig wird dieses früher oder später auch noch weggerissen. Als Argument wird in solchen Fällen oftmals vorgebracht, dass es kein Ensemble mehr bietet und beziehungslos und singulär zwischen den modernen Bauten steht. Wenn dagegen ein völlig geschlossenen Altbauquartier vorliegt, so werden Altbauten meistens nicht angetastet bzw. durch Neubauten ersetzt. Der Widerstand den Bestand nachhaltig zu verändern wäre zu groß. Man sieht dieses Phänomen in historisch geschlossenen Stadtkernen z. B. in Frankreich, den Niederlanden und in Italien, wo geschlossene Altbauquartiere weniger angefasst werden, wie Viertel, die bereits modern überformt sind.
Dasselbe Phänomen ist bei der modernen Umgestaltung von Gebäuden zu sehen. Wird z. B. bei einem intakten Altbau die historische Haustür herausgerissen und gegen eine moderne Eingangstür getauscht, so ist es nicht weit her, später auch weitere Elemente des Hauses zu verändern. Meistens werden dann auch irgendwann die Sprossenfenster durch Plastikfenster ersetzt und wenn dann irgendwann der Gebäudeschmuck nur noch Stückwerk ist, die Fassade mit energetischer Sanierung endgültig glattgezogen. Zwischenzeitlich wendet sich dann auch der Denkmalschutz wegen mangelnder Originalbausubstanz von dem alten Gebäude ab und einer weiteren Zerstörung des Hauses kann nichts mehr entgegengesetzt werden. Es tritt ist ein sich selbst verstärkender Effekt ein: Wenn schon etwas kaputt ist, dann kann der Rest ja auch noch zerstört werden. Die Verwahrlosung ganzer Stadtteile fußt auf dieser „Broken Windows“-Theorie bei der eine zerbrochene Glasscheibe an einem Haus zu vielen weiteren Zerstörungen im Wohnviertel führt. Der beste Schutz vor Abrisswahn und Zerstörung sind baulich geschlossene und gepflegte Ensembles. Die Hemmschwelle diese intakten Quartiere zu zerstören ist besonders hoch. Bei diesen harmonisch gewachsenen, unversehrten Ensembles können auch die Immobilienbesitzer und Politiker am ehesten dem Veränderungsdruck widerstehen.
2.6 Stadtumbau durch Entkoppelung der Besitzverhältnisse
Entscheidend für die brachiale Umsetzung der Stadtumbaupläne in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht nur der plötzliche „Reichtum“ an Freiflächen und die ideologische Untermauerung des "Neuanfangs" per moderner Architektur, sondern – und das ist entscheidend – die „Entkoppelung der Besitzverhältnisse". So waren nach dem Krieg riesige Stadtplanungsflächen, nicht zuletzt bedingt durch Arisierungen von jüdischem Grundbesitz, in öffentlicher Hand und damit für die Planer frei verfügbar. Alteingesessene Hauseigentümer und Mieter waren entwurzelt und verarmt, oder wurden Opfer des Vernichtungskriegs. Die Verantwortlichkeit über viele Häuser und Grundstücke lag demnach nicht mehr bei den ursprünglichen Eigentümern und Mietern, sondern vielfach bei städtischen Aufbaugesellschaften oder anderen Nachkriegsinstitutionen. Die Planungshoheit oblag dabei alleine bei der Stadt. Von 1945 bis 1952 verhängte der Frankfurter Magistrat sogar einen Baustopp für private Eigentümer. Wer z. B. sein Altstadthaus wieder aufbauen wollte, der durfte es nicht. Viele Parzellen wurden für die weitere Planung zu größeren Grundstücken zusammengelegt und es gab zudem eine große Anzahl von Enteignungen. Die Stadt Frankfurt tat sich bei Enteignungen besonders hervor, so dass dieses Vorgehen in der Nachkriegszeit sogar als „Frankfurter Weg“ tituliert wurde. Enteignet wurde für öffentliche Bauvorhaben und vor allem für Straßendurchbrüche und Verbreiterungen und Parkplätze, um die Stadt „ autogerecht “ umzubauen. Grundstücke, die alteingesessenen Familien gehörten, wechselten in der Wiederaufbauzeit in großer Anzahl den Besitzer. Diese Entfremdung vom Besitz, machte in der Folge auch erst die Stadtzerstörung, z. B. im bürgerlichen Frankfurter Westend Anfang der siebziger Jahre, möglich. Hier wurden sogar noch Spekulanten als Aufkäufer der Immobilien zwischengeschaltet, so dass es quasi keine Verbindung mehr von den ursprünglichen Besitzern hin zu den Verantwortlichen der Abrisse gab. So wird klar: Nur eine Stadt, die den Bürgern gehört, kann sich vor den Auswüchsen einer Stadtzerstörung wirksam schützen.
Die Anonymität der Besitzverhältnisse im Nachkriegsdeutschland macht, bis in die heutige Zeit, erst die Abrisspolitik in unseren Großstädten möglich. Die Tilgung vieler Nachkriegsbauten ist dementsprechend oftmals nicht der kühlen Kalkulation von Alteigentümern geschuldet, sondern entstammt hauptsächlich der Entfremdung bzw. nicht vorhandenen Verbundenheit von neuen Eigentümern zu ihren Immobilien. Generationsübergreifender Besitz stiftet Identifikation und Heimatbewusstsein. Wer mit seiner Immobilie über Jahrzehnte als Besitzer oder Mieter verwurzelt ist, der kümmert sich in der Regel auch um sein zu Hause. Dieses hohe Verantwortungsbewusstsein ist in den meisten europäischen Städten größtenteils noch vorhanden – in Deutschland aufgrund der beschriebenen, wirren Nachkriegsfolgen der Eigentumsverhältnisse jedoch oftmals nicht mehr vorfindbar. In den deutschen Städten wurde, in Folge des zweiten Weltkrieges, die ursprüngliche Bevölkerung mit ihrem Immobilienbesitz fast komplett ausgetauscht. Diese Entkoppelung der Besitzverhältnisse hat in der Folge zu einer fragmentierten Stadtentwicklung geführt.
Gerade auch in der heutigen, schnelllebigen Zeit findet wieder eine fortschreitende Anonymität und Distanziertheit im Umgang mit Immobilien statt: Internationale Fonds mit Anlegern aus der ganzen Welt investieren in zumeist großflächige Immobilienprojekte in den aufstrebenden Städten rund um den Erdball. Die Anleger wissen zum Teil nicht einmal, wie die im Portfolio aufgeführten Immobilien in der Realität aussehen. Viele Anlageobjekte sind noch nicht einmal bewohnt, sondern dienen nur dem Wertzuwachs. Wo globale Gesellschaften als Immobilienbesitzer keinen Bezug mehr zum örtlichen, historischen Baubestand haben, muss der Denkmalschutz eingreifen. Doch auch dem Denkmalschutz sind oftmals die Hände gebunden, oder er greift nicht zu genüge ein. Nur mit strengen Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen kann sich daher eine Stadt vor großflächigen Zerstörungen der gewachsenen Bausubstanz, durch globale, anonym agierende Investoren schützen.
2.7 Wie der Neuaufbau vielfach den Bürgerwillen überging
Die Wegbereiter der klassischen Moderne und die Akteure des modernen Wiederaufbaus hatten eine große Gemeinsamkeit: Sie waren mit einem unerschütterlichen Selbstvertrauen ausgestattet. Die Stadtplaner und Architekten waren sich nach dem Krieg sicher, dass die Umsetzung ihre Wiederaufbaupläne, den Menschen ein besseres Leben bereiten würden. Ein Diskurs, mit einer Mitbestimmung der Stadtbewohner, war dabei nicht erwünscht. Autoritär und angeblich alternativlos wurden die meisten Pläne in den kriegszerstörten Städten durchgesetzt. Schon im Zeitalter der Bauhaus-Architektur sollten nicht die individuellen Bedürfnisse der Hausbewohner der Maßstab sein, sondern die konstruierten Modelle der Architekten mit ihrer Vorstellung eines „ neuen Menschen “. Bei den radikalen Nachkriegsplanungen spielte sicherlich auch das große Ego der Stadtplaner eine Rolle. Welcher Stadtplaner hat schon während seines Berufslebens, die Möglichkeit eine Innenstadt auf dem Reißbrett komplett neu zu planen? Dazu musste schon viel Unheil über eine Stadt kommen. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es in den ausgelöschten Innenstädten diese einzigartige Chance für die Stadtplaner. Doch die Planer begnügten sich nicht damit im Feuersturm vernichtete Quartiere neu zu planen, sondern zogen auch unzerstörte Areale in ihre Planung mit ein. Heraus kamen abenteuerliche, größenwahnsinnige Stadtvernichtungsorgien, die an Le Corbusiers 1925 nicht verwirklichte Pläne für ein neues Paris erinnerten. Sein Plan Voisin sah den Flächenabriss großer Teile des alten Pariser Zentrums rechts der Seine vor. An deren Stelle wollte er 18 locker und regelmäßig angeordnete sechzigstöckige Hochhäuser setzen. Von den inhumanen Auswirkungen der Hochhaussiedlung wäre Le Corbusier unberührt gewesen. So war es immer: Keiner aus dem erlauchten Kreis der Stadtplaner musste je selber in eine der Wohnungen in den oftmals tristen Trabentenstädten einziehen. Die Menschen die es betraf, wurden bei den großspurigen Planungen nie gefragt.
Auch in Frankfurt wurde im Laufe des Wiederaufbaus der Bürgerwille immer wieder übergangen. Einige wenige Planer und Stadtverordnete bestimmten, wie die die Stadt wiederaufgebaut werden sollte. Die Bürger hatten in der Regel kein Mitspracherecht. Ein eigener Wiederaufbau des zerstörten Eigentums wurde wie beschrieben untersagt. Erst 1952 wurde die bereits 1945 verhängte Bausperre für die Altstadt aufgehoben und es startete dann der moderne Aufbau durch die Stadtplaner, der in den Grundzügen bereits 1954 erledigt war. Für den Wiederaufbau der Altstadt gab es keinen Gesamtplan: Es entstand somit ein hastig aufgebautes mit Grünflächen aufgelockertes Innenstadtviertel, welches mit den Achsenstraßen Kurt Schumacher und Berliner Straße durchschnitten wurde. Nach Enteignungen und freihändigen Übertragungen an die Stadt unter deren Regie der FAAAG (Frankfurt Aufbau AG) wurde auch die Altstadt zu einem überwiegend modernen Neubauviertel umgestaltet. Die architektonischen Vorstellungen vieler Stadtplaner haben auf massive Art und Weise die Bedürfnisse und Initiativen vieler Bürger beim Wiederaufbau der Städte übergangen. Statt wie eigentlich von den Stadtplanern gewünscht, die zurückliegende "Gleichschaltung" des Nationalsozialismus mit Modernität aufzubrechen, wurde faktisch nach dem Krieg eine modern-gleichförmige Architektursprache etabliert. Gerade in Frankfurt wurden viele Nachkriegsbauprojekte gegen den Willen der Bürger errichtet. Nur engagierten Bürgern ist es zu verdanken, dass in der Stadt überhaupt noch historische Spuren zu finden sind. Partizipation und Mitbestimmung sind wichtige Elemente um große Bauprojekte zum Erfolg zu führen. Die Bürger sollten daher von Anfang am Planungsprozess beteiligt und deren Willen berücksichtigt werden. Schließlich gehört die Stadt nicht nur Investoren und Politikern, sondern in erster Linie den Bürgern.
2.8 Eine Frage des Zeitgeists
Bei allen Protesten gab es natürlich nicht nur Gegner eines modernen Wiederaufbaus. Die Sicht auf die nach dem Krieg neu geformte, moderne Stadt ist auch eine Frage des jeweiligen Zeitgeists und der jeweiligen Generation. Wer in den 50iger oder 60iger Jahren aufgewachsen ist, der kennt nur die neu aufgebaute Stadt, die in der Aufbruchszeit als modern galt und auf der man auch stolz war. Die Kaufhäuser hatten ihre Blütezeit und die großzügigen Leuchtreklamen lockten die Menschen in die Geschäfte. Es war vielleicht auch ein beschwingtes Gefühl mit dem hart ersparten Automobil in der Wirtschaftswunderzeit die großzügig gestalteten Straßen und aufgeräumten Plätze in der Stadt zu befahren. Heute hat sich das Lebensgefühl gewandelt. Wer täglich in der Stadt im Stau steht, der empfindet die autogerechte Stadt als Farce. Die eintönigen Zeilenbauten der Nachkriegszeit gelten nicht unbedingt mehr als Chic. Die traumatisierte Aufbaugeneration, die das Aussehen der Städte bis heute geprägt hat, ist größtenteils weitergezogen. Viele Leben heute im Grünen, in den Vororten, oder auf dem Land. Die neu hinzugezogene Generation hat ihr eigenes Bild von der Stadt und möchte diese verständlicherweise auch in ihrem Sinne nachhaltig, schön und lebenswert gestalten.
3. DIE STADT ZWISCHEN NACHKRIEGSMODERNE UND REKONSTRUKTION
Bis zu der Rekonstruktion eines Teiles der Frankfurter Altstadt war es ein langer Weg. Schauen wir im nächsten Kapitel noch einmal auf die zurückliegende Stadtbaugeschichte. Nach der Zeit des Neuanfangs in den 50iger Jahren wurde die Stadt in den 60iger und 70iger Jahren immer mehr an die Bedürfnisse des Automobilverkehrs ausgerichtet. Darüber hinaus wurde nach dem Krieg, für die wachsende Finanzmetropole, eine beeindruckende Skyline erschaffen.
3.1 Die 50iger Jahre: Vom Neuaufbau zum Wirtschaftswunder
Es lohnt sich, noch einmal einen genaueren Blick auf die reichhaltigen Bauaktivitäten in Frankfurt zwischen der Neuaufbau- und der Wirtschaftswunderzeit zu werfen. In den 50iger Jahre drehten sich nicht nur unentwegt die Betonmischer für neue Wohnungen und Geschäftshäuser, sondern auch für die ersten Vergnügungsstätten. Die Menschen in der Stadt waren nach dem Krieg hungrig nach Kultur und so wurde beispielsweise bereits 1950 der Turmpalast eröffnet. Der ansehnliche Kinobau wurde leider 2012 abgerissen. 1951 wurde das markante Junior-Haus am Kaiserplatz mit dem gläsernen Treppenhaus seiner Bestimmung übergeben. Der Architekt der damaligen Autoverkaufshalle, Wilhelm Berentzen, war auch für die Errichtung des 1953 erbauten Rundschau-Hauses am Eschenheimer Tor verantwortlich. Letzteres wurde 2006 leider auch dem Erdboden gleich gemacht. Der Platz rund um das Eschenheimer Tor war eines der „Schaufenster“ für die aufstrebende Stadt in den 50iger Jahren. Bekannt ist z. B. auch das 1952 mit seinem auskragenden Dach errichtete Bayerhaus und das ehemalige Fernmeldezentrum mit dem 69 Meter hohen Fernmeldehochhaus, welches trotz Denkmalschutz 2005 abgerissen wurde. Bis zur Errichtung des Fernmelderiesen 1954 war das AEG-Hochhaus am Sachsenhäuser Mainufer mit 45 Metern das höchste Gebäude in der Mainstadt. Doch auch dieses Hochhaus hatte keinen langen Bestand: 1999 wurde der 1951 errichtete Büroverwaltungsbau weggerissen. Es gibt allerdings auch noch einige Bauten aus den 50iger Jahren, die noch heute vorhanden sind, wie z. B. das 1954 erbaute Bienenkorbhaus an der Konstablerwache, das ehemalige US-Generalkonsulat an der Siesmayerstraße, dass "Amerika Haus" (heute Instituto Cervantes) in der Staufenstraße und das 1955 fertig gestellte Apartmenthaus in der Fahrgasse 26. Mit 33 m war das Apartmenthaus wohl das erste gemischte Wohnhochhaus in der Stadt. Man könnte noch viele weitere Bauten aus dieser Zeit aufzählen, wie den inzwischen zum Teil zurückgebauten ehemaligen Bundesrechnungshofs an der Berliner Straße oder die 1954 nach Kriegsverlust neu errichtete Kleinmarkthalle, die sich bis zum heutigen Tag einer großen Beliebtheit in der Stadt erfreut.
Besondere Freude machte auch Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft 1959. Die 50iger Jahren waren also ein ganz gutes Jahrzehnt für die Frankfurter Bürgerschaft. Die Stadt hatte sich von den ungeheuren Kriegszerstörungen erholt und schöpfte neue Kraft als wieder auferstandene Finanzmetropole. Bereits 1947, nach der Gründung der Bizone, wurde der Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in der Stadt ansässig. 1948 wurde dann die Bank deutscher Länder von den alliierten Besatzungsmächten gegründet. Dieses übernahm die Funktion der früheren Berliner Reichsbank als Zentralbank für die 1949 aus der Taufe gehobene Bundesrepublik Deutschland. 1957 wurde diese durch die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Bundesbank abgelöst. Die Nähe zur Notenbank veranlasste weitere Bankinstitute dazu, ihre Geschäfte in der Stadt zu konzentrieren. Neben dem Bankensektor florierte auch wieder der Frankfurter Flughafen in der Wirtschaftswunderzeit. Mit dem Wachstum des zivilen Flugverkehrs wuchs der Flughafen in alle Richtungen. In den 50iger Jahren erlebte die Stadt ihr großes Comeback als Finanz- und Wirtschaftsmetropole sowie als herausragendes Verkehrsdrehkreuz.
3.2 Die 60iger Jahre: Die Autogerechte Stadt
Die 60iger Jahre rückten stadtplanerisch noch mehr die Belange des Automobils in den Fokus. 1959 verfasste Hans Bernhard Reichow unter dem Titel „ Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos “ ein radikales Manifest, das zum Sinnbild für den „verkehrsgerechten“ Städtebau der 60iger Jahre wurde. In einem regelrechten Abrisswahn baute man entsprechend die Städte für die Bedürfnisse des Automobilverkehrs um. Auch in Frankfurt am Main tobten sich die autofreundlichen „Stadterneuerer“ in den sechziger Jahren aus. Im Stadtteil Sachsenhausen schlug man 1963 die überbreite Walter-Kolb-Straße durch das Viertel, die bis heute den Stadtteil in zwei Teile trennt. Zahlreiche Altbauten fielen für diese Verkehrsschneise der Spitzhacke zum Opfer und der weitgehend vom Krieg verschonte Stadtteil büßte damit einen großen Teil seines noch erhaltenen Charmes ein. Das Auto war in den 60iger Jahren der Maßstab aller Dinge. Wer sich heute alte Bilder aus Frankfurt aus dieser Zeit anschaut, der sieht vor allem Autos. Auf allen Straßen und Plätzen, die heute teilweise Fußgängerzone sind, fuhren und parkten damals die Fahrzeuge.1 Selbst der Römerberg fungierte als Abstellplatz für die Pkws. 1956 wurde zwar ein erstes Parkhaus an der Hauptwache eröffnet, aber das war noch die Ausnahme. Um die Straßen zu entlasten wurde in den sechziger Jahren mit dem Bau der U-Bahn begonnen. 1968 wurde das so genannte Loch der Hauptwache mit der B-Ebene und den U-Bahn-Zugängen eröffnet. Meistens wurde die U-Bahn entlang von Straßenzügen gebaut. Doch es gibt Ausnahmen: In der Altstadt z. B. wurde die Strecke 1966 bis 1971 in bergmännischer Bauweise quer durch das Quartier getrieben. Weitere Bauaktivitäten waren deshalb in dieser Zeit nicht möglich. Es blieb daher auch in den sechziger Jahren erst einmal eine Leerstelle zwischen Dom und Römer.
In den wachstumsstarken 60iger-Jahren regierte die Abrissbirne: Geschichtsreiche Bauten, die über Jahrhunderte an ihrem angestammten Platz standen, die alle Stadtbrände, Abrisswellen und Kriege überstanden hatten, wurden sinnlos weggerissen. Besonders in den Altstädten der Republik tobten sich rigorose „Altstadtsanierer“ aus, bei denen in der Regel nicht saniert, sondern abgerissen wurde. In den USA (Jane Jacobs, "The Death and Life of Great American Cities") und später auch in Deutschland durch Wolf Jobst Siedler ("Die gemordete Stadt", 1964) und Alexander Mitscherlich ("Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden", 1965) gab es in den 60iger-Jahren erste publizistische Aufschreie gegen die Stadtzerstörung, die weltweit zugegen war. Doch die Wirkung des Aufschreis war nur gering. Auch die städtebaulichen Protagonisten in Frankfurt machten mit dem historischen Bauerbe kurzen Prozess: So riss man den bedeutenden Jugendstilbau des Schumann-Theaters genauso unnötig ab, wie die noch vorhandene Schmuckfassade des Alten Schauspielhauses. Letztere überbaute man mit einer Art Betonsarkophag, um dem Theater eine moderne, zeitgeistgerechte Anmutung zu verschaffen. Heute präsentiert sich das 100 Meter lange Opern- und Schauspielhaus mit seiner attrappenhaft vorgehängten, modernen Fassade und seinen unförmigen Anbauten wie ein fremder Monolith im Stadtbild. Statt belebte Erdgeschosszonen, bietet es an mehreren Seiten vor allem glattgebügelte, graue Betonflächen. An der Schauseite kehrt nur bei Abendvorstellungen Licht ein – ansonsten ist es ein dunkles, tristes Areal in bester Innenstadtlage. Auch an anderen Stellen zogen in den sechziger Jahren, graue Betonklötze in das Stadtbild ein: So knöpfte man sich 1967 das relativ wenig kriegszerstörte Westend vor. In einer beispiellosen Radikalität wurde der so genannte „ Fünf-Finger-Plan “ entwickelt: Vom Opernplatz ausgehend plante man rund um die ausgehenden Straßen (Mainzer Landstraße, Kettenhofweg, Bockenheimer Landstraße, Oberlindau, Reuterweg) ein neues Büro- und Geschäftsviertel im Westend. Angetrieben von irrwitzigen Fehlplanungen der Stadtpolitik und dadurch ausgelösten wilden Immobilienspekulationen, ließ man dutzende teils mutwillig entmietete, historische Villen und Gründerzeitbauten verfallen und begann bis Mitte der siebziger Jahre mit dem massenhaften Abriss der stilreichen Bebauung. Erst massive Bürgerproteste und studentische Hausbesetzungen konnten diesen beispiellosen Akt der Selbstverstümmelung der Stadt stoppen. Heute sind die verbliebenen Altbauten bei Mietern und Eigentümern begehrt und erfreuen sich einer kontinuierlichen Wertsteigerung.
Architektonisch hatte die 60iger Jahre Dekade mit ihren nüchternen Zweckbauten nicht viel zu bieten. Nur der Baueifer war beeindruckend: Viele Lücken wurden in der Innenstadt mit neuen Büro- und Geschäftsbauten gefüllt und einige Großsiedlungen entstanden unter dem Leitmotto „ Urbanität durch Dichte “. Eine höhere Baudichte wurde zumeist durch großmaßstäbliche Wohnhäuser erzielt, doch es gibt kaum ein architektonisches Werk aus dieser Zeit, welches heute als stadtbildprägend gilt. Ausnahmen sind der 1961 eröffnete Henninger Turm (2013 abgerissen und dann mit einem Turm-Hochhaus bebaut) und das 1963 fertiggestellte Hotel Intercontinental – ein überdimensionierter Betonklotz am Main. Auch erste kleine Hochhäuser für die emporschießenden Banken- und Geschäftswelt wurden gebaut: Die 82m hohe BHF-Bank und das 1968 eröffnete Hochtief-Hochhaus von Egon Eiermann an der Bockenheimer Landstraße gehören dazu. Letzteres wurde, trotz Denkmalschutz, 2004 abgerissen. Bei vielen Gebäuden der 60iger Jahre waren Anleihen an der aufstrebenden, amerikanischen Architektur zu erkennen. Alles wurde großzügiger gebaut, denn der Materialmangel der Nachkriegszeit war überwunden. Doch energetisch gesehen waren die schlecht gedämmten Gebäude aus dieser Zeit meist unökologisch und verschwenderisch. Ein Grund, dass viele dieser Bauten in der heutigen Zeit nach und nach ersetzt werden.
3.3 Die 70iger Jahre: Die Stadt der Großprojekte
Die 70iger Jahre waren die Zeit der Großprojekte und der Baulöwen. Trabantenstädte mit Zeilenbauten und Punkthochhäusern wurden um die Städte herum gebaut. Riesige Betonburgen für Behörden und Unternehmen entstanden. Der Waschbeton eroberte die Innenstädte und wurde zum neuen Stadtmobiliar. In den 70iger Jahren gab es einen ungeheuren Bauboom: Beton war das neue Gold. Die Einnahmen in den Stadthaushalten sprudelten – überall wurden neue Rathäuser, Museen, Bibliotheken, Theater, Schulen und Krankenhäuser im kühlen Glas- und Betonstil der Zeit gebaut. Auch Sparkassen und Kaufhauskonzerne fraßen sich mit unmaßstäblichen Brutalismus-Bauten aus Sichtbeton in die innerstädtischen Zentren. Die berüchtigten Altstadtsanierungen in den 70iger Jahren entpuppten sich wie auch schon in den 60iger Jahren als rigorose Kahlschlagsanierungen. Auf den städtebaulichen Kontext und Maßstab wurde keinerlei Wert gelegt. Auf der grünen Wiese entstanden die ersten Fachmärkte und Einkaufscenter nach amerikanischem Vorbild: So wurde 1971 in Frankfurt-Enkheim das Hessen-Center eröffnet. In den Innenstädten entstanden zudem die ersten Fußgängerzonen und neue S- und U-Bahn-Strecken wurden unter die Straßen gegraben. Auch Büro- und Verwaltungshochhäuser, nach dem Vorbild amerikanischer Downtowns, erlebten eine Blütezeit: 1971 entstand das 92 Meter hohe IBCF-Hochhaus und 1972 wurde der 116 Meter hohe AfE-Turm auf dem Unigelände in Bockenheim eröffnet. Auf Höhenbeschränkungen wie in München, Hamburg und Berlin verzichtete die Mainstadt. Frankfurt sollte eine Skyline wie in den amerikanischen Städten erhalten.
Der Raum für Fußgänger schrumpfte in den 70iger Jahren immer mehr. Die Verkehrsräume wurden dabei weiterhin strikt getrennt: Riesige Beton-Fußgängerbrücken und aufgeständerte Schnellstraßen auf Stelzen wurden in den abgasumtosten Innenstädten errichtet. Eine Funktionselite aus größenwahnsinnigen Stadtplanern, Politkern und Architekten mutete den Städten abstruse Betongebirge1 zu.1 Nachwuchsarchitekten dagegen fühlten sich vielfach von der 68er-Bewegung beflügelt und grenzten sich zunehmend von dem kapitalistischen Bauwirtschaftsfunktionalimus ab. Die jungen Architekten und Studenten protestierten gegen Hausabrisse und Massensiedlungen, hatten aber selber auch kein besseres Modell für eine humanere Architektur in der Tasche. (12) Zumindest agierten die jungen Architekten autonomer und unabhängiger wie ihre Vorgänger. Dem Zeitgeist entsprechend spielte die Selbstverwirklichung bei vielen Architekturentwürfen eine große Rolle. Nicht das Konventionelle, im Sinne einer am Umfeld angepassten Architektur, sondern das Außergewöhnliche sollte zum Maßstab werden. Heraus kamen leider oftmals Bauten, die wie egozentrische Fremdkörper im historisch gewachsenen Stadtgebilde wirkten.
In den 70iger-Jahren gab es einige städtebauliche Herausforderungen in Frankfurt: Insbesondere für den Altstadtkern, zwischen Römer und Dom, konnte in diesen Jahren immer noch keine städtebauliche Lösung gefunden werden.1 1971 riss man das gegenüber des Haus Wertheim gelegene spätklassizistische1 Haus Freudenberg (früher Brabant)1 und Teile der Stadtmauer ab und fügte dafür den brutalistischen Betonbau des historischen Museums ein. Wenig später, im Jahr 1974 baute man – an der Leerstelle zwischen Dom und Römer – das überdimensionierte Technische Rathauses in den früheren Altstadtkern. Stimmen von engagierten Bürgern, die eine Wiederherstellung der historischen Altstadt forderten, wurden überhört.1 Doch die puristische Moderne mit ihren „städtebaulichen Errungenschaften“ wurde in der Öffentlichkeit mehr und mehr hinterfragt. Ein erster Schock für die weiteren Planungen im Rahmen der verkehrsgerechten Stadt gab es bereits mit der Ölkrise 1973. Diese Krise gab auch den Impuls sich wieder mehr auf die städtebauliche Geschichte zu besinnen und den Menschen, statt das Auto wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. 1975 wurde von der Europäischen Gemeinschaft das „ Europäische Denkmalschutzjahr “ ausgerufen. In den deutschen Bundesländern wurden nach und nach Denkmalschutzgesetze erlassen. Vor allem die Bauten des Historismus wurden als denkmalwürdiges Zeugnis der Vergangenheit neu bewertet und erhielten wieder eine höhere Wertschätzung. Auch bei den Frankfurter Stadtplanern gab es ein erstes Umdenken, hin zu einem etwas behutsameren Umgang mit dem historisch gewachsenen Bauerbe.
3.4 Die 80iger Jahre: Die postmoderne Stadt
In den 80iger Jahren wurde vielfach versucht die Stadt mit Hilfe einer behutsamen Stadterneuerung und einer kritischen Rekonstruktion des Stadtgrundrisses zu „reparieren“. Auch in Frankfurt rückten Orte, die in den Jahrzehnten davor zerstört oder vernachlässigt wurden, in den Fokus. 1981 wurde die Eröffnung der wieder aufgebauten Alte Oper gefeiert. Dieser traditionsreiche Bau stand über 30 Jahre als ausgebrannter Ruinenbau an seinem angestammten Platz. Bürgerinitiativen sammelten immer wieder Geld für die Sicherung der Ruine und für den Wiederaufbau. Auch das gotische Leinwandhaus – ebenfalls jahrzehntelang eine Kriegsruine – wurde endlich 1984 wiederaufgebaut. Aus dem ausgebrannten Schutthaufen wurden erhaltene Teile für den rekonstruierten Bau wiederverwendet. An anderer Stelle entstand in den achtziger Jahren noch eine größere Rekonstruktion: 1981 bis 1986 sorgte die Wiedererrichtung der Ostzeile auf dem Samstagsberg des Römers für Furore. Die geschichtsträchtigen Bauten bilden seither den östlichen Abschluss des Römers und sind heute nicht mehr wegzudenken. Im wieder aufgebauten Eckhaus „ Großer Engel “ auf dem Römerberg wurde im 17. Jahrhundert übrigens die erste Bank Frankfurts gegründet. Auch sonst kann man den Platz als das geschichtsreiche Herz der Stadt bezeichnen: Der imposante Römerberg, ehemals Samstagsberg genannt, diente bereits seit dem 9. Jahrhundert als zentraler Platz für Feste, Märkte und Messen und als Richtplatz von Kaiserwahlen und –krönungen.
Die sechs wieder aufgebauten Häuser der Ostzeile und das Gasthaus „ Zum Schwarzen Stern “ schufen mit der zwischen Römerberg und Kaiserdom platzierten Schirn Kunsthalle (Eröffnung 1986), ein neues bauliches Areal aus Alt und Neu in der Altstadt. Für die Verwirklichung der rekonstruierten Bauten gab es ungewöhnliche Lösungen: Eine auf der Rückseite des Samstagsberg errichtete Reihe moderner Häuser nahm die technischen Versorgungseinrichtungen der wiedererstandenen Altstadtbauten auf. Für die Rekonstruktion der Fachwerkhäuser wurden, wie später beim DomRömer-Projekt, teilweise erhaltene Originalteile – so genannte Spolien – verwendet. Auch in anderen Orten, dem damaligen Ost- und Westdeutschland, gab es eine Rekonstruktionswelle: In Hildesheim wurde 1986 das Knochenhaueramtshaus und des Wedekindhaus wiedererrichtet und in Ost-Berlin ließ man das Nikolaiviertel mit einem Ensemble alter und neuinterpretierter Bürgerhäuser 1987 wieder auferstehen.
Die 80iger Jahre waren aber vor allem das Zeitalter der Postmoderne. Bundesweit entstanden immer mehr Bauten in diesem Stil, der auch historische Bauzitate aufnahm. Selbst das aus der Baulehre lange Zeit verbannte Ornament fand wieder Eingang in der Architektur. Auch in der Frankfurter Altstadt entstand ein 1981 bis 1984 erbautes Ensemble von vierzehn postmodernen Wohnhäusern in der nördlichen Saalgasse. Die Bauten nahmen vieles von dem Vorweg, was später bei den angepassten Neubauten in der neuen Altstadt zu sehen war: Neben der Kleinmaßstäblichkeit ist dabei besonders die variantenreiche Bauausführung hervorzuheben. Die Straße bildet eine altstadtgerechte, kleinteilige Einheit, nutzt aber trotzdem den Interpretationsspielraum moderner Architektur. Unmissverständlich stehen die postmodernen Wohnhäuser im Kontext zur Altstadt und vermitteln, mit der Schirn im Rücken, zugleich mit der Moderne. Parallel zur Entwicklung in der Altstadt, gab es einen weiteren, bedeutenden städtebaulichen und kulturellen Schub für die Stadt: 1980 bis 1990 entwickelte sich auf der Sachsenhäuser Mainseite das Museumsufer. Bestehende Museen wurden dafür ausgebaut und neue Museen errichtet. Mit dem seit 1988 stattfindenden Museumsuferfest etablierte sich zudem ein kulturelles Veranstaltungshighlight. Die Stadt hatte somit ihr Flussufer als Erholungs- und Begegnungsort erfolgreich wiederbelebt und wandelte sich zudem von einer Banken- zur Kulturstadt.
3.5 Die 90iger Jahre: Die XXL-Stadt
In den 90iger Jahren wurde die Erlebnisgesellschaft zelebriert. Frankfurt am Main wurde zum bundesweit bekannten Mekka der elektronischen Technomusik. Mit riesigen Multiplex-Kinos, Einkaufszentren und Mehrzweckhallen zog das kommerzielle, eventorientierte XXL-Zeitalter in die Städte ein. Der Mauerfall sorgte für eine zusätzliche Euphorie und Unbeschwertheit, die sich auch im Städtebau zeigte. Die jahrelange Schockstarre der als „Krank“- und „Bankfurt“ verschrienen Mainmetropole schien spätestens 1991 überwunden: Mit dem Messeturm wurde in der Stadt ein Wolkenkratzer gebaut, der die Bevölkerung mit der Skyline versöhnte. Die Frankfurter waren wieder stolz auf ihre Stadt. 1991 wurde auch das von Hans Hollein entworfene Museum für Moderne Kunst (MMK) in der Braubachstraße eröffnet. Das Grundstück war ursprünglich für den Ausbau städtischer Ämter vorgesehen. Zusammen mit dem Technischen Rathauses, hätte die sterilen Behördenbauten wohl das endgültige Ende für die Frankfurter Altstadt bedeutet. Mit dem verwirklichten MMK wurde das Quartier zwischen Römer und Dom deutlich aufgewertet. Doch insgesamt gesehen war die Altstadt in dieser Zeit immer noch ein Niemandsland: Die Laufwege führten größtenteils nur von der Zeil über den Römer zum Main oder zur Schirn. Das restliche Altstadtareal war größtenteils tot. Nur wenn der Weihnachtsmarkt erstrahlte oder ein bedeutender Fußballtitel errungen wurde, strömten die Menschen zum Römerberg und ließen dort ein belebtes Altstadtgefühl aufkommen. Der abweisende Brutalismusbau des Historischen Museums, der triste Archäologische Garten und das Technischen Rathauses mit seinem öden Umfeld, raubten der Altstadt jegliche Energie. Mehr Leben zog dagegen in Sachsenhausen ein: Die Schweizer Straße und der Schweizer Platz wurden nach Umgestaltung zu einem neuen, stilvollen Shopping-Mekka.1
Im XXL-Zeitgeist der 90iger Jahren hatten großvolumige Investorenbauten und egozentrische Entwürfe für dekonstruktivistische Gebäude eine Hochkonjunktur. Die Prinzipien der Moderne: „ Form follows function “ (Louis Sullivan) und „ Weniger ist mehr “ (Ludwig Mies van der Rohe) wurden über Bord geworfen. Die neuen Bauten wurden mit futuristischen und fluiden Formen immer spektakulärer. Gleichzeitig hatte das Gefühl der Entfremdung zur1 zeitgenössischen Architektur bei breiten Bevölkerungsschichten einen neuen Höhepunkt erreicht. Sichtlich von der Kritik getroffen, schoben Architekten und Stadtplaner die Verantwortung für den oftmals gesichtslosen und kalten XXL-Baustil auf die Investoren, die unter dem unvermeidbaren Renditedruck globaler Anleger immer trostlosere Bürobauten verlangten. Doch die omnipräsenten, phantasielosen Glas- und Betonkästen entstanden nicht nur unter den globalen Investorenzwängen, sondern auch bei ausgeschriebenen, öffentlichen Architekturwettbewerben. Bekannt geworden ist die Geschichte des allgegenwärtigen Preisrichters bei bundesdeutschen Architekturwettbewerben Max Bächer. Dieser saß von 1960 bis 2010 in 423 Architekturwettbewerben im Preisgericht und übernahm dabei – wie zum Beispiel beim Wettbewerb für den Dom-Römer-Bereich 1980 – meistens den Vorsitz. Als übermächtiger Netzwerker dirigierte er im Hintergrund geschickt die Wettbewerbe und setzte dabei oftmals seine architektonischen Interessen durch. (13)
In den 90iger Jahren wurden erstmals Architekten mit spektakulären Bauten zu Stars und zu eigenen, globalen Marken. Doch mit der aufmerksamkeitsstarken Event-Architektur entstanden auch immer mehr Ego-Bauten, bei denen sich die Architekten vor allem selbst darstellen wollten. Von Stadtvertretern und honorigen Architekturkritikern werden solche Bauten, bis in die heutige Zeit, regelmäßig als mutig deklariert oder es wird ein spannender Bruch oder Kontrast zur bestehenden Bebauung bescheinigt. Doch ist es wirklich mutig, den Kontext der städtebaulichen Umgebung zu verlassen? Moderne, teils egozentrische Bauten bei einem Architekturwettbewerb zu präsentieren ist schon lange nichts außergewöhnliches mehr. In der zeitgenössischen Architektur sind individualistische Entwürfe mittlerweile omnipräsent. Das zeigt Wirkung: Bei studentischen Wettbewerben wird mit futuristischen Entwürfen, vielfach den Stararchitekten nachgeeifert. Die grenzenlosen Möglichkeiten der Architektursoftware kennen keine formalen Grenzen mehr und verleiten zu unkonventionellen Entwürfen. Die Bedeutung der klassischen Entwurfslehre schwindet. Fakt ist: Auch viele gelehrte Preisrichter sind spätestens seit den 90iger-Jahren der Ästhetik der Eventarchitektur verfallen und unterstützen somit die gestalterische Misere der Gegenwart, die einen zweifelhaften Schwerpunkt auf spektakuläres Bauen legt.
Bei aller Kritik an der großvolumigen XXL-Investoren- und Eventarchitektur, so waren die 90iger Jahre in Frankfurt doch eine Zeit des Aufbruchs. Die Türme der Banken wurden immer höher und der Einzelhandel stand – noch ohne Onlinekonkurrenz – in voller Blüte da. Ein Event jagte im selbstbewussten „Mainhattan“ den nächsten. Die Stadt und ihre Bankenszene waren in Feierlaune. 1997 gönnte sich die Commerzbank mit dem gleichnamigen Tower des Stararchitekten Sir Norman Foster sogar das zu dieser Zeit höchste Gebäude Europas. In den neunziger Jahren rangen die Investoren der Stadt immer mehr neue Standorte für weitere Wolkenkratzer ab. Die Himmelsstürmer waren zu einem Markenzeichen der Stadt geworden und mit dem Hochhausrahmenplan schaffte es die Stadt mit ansehnlichen Clustern von Hochhäusern, eine optisch ansprechende Skyline zu erschaffen. Gab es Hinsichtlich der Genehmigung eines weiteren Hochhauses von der Stadt oder von den Bürgern Bedenken, so zogen die Investoren die Karte der „öffentlichen Nutzung“. Mal wurden in der Sockelzone ansprechende Läden und Gastronomieangebote versprochen, ein anderes Mal stellte man eine Besucherterrasse oder Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen in Aussicht. Darüber hinaus versprachen die Investoren mit jedem neuen Hochhaus auch weitere Arbeitsplätze und eine noch umweltfreundlichere, energiesparende Architektur. Waren die Hochhäuser erst einmal fertig gestellt, so wurde schnell klar, dass die meisten dieser himmelragenden Gebäude dann doch weitgehend auf eine öffentliche Nutzung verzichteten. Neben Sicherheitsaspekten, fehlte oftmals den globalen Immobiliengesellschaften schlicht das Interesse nach öffentlichen Bereichen. Die „Frankfurter Downtown“ war, wie die meisten anderen Downtowns in der Welt auch, nach Büroschluss eine menschenleere Geisterstadt.
3.6 Die 2000er Jahre: Investorenarchitektur in der globalisierten Stadt
Um die Millenniumszeit herum, war die große Aufbruchsstimmung der neunziger Jahre in der Stadt wieder verflogen. In Frankfurt hatte sich das Zentrum mehr und mehr zu einer städtebaulichen Leerhülle entwickelt, die größtenteils nur noch vom Thema Konsum und von massentauglichen Events getragen wurde. Die Mainmetropole entwickelte sich zu einer geschichtsvergessenen Stadt, bei der historische Orte – wie die jahrhundertealte Altstadt – keine große Rolle mehr spielten. Frankfurt fühlte sich als prosperierende Finanzmetropole wohl. Doch nur auf den Bankensektor zu setzen, war wie später auch die Finanzkrise 2007 zeigte, ein Fehler. Frankfurt war zwar reich, aber nicht mehr besonders sexy.1 Statt Identifikation herrschte eine zunehmende Egalität in der Mainmetropole. Die Fluktuation in der Stadt war hoch: Viele Einwohner fühlten sich in Frankfurt nicht zu Hause und zogen nach wenigen Jahren wieder weg. Die Qualität der gebauten Wohn- und Geschäftshäuser und auch der Hochhäuser hatte in den 2000er Jahren deutlich abgenommen. Mit mächtig dimensionierten Großbauten wie der 1998 bis 2003 errichteten Frankfurter Welle und weiteren verwirklichten Hochhausbauten am Rande des Bahnhofsviertels wurde deutlich, dass immer mehr monotone Geschäftsviertel keine wirkliche Bereicherung mehr für die Stadt darstellten. Globale Finanzinvestoren bestimmten immer mehr das von Rendite bestimme Baugeschehen. Inzwischen hatte auch der Wohnungsdruck deutlich zugenommen: Bezahlbarer Wohnraum war, angesichts galoppierender Immobilienpreise, in der Stadt kaum noch zu finden. Es wurde wohl auch den Politikern klar, dass langsam etwas geschehen musste. Städtebaulich war man mit der Gleichförmigkeit der banalen Investorenarchitektur in eine Sackgasse geraten. Bürgerbeteiligung wurde in dieser Zeit immer noch klein geschrieben. Immerhin baute man 2005 dann noch die Alte Stadtbibliothek wieder auf – hier residiert seitdem das Literaturhaus. Und 2009 wurde das Palais Thurn und Taxis mit einem veränderten Grundriss rekonstruiert. Doch im Gegenzug erhielt die Stadt mit dem Palais-Quartier weitere, erschreckende Investorenbauten. Zumindest gab es bei einem anderen Bauprojekt ein Lichtblick: 2010 verwirklichte der Architekt Christoph Mäckler den Opernturm und setzte mit seiner städtebaulich überzeugenden Sockel-Blockrandbebauung einen neuen Maßstab beim Hochhausbau in der Stadt.
Eine ganz andere Baustelle tat sich 2011 am Rande der Altstadt auf: Ein Investor plante ein Bauprojekt auf dem Areal des ehemaligen Bundesrechnungshofs und empfahl den Abriss des 1957 erbauten, denkmalgeschützten Gebäudes. Grund war ein baustatisches Gutachten, das zum Urteil kam, dass der Bau akut einsturzgefährdet sei. Bereits die Urstatik zur Bauzeit war demnach fehlerhaft. Aus wirtschaftlichen Gründen war eine Sanierung unmöglich, denn am ganzen Bau war kein statisches Bauteil zu finden, welches in Ordnung war. Kein Originalbauteil könne erhalten werden, lediglich die filigrane Freitreppe im Treppenhaus, ließen die 50er Jahre erkennen. Zudem gab es im Laufe der Zeit erhebliche Veränderungen: Es wurden Kunststofffenster verbaut, Türen herausgerissen, überall gab es Abbruchspuren. Der Bundesrechnungshof war also eine marode Ruine ohne Originalsubstanz, eine Instandsetzung völlig unwirtschaftlich. (14) Wie reagierte nun der Denkmalschutz? Es gibt eine Vielzahl von Beispielen in der ganzen Republik, wie historische Baudenkmäler mit Erlaubnis des Denkmalschutzes abgerissen wurden, weil die Originalbausubstanz nicht mehr vorhanden war, bzw. es teilweise nur winzige Veränderungen gab, oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Sanierung nicht zumutbar war. Doch beim Bundesrechnungshof, ein Bau der vom Denkmalschutz hochgeschätzten Nachkriegsmoderne, spielte das offensichtlich keine Rolle. Das Landesdenkmalamt und das Frankfurter Denkmalamt kämpften mit leidenschaftlichem Engagement um den Erhalt des fragmentierten Nachkriegsbaus. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden und ein großer Teil der Fassade des Bundesrechnungshofes wurde erhalten.
Spannendes, tat sich zwischenzeitlich auch in der Altstadt: 2005 wurde die Bürgerinitiative "Pro Altstadt" von siebzig Bürgern aus der Taufe gehoben. Grund war das Bestreben der Stadt, das Technische Rathaus durch einen anderen, monströsen Bau zu ersetzen. Die Bürger lehnten diesen Plan ab. Die Zeit war reif, an dieser Stelle den Krönungsweg mit seiner historischen Altstadtbebauung wieder auferstehen zu lassen und die städtebauliche Wunde zu schließen. Andere Städte wie Dresden, Potsdam und Braunschweig machten es vor und knüpften mit ihren Rekonstruktionen wieder mehr und mehr wieder an ihr bauhistorisches Erbe an.
3.7 Die Geschichte des DomRömer-Projekts
Blicken wir noch einmal genauer auf die Geschichte des DomRömer-Altstadtareals mit seinen 35 errichteten Gebäuden zurück. Auf diesem Areal befand sich seit 1974 das Technische Rathaus. Ende der 90iger Jahre setzte sich eine Diskussion in Gang, wie es mit dem in die Jahre gekommenen Betonbau weiter gehen solle. So forderte der damalige Bürgermeister Achim Vandreike (SPD) im Jahre 2000 den asbestbelasteten Bau „zu sprengen“. Der von OB Petra Roth (CDU) zum „Beauftragten für das Technische Rathaus“ ernannte Baudezernent Martin Wentz (SPD) präsentierte 2000 einen Investor für ein Luxushotel mit Ladenpassage und einem Bürogebäude. Doch der klotzige und teure Entwurf kam allgemein nicht gut an und auch die CDU unterstützte nicht weiter das Projekt. Bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2001 ergab sich dann zum ersten Mal eine schwarz-grüne Mehrheit im Römer. Diese zerbrach jedoch nach nur einem Tag, weil in der geheimen Wahl ein CDU-Stadtverordneter für die rechtsextremen Republikaner gestimmt hatte. Im Rathaus kam es daraufhin zu einem überraschenden Vierer-Bündnis aus CDU, SPD, Grüne und FDP. In der Zwischenzeit war das brisante Thema, über die weitere Zukunft des Technischen Rathauses, in der Öffentlichkeit angekommen. 2004 stellte der junge Bauingenieur Dominik Mangelmann ein umsetzbares Konzept zur Rekonstruktion der Altstadt vor. (15) Anfang 2005 wurde ein städtischer Ideenwettbewerb für das Areal des Technischen Rathauses ausgerufen. In dieser Phase stellte Wolfgang Hübner (damals einziger Stadtverordnete der BFF – Bürger für Frankfurt) am 20. August 2005 einen Antrag für den Wiederaufbau eines Teils der historischen Altstadt mit der Rekonstruktion einzelner Gebäude. Die Vierer-Koalition im Römer lehnte diesen Antrag mit ihrer Mehrheit ab.
Am 15. September 2005 kürte das Preisgericht einen Entwurf des Architekturbüros KSP Jürgen Engel zum Sieger des Ideenwettbewerbes. Der moderne Entwurf sah unter anderem eine neue städtische Zentralbibliothek vor. Doch der Siegerentwurf stieß im Römer überwiegend auf Ablehnung. Zudem hatten sich die Altstadt-Freunde gegen die modernen Pläne formiert und konnten viele Bürger zu dem brennenden Thema mobilisieren. Kurz vor der Kommunalwahl begann daraufhin ein Wettlauf der Parteien, die nun für Rekonstruktionen auf dem Areal votierten. Nach der Kommunalwahl 2006 zogen die Architekten, auf Grund des großen Druckes, ihren modernen Entwurf zurück. Die CDU und Grüne fanden sich nach der Kommunalwahl in einer Koalition zusammen. Im November 2006 beschlossen sie gemeinsame „Eckpunkte“ für den Wiederaufbau der Altstadt: Mindestens sechs Rekonstruktionen sollte es geben. Daraus wurden dann später 15 originalgetreue Wiederaufbauten.
Es ist verwunderlich, mit welcher Vehemenz Architektenverbände und verbundene Bauzeitschriften das gestaltungsreiche DomRömer-Projekt von Anfang an ablehnten. Dabei wurde es schon damals, über die Grenzen hinaus, als ein spannendes Stadtplanungs- und Rekonstruktionsprojekt von internationalem Rang angesehen. Insgesamt hatten sich im so genannten VOF-Verfahren 178 Architekturbüros aus ganz Europa beworben. Nach einem Auswahlverfahren wurden dann 56 Architekturbüros zum eigentlichen Wettbewerb für die 27 Parzellen eingeladen. (16) Am Ende wurden insbesondere von jungen Architekturbüros besonders überzeugende Arbeiten abgeliefert. Diese hatten unvoreingenommen und kreativ die Aufgabe angenommen und kleinteilige, altstadtgerechte Einzelbauten für das Ensemble rund um den Krönungsweg entworfen. Das Endergebnis war überwältigend: In der neuen Frankfurter Altstadt wurde zwischen 2012 und 2018 mit einem lebendig-gemischten Quartier genau das gebaut, was weitsichtige Stadtplaner seit langem für Neubauprojekte fordern, aber bisher kaum umgesetzt wurde.
Rekonstruktionen im Zeichen der Zeit
In Deutschland gab es nach dem Weltkrieg mehrere Wellen bei der Errichtung von historisierenden Nachbauten und Rekonstruktionen. Zunächst gab es direkt nach dem Kriegsende Rekonstruktionen der wichtigsten Sakralbauten sowie vieler Rathäuser und Schlösser. Altstadtrekonstruktionen gab es z. B. in Münster, München und Köln. Bedeutende Häuser wie das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg und das Goethe-Haus in Frankfurt am Main wurden zudem wieder aufgebaut. Den nächsten Rekonstruktionsschub gab es in den achtziger Jahren, vor der Wiedervereinigung in der damaligen DDR, z. B. in Berlin mit dem Nikolaiviertel (1987) und in Dresden mit der Semperoper (1977-85) und dem Wiederaufbau des Residenzschlosses (ab ca. 1986). Im damaligen Westdeutschland gab es in den achtziger Jahren Rekonstruktionen u.a. in Hildesheim mit dem Knochenhaueramtshaus und dem Wedekindhaus (1986), in Hannover mit dem Leibnizhaus (1983) sowie in Frankfurt am Main mit der Ostzeile am Römerberg (1981-1986) und der Alten Oper (1981).
Die dritte Rekonstruktionsphase reicht bis in die heutige Zeit und begann unmittelbar nach dem Mauerfall. In Dresden wurde die Frauenkirche (1994-2005), das Kurländer Palais (2007) sowie der Neumarkt mit 60 Leitbauten neu aufgebaut. In Berlin wurden das Stadtschloss (2013-2020) und die Alte Kommandatur (2003) sowie das Hotel Adlon (1997) wiedererrichtet. Rekonstruktionen gab es zudem in Braunschweig mit der Schlossfassade (2007) und der Alten Waage (1994) – bei der auch Spolien verwendet wurden – sowie in Hannover mit dem Schloss Herrenhausen (2013). Nicht zuletzt gab es u.a. auch Rekonstruktionen in Potsdam mit dem Stadtschloss (2010-2014), dem Palais Barberini und der Kellertorwache (beide 2017) sowie in Wesel mit der Fassade des spätgotischen Rathauses (2011) und in Bendorf-Sayn mit dem wunderschön rekonstruierten Schloss (2000). In Frankfurt schließlich das beschriebene DomRömer-Projekt mit den 35 Altstadthäusern – davon 15 Nachbauten und 20 Neubauten, das 2018 eröffnet wurde. Weitere Wiederaufbauinitiativen gibt es z. B. für die Bauakademie in Berlin und für die Synagoge am Bornplatz in Hamburg.
Obwohl alle Rekonstruktionsprojekte in der Regel eine große Zustimmung bei den Bürgern besitzen und beliebte Besuchermagnete sind, die die Städte schöner und attraktiver gemacht haben, stehen jüngere Projekte nach wie vor unter Kritik. Dabei scheint es insgesamt gesehen so etwas wie einen wohlwollenden, zeitlichen Verzug zu geben. Während es z. B. in der Zeit der Wiedererrichtung des Goethehauses noch kritische Stimmen gab, würde heute kaum jemand mehr die Rekonstruktion in Zweifel ziehen. So ist es bei allen rekonstruierten Bauten, die am Anfang in der Architektenschaft hochumstritten sind, nach einer Weile jedoch wie selbstverständlich zum Stadtbild gehören. Niemand fragt heute mehr ob die Rekonstruktion der Hauptwache, der Alten Oper oder der Paulskirche richtig waren. Die meisten Kritiker haben früher oder später vergessen, dass es Rekonstruktionen waren oder bemerken es heute nicht mehr. Bei den Bürgern gab es sowie so schon immer bei allen Rekonstruktionsprojekten von Anfang an eine hohe Zustimmung. Wenn, dann hat sich die akademische Architektengilde an den Rekonstruktionen gerieben. Insbesondere eine Reihe von modernen Architekten und deren Fachmedien haben bei Rekonstruktionen immer wieder moralische Bedenken vorgebracht. Das ist besonders abstrus, denn gerade in der globalisierten Moderne werden moralische Fragen ansonsten gerne bei Seite geschoben. Das Geld bestimmt wie und wo gebaut wird. So lassen sich einige Stararchitekten für egozentrische Statusbauten von zweifelhaften Diktatoren und Machthabern auf der ganzen Welt anheuern. Doch die meisten Modernisten ignorieren diese Tatsachen und reagieren nur mit heftiger Kritik, wenn es um Rekonstruktionen geht. Dabei mischen sich dann gerne akademische und ideologisch geleitete Kritikpunkte. Es ist daher wichtig, eine faktenbasierte Prüfung der einzelnen Kritikpunkte vorzunehmen.
4. DIE GRÖßTEN FAKTEN UND MYTHEN ZUR NEUEN FRANKFURTER ALTSTADT
Viele Fakten und Mythen ranken sich um die Neue Frankfurter Altstadt, über die insbesondere während der Planungsphase viel diskutiert wurde. Am Ende waren es die Bürger, die die Rekonstruktionen beim Römer-Projekt durchsetzten. Selbst Querfeuer während der Bauphase, wie eine angeblich technisch nicht mögliche Überbauung der Tiefgaragendecke oder Bedenken beim Brandschutz, konnten das Projekt nicht stoppen. Doch schauen wir uns in den folgenden Abschnitten die Kritikpunkte und die teilweise bis heute anhaltende Diskussionen zur Neuen Altstadt noch einmal genauer an.
4.1 Rekonstruktionen und die Altstadt
Die vielfältige Kritik zur Neuen Frankfurter Altstadt reicht von der Gleichsetzung des rekonstruierten Areals mit einem „Disneyland“ bis hin zur Behauptung, dass es eigentlich nicht erlaubt sei, verloren gegangene Bauten zu rekonstruieren. Doch die Wahrheit ist um einiges vielfältiger. Viele Kritiker der Neuen Altstadt meinen ja, diese sei eine Täuschung, eine Fake-Architektur. Doch was ist die wahrhaftige Altstadt? Veränderungen gab es immer wieder: 1405 wurden die Häuser Römer und Goldener Schwan zum Frankfurter Rathaus umgebaut. Noch mehr an die Substanz ging es, wenn Krieg und Feuer die Altstadt bedrohten: Beim so genannten Großen Christenbrand 1719 brannte zum Beispiel die gesamte nordwestliche Altstadt mit mehr als 400 Häusern ab. Das Straßenraster blieb, die Parzellen wurden exakt wieder bebaut, jedoch nicht mehr im gotischen Stil. Die nördliche Altstadt veränderte ihr Gesicht.
Das Ende des Heiligen Römischen Reichs 1806 führte zu einem Bedeutungsverlust von Frankfurt als Messeort. Die Messehöfe und Herbergen in der Altstadt verloren zunehmend ihre Grundlage. Auch die gotische Bausubstanz geriet aus der Mode und ihre baulichen Merkmale wurden im klassizistischen Baustatut von 1808 verboten. Viele Häuser in der Altstadt wurden zeitgenössisch umgestaltet. Frankfurt hatte seine Stellung als Wahl- und Krönungsstadt des Reiches verloren und war seit 1816 freie Stadt im Deutschen Bund. Mit der Annexion Frankfurts durch die Preußen 1866 wurde nicht nur der Zunftzwang aufgehoben, sondern auch der freie Zuzug in die als preußische Provinzstadt degradierte Reichsstadt Frankfurt erlaubt. Viele, besonders arme Bevölkerungsschichten, zogen nun die Altstadt. Nach dem Brand des Doms 1867 wurde der Dom mit dem Domturm mit der im Mittelalter ursprünglich vorgesehenen Dachkrone, bis 1878 wieder aufgebaut. Die Altstadt verfiel zwischenzeitlich immer mehr. Doch neben dem baulichen Verfall, gab es auch beeindruckende Restaurierungen: Die von der Stadt aufgekauften, baufälligen Häuser Frauenstein und das danebenstehende Salzhaus wurden 1887/88 aufwändig restauriert. Ab 1898 wurden immer mehr Altstadthäuser von der Stadt aufgekauft und unter anderem das Steinerne Haus, Großer Engel und die Goldene Waage saniert. Zum Anfang des 20. Jahrhunderts sorgten Neubauprojekte und Straßendurchbrüche in der Bethmann- und Braubachstraße für Veränderungen in der Altstadt: 1896 bis 1908 wurde der Römer modernisiert und erweitert und es kam – nach Abrissen – zum Bau des Neuen Rathauses. Auf dem Römerberg wurden 1910 die Häuser Nr. 32 bis 36 in historisierender Form errichtet – die Vorgängerbauten fielen dem Braubachstraßendurchbruch zum Opfer. Die Braubachstraße mit ihren neu errichteten Gebäuden in historisierender Form, wurde zur neuen Vorzeigestraße in der Altstadt. Ansonsten wurde die Altstadt immer mehr zum verfallenen Armutsquartier. 1922 bis 1924 legten die Altstadtfreunde in dem Viertel Hand an und gaben einigen Fassaden ein neues Gesicht. In den 30iger Jahren wurde dann eine Altstadtsanierung durchgeführt. Bereits 1930 gab es im Bauamt schon ein Sanierungskonzept für die vernachlässigte Altstadt. Die Nazis griffen die Pläne teilweise auf und rissen einige Häuser und verbaute Hinterhöfe ab. Zwischen Markt und Bendergasse entstand z. B. 1936 bei der Sanierung des Fünffingerplätzchens das Handwerkerhöfchen als freier Innenhof. Teilweise entstanden völlig neue Fassaden wie die Rückseiten in der Großen und kleinen Fischergasse, die sich auf einen neuen Hof gruppierten.
Was war nun die wahre Altstadt? Es gab nach Krieg und Feuer und bei Sanierungsmaßnahmen schon immer schöpferische Neubauten und frei geschaffene Retrofassaden in der Altstadt. In der Regel wurde auf kleinen Parzellen neu gebaut und Bauten mit altstädtischen Formen errichtet. Natürlich gab es einige Wahrzeichen in der Altstadt wie das Haus zur Goldenen Waage oder das Neue Rote Haus am Markt, die über Jahrhunderte ihr Antlitz bewahrten. Die Altstadt steht seit Jahrhunderten nicht nur für Tradition, sondern auch für Veränderung. Nach Feuer, Krieg und Zerstörung verschwanden immer wieder Altstadthäuser und wurden in ähnlicher oder gänzlich anderer Form wieder aufgebaut. Die Altstadt imitierte sich mit Anmutungen im alten Stil schon immer selbst. Eine große, dauerhafte Leerstelle in der Altstadt gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Lücke zwischen Dom und Römer wurde bekanntlich erst mit dem DomRömer-Projekt 2018 geschlossen.
Ist der jüngste Wiederaufbau ein Betrug, rückwärtsgewandt oder eine Verfälschung der Geschichte, wie es einige Kritiker es sagen? Die große Mehrheit der Frankfurter blickt unverkrampft auf die neue Altstadt. Für sie war die altstadtgereichte Wiederbebauung längst überfällig. Die Neue Altstadt mit ihren schöpferischen Nachbauten und Neubauten macht den historischen Kern zwischen Dom und Römer wieder als Stadtraum begreifbar und erlebbar und knüpft damit an die Geschichte vor dem Dritten Reich an. Der Wiederaufbau steht in einer langen, jahrhundertealten Tradition in der Altstadt: Nach großen Zerstörungen hat man die Altstadthäuser immer wieder neu errichtet. Immer wieder gab es Veränderungen und Umbauten. Der heutige Saalhof besteht zum Beispiel aus fünf Gebäuden aus acht Jahrhunderten. Es ist also kompliziert und verzwickt mit der Baugeschichte der Altstadt, die immer wieder für Diskussionen in der Stadt sorgte.
4.1.1 Ist mit der neuen Altstadt ein „Disneyland“ entstanden?
“Disneyland”, ist die wohl am häufigsten von Rekonstruktionsgegnern vorgebrachte, zumeist negativ vorgebrachte Bezeichnung für die neue Frankfurter Altstadt. Gemeint ist damit zum einen eine kitschige, künstlich geschaffene, billige Kulissenarchitektur und zum anderen ein kommerzieller Vergnügungspark ohne Authentizität und ohne kulturellen Wert. Beides ist negativ behaftet und zeigt die geringe Wertschätzung mit denen die Anhänger der modernen Formensprache über die fachgerecht errichtete Altstadt auf dem DomRömer-Areal urteilen.
Wer sich übrigens einmal näher mit der Disneyland-Architektur beschäftigt hat, der wird erstaunt sein mit wieviel Hingabe Walt Disney die Bauten für seinen ersten Vergnügungspark auswählte und mit wieviel Detailliebe er damals die Häuser errichten ließ. (17) Doch natürlich stand keines der zusammengetragenen Gebäude jemals an dem Ort, an dem das Disneyland gebaut wurde. Und natürlich hat der Vergnügungspark etwas Kulissenhaftes, denn niemand wohnt in den Disneyland-Bauten, sondern diese sind nur die Staffage für die Verkaufs- und Vergnügungsstände. Wahllos zusammengewürfelte, historisch aussehende Häuser ohne örtlichen Bezug und nahezu ohne feste Einwohner kennt man z. B. auch aus dem Hessenpark mit seinen aus ganz Hessen zusammengetragenen Fachwerkhäusern. Der Vergleich Disneyland mit der neuen Frankfurter Altstadt hinkt jedoch stark, denn alle in dem DomRömer-Areal rekonstruierten Bauten standen genau an der Stelle an der sie wieder errichtet wurden. Es wurde keine einzige Rekonstruktion an einem anderen Platz errichtet. Und es wurden nur Bauten wiederaufgebaut, bei denen gut dokumentierte Baupläne und Fotos mit dem Stichtag 1944 zur Verfügung standen. Darüber hinaus wurden in der Frankfurter Altstadt keine Kulissenbauten aus billigem Pappmaché, sondern Gebäude mit hochwertigen Materialien errichtet, die von einer hohen Handwerkskunst zeugen.
Bis ins Detail hat man sich nach eingehender Bauteilforschung bei den Fachwerkbauten in der Altstadt an das historische Vorbild gehalten. (18) Ein herausragendes Beispiel ist die „Goldene Waage“ die das Ergebnis jahrelanger Arbeit zahlreicher Handwerker aus ganz Deutschland ist. Die von den Vergoldern, Steinmetzen, Schmieden und Zimmerleuten verwendeten Materialien sind hochwertig und detailgetreu verarbeitet. Dort wo moderne Fassadenschichten in die Gebäude eingebracht wurden, mussten strenge Brandschutzauflagen und Dämmauflagen erfüllt werden. Die handwerkliche Rekonstruktion des Fachwerkhauses „Zur Goldenen Waage“ stützt sich auf zahlreich existierende Zeichnungen und Fotos, die detailreich die Bauweise und den Gebäudeschmuck und die Innenräume dokumentieren. Was mit der Goldenen Waage wieder erstand, kann mit Fug und Recht als handwerkliche Meisterleistung bezeichnet werden. Für das sichtbare Fachwerk und die Wellengiebel verwendeten die Zimmerer 300 bis 400 Jahre altes Eichenholz. 350 Bauteile umfasst alleine das Fachwerk. Für Schnitzereien und Profilierungen bearbeiteten die Handwerker eine Fläche von etwa 70 m² per Hand und verwendeten auch hier wieder zu 98 % altes Eichenholz. (19)
Bei den Altstadthäusern wurde auf eine abgestimmte Farbkomposition geachtet. Verwendet wurden1 anorganische Farbpigmente, wie sie auch im Mittelalter eingesetzt wurden. Erwähnenswert sind auch die vielen verwendeten Spolien, die ihre geschichtsreiche Authentizität in die Bauten einbringen. So wurden z. B. drei geschmiedete Gitter und 15 handbemalte Fliesen aus den Niederlanden, die den Krieg überstanden hatten, wieder in der Goldenen Waage eingebaut. Auch der Eckpfosten des Wendeltreppenturms war noch vorhanden, so dass der Architekt Jochem Jourdan den Kreisbogen der Arkaden rekonstruieren konnte. An Hand von historischen Aquarellen und Skizzen, Zeichnungen und Modellen konnten dann Zimmerleute, Dachdecker, Kunstschmiede und viele weitere ausgesuchte Fachleute die Goldene Waage mit einer hohen handwerklichen Qualität rekonstruieren. (20) Mehr Authentizität, Qualität und Fachverstand kann man kaum in ein Rekonstruktionsprojekt einbringen. Kein Wunder, das 2019 die europäische Immobilien-Fachmesse MIPEM in Cannes, die internationale Auszeichnung in der Kategorie Stadterneuerung dem DomRömer-Projekt zusprach. (21)
Entscheidend ist der Ort, an dem die Rekonstruktionen des DomRömer-Projekts verwirklicht wurde. Die wieder aufgebauten Altstadthäuser stehen im architektonischen und geschichtlichen Kontext mit ihrer Umgebung – dem Römer und dem Dom. Hier entfalten sie als städtebauliche Komposition ihre Wirkung, bzw. der Dom erzielt seine Wirkung durch die vorgelagerten, gedrungenen Altstadthäuser. Deshalb passt auch kein Betongebirge wie das Technische Rathaus auf das Areal. Nur an diesem Ort sind die rekonstruierten Bauten authentisch. Würde man die Altstadt reproduzieren und z. B. in China oder Dubai nachbauen, dann wäre dieser Kontext nicht gegeben. Alleine an diesem Beispiel sieht man, dass der hämisch verwendete Begriff Disneyland für das historische Altstadtareal in Frankfurt nicht passend ist. Neben den 15 Rekonstruktionen bzw. „schöpferischen Neubauten“, wurden auf dem Areal 20 weitere Neubauten hinzugefügt. Diese Neubauten – ein Zugeständnis an die Modernisten, sehen teilweise etwas glatt und künstlich aus, denn diese Gebäude haben so nie in der Altstadt gestanden. Aber selbst diese Bauten bestechen durch ihre Kleinteiligkeit und ihr kreatives Variantenreichtum und sollten nicht pauschal herabgesetzt werden.
Die Wahrheit ist also: Das DomRömer-Projekt steht mit seinen Rekonstruktionen für einen nahezu authentischen Wiederaufbau und hat mit einem Disneyland nichts zu tun. Jedes rekonstruierte Haus, war dokumentiert und stand genau an der entsprechenden Stelle. Der immer wieder vorgebrachte Vorwurf einer künstlichen Kulissenarchitektur lässt sich nicht mit Fakten unterfüttern. Traditionelle Handwerkskunst und wertvolle Materialien machen die Neue Altstadt zu einem weltweit beachteten Ort. Ein im Kontext mit Rekonstruktionen verunglimpfender Begriff wie "Disneyland" soll offenbar in erster Linie eine intellektuelle Unreife der Rekonstruktionsbefürworter assoziieren und die Fachwerkarchitektur als überholte Formensprache herabsetzen.
4.1.2 Sind Rekonstruktionen nicht eigentlich verboten?
Immer wieder, wie auch beim DomRömer-Projekt, behaupten Denkmalpfleger, dass Rekonstruktionen per se nicht erlaubt seien, da diese gegen die Charta von Venedig verstoßen würden. Doch dieses Argument ist natürlich völliger Unfug, denn weltweit sind fast alle bekannten Sehenswürdigkeiten nicht mehr im Original erhalten, sondern wurden teils mehrfach rekonstruiert. So sind z. B. der Markusturm in Venedig, die Marienkirche in Lübeck und die Altstadtbauten in Warschau allesamt Rekonstruktionen. Diese Gebäude gehören sogar dem UNESCO Weltkulturerbe an. Doch wie entstand überhaupt die Charta von Venedig mit ihrer strengen Auslegung, Rekonstruktionen zu untersagen?
Die ersten Grundlagen für die 1964 proklamierte Charta wurden schon fast hundert Jahre früher gelegt. Nach dem Sieg über Frankreich und der Gründung des Deutschen Reichs 1871 sollte die nationale Größe und Einigkeit Deutschlands auch in seinen mächtigen Bauwerken sichtbar werden. Die Ruine des Heidelberger Schloss sollte in diesem Sinne als Nationaldenkmal wiederaufgebaut werden. Es kam zu einem Denkmalstreit zwischen Architekten und Denkmalschützern. Die um 1900 in einer Streitschrift geäußerte Meinung des Kunsthistorikers Georg Dehio „Konservieren, nicht Restaurieren“ setzte sich am Ende durch. Eine richtige Entscheidung, denn die romantische Ruine entfachte am Nordhang des Neckars eine besondere Ästhetik. Zudem bestand die Gefahr, dass eine wiederaufgebaute Ruine als kitschig-patriotisches Denkmal missbraucht wurde. Der Aufruf von Dehio ist als Zeugnis der damaligen Zeit zu betrachten, hat jedoch als Richtschnur bis in die heutige Zeit einen hohen Stellenwert bei Denkmalschützern. Baudenkmäler werden demnach „konserviert“, d.h. alle sichtbaren Zeitschichten am Gebäude werden möglichst authentisch erhalten. So wird restauratorischen Zerstörungen vorgebeugt und es kann nichts am Gebäude „hinzugedichtet“ werden, was vielleicht niemals vorhanden war. Doch oftmals sehen die bei denkmalgerechten Restaurierungen herausgestellten Zeitschichten künstlich statt authentisch aus. 1
Denkmalpfleger sehen sich, im Geiste der Charta von Venedig, als Hüter der historischen Substanz. Doch die Substanz ist sehr fragil, denn Regen, Frost und Hitze nagen den alten Bauwerken. Wollte man alle alten Häuser nur noch konservieren und nicht mehr restaurieren, dann wäre von den meisten Baudenkmälern nicht mehr viel mehr wie ein zerbröselter Steinhaufen zu sehen. Doch schlimmer noch setzen Feuer und Krieg den Baudenkmälern zu. Das Dilemma dabei: Bei völlig zerstörten Gebäuden gibt es nichts mehr zu konservieren. Dehio selbst nahm seine Grundsätze dann auch nicht immer so ernst und unterstützte z. B. die Rekonstruktion des 1906 abgebrannten Hamburger Michel. (22) Einen tiefen Einschnitt im Umgang mit Denkmälern, gab es durch die verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Die Feuerstürme des Bombenkrieges führten zu tausenden Totalverlusten. Nach Kriegsende wurden viele Kirchen, Rathäuser und Baudenkmäler wieder aufgebaut, oder besser gesagt rekonstruiert. Die eigentlich auf Substanz pochende Denkmalpflege war nun sichtlich von der Nachkriegssituation überfordert. Trotzdem fanden die Prinzipien von Dehio „Konservieren, nicht Restaurieren“ Eingang in die Konzeption der modernen Denkmalpflege. Die 1964 bei einem Kongress von Architekten und Denkmalpflegern beschlossenen Charta von Venedig sprach in diesem Sinne ein Verbot von Rekonstruktionen aus. Lediglich eine Anastylose könne in Betracht gezogen werden, das heißt, das Wiederzusammensetzen vorhandener, jedoch aus dem Zusammenhang gelöster, originaler Bestandteile. Denkmalpfleger sollen also nicht restaurierend eingreifen, sondern die Pflege und Instandsetzung in den Mittelpunkt stellen. Die Spuren des Verfalls und neu hinzugefügte Teile am Denkmal sollen dabei erkennbar sein.
Ein Gedanke der die Architekten und Denkmalschützer der 1964 beschlossenen Charta von Venedig leitete, war wohl auch, dass man historische Bauten besonders vor Abriss schützen müsste, da es unmöglich sei, diese originalgetreu und authentisch wieder aufzubauen. Doch auf die Ausnahmesituation der massenhaften Kriegszerstörung fand die Charta keine befriedigende Antwort. Das Wort „Krieg“ kam noch nicht einmal in der Charta vor. Offensichtlich wollte die Charta, aus welchen Gründen auch immer, kein eindeutiges Statement zur Rekonstruktion von kriegszerstörten Städten abgeben. Doch wie sollte mit den zahlreichen, im Bombenkrieg ausradierten Stadtkernen und pulverisierten Baudenkmälern umgegangen werden? Sollten stadtbildprägende Bauten und ihre Geschichte damit für immer ausgelöscht sein? Von den etwa 1.200 Fachwerkhäusern in der Frankfurter Altstadt blieb nur das Haus Wertheim stehen. Die starren Regeln der Charta, die auf den massenhaften Verlust von Baudenkmälern im Krieg keine befriedigende Antwort gab, wurden entsprechend in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas nach dem Krieg regelmäßig gebrochen.
Blickt man auf Frankfurt am Main, so sind auch dort fast alle Sehenswürdigkeiten rekonstruierte Bauten. Man denke nur an das Goethehaus, die Paulskirche und die Alte Oper, die im Krieg zerstört wurden und nach dem Krieg aufwendig wiederaufgebaut wurden. Was wäre Frankfurt ohne diese rekonstruierten Bauten? Die Behauptung „Rekonstruktionen sind nicht erlaubt“ wird offensichtlich nur von Architekten hervorgebracht, die Rekonstruktionen verhindern möchten, um eigene „moderne“ Entwürfe durchzusetzen. Große Bedenken werden allerdings von diesen Architekten immer nur geäußert, wenn es sich um traditionelle Architektur handelt. Wurden in der Vergangenheit moderne Bauten rekonstruiert, wie beispielsweise das Bauhaus-Gebäude in Dessau von Walter Gropius oder der Weltausstellungs-Pavillon von Mies van der Rohe in Barcelona, so gab es von der Architektenzunft keinerlei Einwände.
Doch noch einmal zurück zum Rekonstruktionsbegriff. Eine Rekonstruktion kann mal eigentlich nur als eine größtmögliche Annäherung an den Originalbau begreifen. Eine hundertprozentige Kopie ist noch nie bei einer Rekonstruktion erreicht worden, da alleine schon die Baumaterialien (Holzcharakter, Steinstruktur etc.) immer von einer anderen Qualität und Beschaffenheit sind. Jede Rekonstruktion ist im Prinzip ein nachahmender Neubau und kann alleine deshalb schon nicht unter den strengen Regeln der Charta von Venedig fallen. Auch die 15 „rekonstruierten“ Gebäude im DomRömer-Areal wurden nicht völlig originalgetreu rekonstruiert. (23) Aber eine annähernde Rekonstruktion als „schöpferische Neubauten“ ist auch völlig ausreichend, um ein historisches Gebäude im Stadtgefüge als Zeugnis der Vergangenheit für die Bürger und Besucher als „Erinnerungsarchitektur“ sichtbar und erlebbar zu machen.
Fest steht: Das blinde Befolgen der Charta von Venedig ist eine unnötige, selbst auferlegte Selbstbeschränkung der Denkmalschützer. Dabei sind Nachahmung, Zitat und Wiederholung seit Jahrhunderten Bestandteil in Kunst und Architektur. (24) „Die strikte Ablehnung von Rekonstruktionen, die als Neubauten überhaupt nicht in den Bereich der Denkmalpflege fallen, ist häufig nur ein Moralisieren gegenüber anderen Auffassungen“, stellt der Architekturhistoriker Winfried Nerdinger fest. (25) Nerdinger erarbeitete 2010 für die Münchener Pinothek der Moderne die bahnbrechende Architekturausstellung „Geschichte der Rekonstruktion. Konstruktion der Geschichte“ und wies dabei nach, dass Rekonstruktionen seit Jahrhunderten eine gängige und bewährte Kulturtechnik sind. Doch immer noch reiben sich viele Kunsthistoriker und Denkmalschützer an Rekonstruktionen. Zunehmend ist dabei eine intellektuell abgehobene, akademische Diskussion einer Architekturelite zu beobachten. Doch mit der Lebenswirklichkeit der Stadtbewohner hat diese Diskussion wenig bis gar nichts zu tun hat: Die Menschen möchten mit der Wiederherstellung von Baudenkmälern keine ideologische Revision der Geschichte herbeibeschwören, sondern ganz einfach ihre geschundenen Städte reparieren und die bauliche Sinnlichkeit, Schönheit und Eleganz im Stadtgefüge zurückgewinnen. Es ist also nicht mehr und nicht weniger wie ein legitimer Wunsch, den Stadtbürger seit jeher auf der ganzen Welt verfolgen.
4.1.3 War der Altstadtwiederaufbau zu teuer?
Zunächst muss man feststellen: Mittelmäßigkeit beim Wiederaufbau von historischen Gebäuden sollte grundsätzlich vermieden werden. Eine hochwertige Bauausführung ist zwar nicht billig, aber für den authentischen Charakter der Altstadt zwingend notwendig. Im Übrigen: Wer billig baut, der baut selten nachhaltig und erschafft damit eine gebaute Wegwerfgesellschaft. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist die Nachhaltigkeit beim Bauen unverzichtbar. Wer also hochwertig und langlebig baut – wie in der Frankfurter Altstadt, der trägt zu einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen bei.
Kommen wir zu den finanziellen Aufwendungen für das DomRömer-Projekts. War der Wiederaufbau eines Teils der Altstadt zu teuer? In den immer wieder publizierten Gesamtkosten sind auch der sowieso notwendige Abbruch des asbestverseuchten Technischen Rathauses und der Umbau der Tiefgarage enthalten. Selbst projektfremde Kosten wie die technische Erneuerung der Römerberg Ostzeile wurden auf die städtische Dom Römer GmbH hinzugerechnet. (26) Von den 200 Mio. Euro Kosten für das Projekt müssen 70 bis 80 Mio. Euro1 als Verkaufserlöse für die Wohnungen abgezogen werden und weitere 50 Mio. Euro an Aufwendungen für die Infrastruktur sowie für Gebäude und Einrichtungen, die ins Anlagevermögen der Stadt übergegangen sind. Außerdem wurden mehrere Millionen Gebühren gezahlt und Erbbauzinsen von der Stadt eingenommen. Heißt also unter dem Strich, dass für die Stadt wohl deutlich weniger als 100 Mio. Euro „Verlust“ übriggeblieben sind. (27)1 Doch selbst dieses Geld ist nicht verloren gegangen, denn die vielen Millionen Euro wurden ja nicht in den „Main versenkt“, sondern wurden in handwerkliche und bauplanerische Leistungen, Baumaterialien uvm. investiert. Jeder Euro, den die Stadt in das Projekt reingesteckt hat, wurde vielfach in der Stadt und in der Region wieder ausgegeben. Diese betrifft zum Beispiel die Einnahmen der ausführenden Planer und Handwerker, die ihrerseits Rechnungen an die Zulieferer beglichen haben.
Die Investitionen der Stadt für die Altstadt sind auch auf Dauer gut angelegt. Einer Studie nach sind historische Gebäude wertsteigender als moderne Bauten. Sie steigern die Rendite und senken das Investmentrisiko. (28) So mehren schöne Städte auch die Attraktivität und damit den Reichtum in einer Stadt: Der Immobilienwert wird erhöht, der Zuzug steigt und die Zahl der Touristen nimmt zu. Eine reiche Stadt kann ihren Bürgern wiederum gute Kindergärten, Schulen und Kultureinrichtungen bieten. Die Investition in schöne Städte lohnt sich daher mehr denn je. Darüber hinaus erhält die Stadt über die im kommunalen Eigentum verbliebenen Ladenlokale auch Mieteinnahmen. Doch nicht nur die Stadtverwaltung profitiert von der Altstadt: Als touristischer Publikumsmagnet werden in der Altstadt und der Umgebung neue Arbeitsplätze geschaffen. Zudem strahlt die durch die Altstadt allgemein erhöhte Besucherfrequenz auch auf die Einkaufsstraßen in der Innenstadt aus. Durch die Vielzahl der Altstadtbesucher werden kontinuierlich Einnahmen in die Kassen der Hotels, Gaststätten und Ladenlokale gespült. Es ist schon erstaunlich, dass sich ausgerechnet bei der Altstadt – die weitgehend im Kostenrahmen geblieben ist – die Architektenlobby über die angeblich zu hohen Kosten echauffiert. Es gab dagegen bisher so gut wie keine Kritik über millionenschwere Glastürme oder Straßenbauprojekte wie der über 50 Millionen teure Umbau des Kaiserlei-Kreisels (29). Es liegt also auch hier die Annahme sehr nahe, dass die Kostenfrage nur mit einer solchen Vehemenz hervorgebracht wird, weil das Geld nicht für moderne Neubauprojekte, sondern größtenteils für Rekonstruktionen verwendet wurde. 200 Millionen sind viel Geld, doch dieses Geld wurde gut in ein Projekt investiert, welches dauerhafte Einnahmen für die Stadt generiert, Arbeitsplätze schafft und zahlungskräftige Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt zieht.
Die Investitionen der Stadt für die Altstadt sind auch auf Dauer gut angelegt. Einer Studie nach sind historische Gebäude wertsteigender als moderne Bauten. Sie steigern die Rendite und senken das Investmentrisiko. (28) So mehren schöne Städte auch die Attraktivität und damit den Reichtum in einer Stadt: Der Immobilienwert wird erhöht, der Zuzug steigt und die Zahl der Touristen nimmt zu. Eine reiche Stadt kann ihren Bürgern wiederum gute Kindergärten, Schulen und Kultureinrichtungen bieten. Die Investition in schöne Städte lohnt sich daher mehr denn je. Darüber hinaus erhält die Stadt über die im kommunalen Eigentum verbliebenen Ladenlokale auch Mieteinnahmen. Doch nicht nur die Stadtverwaltung profitiert von der Altstadt: Als touristischer Publikumsmagnet werden in der Altstadt und der Umgebung neue Arbeitsplätze geschaffen. Zudem strahlt die durch die Altstadt allgemein erhöhte Besucherfrequenz auch auf die Einkaufsstraßen in der Innenstadt aus. Durch die Vielzahl der Altstadtbesucher werden kontinuierlich Einnahmen in die Kassen der Hotels, Gaststätten und Ladenlokale gespült. Es ist schon erstaunlich, dass sich ausgerechnet bei der Altstadt – die weitgehend im Kostenrahmen geblieben ist – die Architektenlobby über die angeblich zu hohen Kosten echauffiert. Es gab dagegen bisher so gut wie keine Kritik über millionenschwere Glastürme oder Straßenbauprojekte wie der über 50 Millionen teure Umbau des Kaiserlei-Kreisels (29). Es liegt also auch hier die Annahme sehr nahe, dass die Kostenfrage nur mit einer solchen Vehemenz hervorgebracht wird, weil das Geld nicht für moderne Neubauprojekte, sondern größtenteils für Rekonstruktionen verwendet wurde. 200 Millionen sind viel Geld, doch dieses Geld wurde gut in ein Projekt investiert, welches dauerhafte Einnahmen für die Stadt generiert, Arbeitsplätze schafft und zahlungskräftige Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt zieht.
Die Altstadt ist ein neuer einzigartiger Markenbaustein für die Stadt, für die sich jeder investierte Euro bezahlt macht. Es können mit der Altstadt ganz neue Besuchergruppen angesprochen werden und das Image einer kühlen, unattraktiven Geschäftsstadt kann bei Seite geschoben werden. Die Anzahl der Besucher und Touristen der Altstadt ist immens, denn Frankfurt wird nicht mehr nur als Flughafenzwischenstation gesehen, sondern als eine besuchswerte Stadt, für die auch gerne die Aufenthaltsdauer verlängert wird. Gerade dieses ist ein geldwerter Vorteil für die Stadt, Händler, Gastronomen und Hoteliers. In Frankfurt Leben ca. 70 000 Beschäftigte vom Tourismus, der zudem für die Stadt etwa 120 Millionen Euro Steuereinnahmen (Stand 2016) bringt – ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, der weiter gefördert werden sollte. Bauprojekte, die direkte Arbeitsplätze schaffen, sind selten. Die Neue Altstadt ist ohne Zweifel ein beeindruckender Jobmotor: So waren alleine 80 Gästeführer vor der Coronakrise mit den Altstadtführungen ausgelastet. (30) Hinzu kommt eine hohe Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze in den Läden und in den Gastronomiebetrieben des Quartiers. Ein weiterer Punkt ist die so genannte „Umwegrentabilität“, also zusätzliche Kaufkraft durch Besucher, die neben ihrem Hauptziel „Altstadt“, noch andere Ziele in der Stadt ansteuern und dort auch für Mehreinnahmen sorgen. Unter dem Strich gesehen wurde durch die Altstadtbesucher die Kaufkraft in der Stadt deutlich erhöht. Die durch die Neue Altstadt generierten Einnahmen für die Stadt sind insgesamt gesehen, deutlich höher wie die Ausgaben für den Bau der Neuen Altstadt.
4.1.4 War die historische Altstadt ein Viertel ohne hochwertige Architektur?
Bis zum Untergang der Frankfurter Altstadt im Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges, wohnten viele Arbeiter und verarmte Menschen in der Altstadt. Es gab zwar eine moderne Kanalisation (1867) und eine öffentliche Stromversorgung,1 doch weite Teile der Altstadt waren trotz der Altstadtsanierung nach dem ersten Weltkrieg dem Verfall preisgegeben. Die Altstadt war jedoch nicht immer nur ein Arme-Leute-Viertel, sondern besaß auch stolze Bürgerhäuser von wohlhabenden Händlern, Gastwirten und Handwerkern. Bauten mit kollektivem Erinnerungswert sind insbesondere das „Haus zur Goldenen Waage“ als Beispiel eines reichausgestatteten Bürgerhauses der Renaissance, das Gebäude „Rotes Haus“, als hervorragendes Beispiel der Gotik, das „Haus Rebstock“ mit seinen verzierten doppelten Holzgalerien und dem Messehof sowie das Spätbarock umgebaute „Haus Esslinger“ als Goetheort. (31) Seinen Aufenthalt im Haus Esslinger beschrieb Goethe ausführlich sogar in seinem Werk „Dichtung und Wahrheit“. In dem kulturhistorischen Kleinod wohnte seine lebenslustige Lieblingstante Melber. Nun hat das Struwwelpeter-Museum Räume in dem rekonstruierten Haus Esslinger und im Nachbarhaus Alter Esslinger bezogen.
Ein bedeutender Bereich der Altstadt war auch der im Weltkrieg zerstörte Hühnermarkt, der innerhalb des DomRömer-Projektes wieder aufgebaut wurde. In der Mitte des Platzes steht der 1895 eingeweihte Stoltze-Brunnen. 1981 bis 2016 wurde er auf dem Stoltzeplatz hinter der Katharinenkirche aufgestellt und erst mit dem DomRömer-Projekt konnte er wieder auf seinen alten Platz am Hühnermarkt zurückkehren. Die wieder hergestellte Platzrandbebauung des Hühnermarktes umfasst eine Reihe namhafter Bürgerhäuser wie das erwähnte Haus Esslinger, die teilweise von großer Bedeutung für die Stadtgeschichte waren. Interessant ist z. B. das ursprünglich um 1405 entstandene errichtete dreigeschossige Haus Schildknecht. Das nordöstliche Eckgebäude des Hühnermarktes hatte einen großen Überhang und gehörte im Zusammenwirken mit seinen Nachbargebäuden zu den pittoresksten Winkeln in der Altstadt. Das Renaissancegebäude der Schuhmacherzunft wies eine reiche Bemalung auf. Der Neubau des Haus Schildknecht ist zwar einfacher gestaltet, fügt sich aber harmonisch in das rekonstruierte Ensemble des Hühnermarktes ein.
Die Behauptung, die Altstadt war ein Viertel ohne hochwertige, erhaltenswerte Altstadtarchitektur, entspricht also nicht der Wahrheit. Die Altstadt zwischen Dom und Römer ist zudem das wichtigste Zeugnis der Stadtgeschichte, denn hier wurde die Stadt gegründet und zahlreiche Kaiser und Könige gekrönt. Auf der Anhöhe, in der Nähe der Furt an der Fahrstraße, ließen sich die ersten Menschen auf dem heutigen Frankfurter Stadtgebiet nieder. In der Altstadt gab es mit der Kaiserpfalz auch die ersten Steinbauten. Die mächtige Königshalle ist ein bedeutendes Zeugnis der Baukunst und Geschichte. Die Pfalzkirche, als Vorgängerbau des heutigen Kaiserdoms, entstand auf dem Gebiet. Und dort wo das historische Museum seinen Platz hat ist u.a. der noch aus der Stauferzeit stammende, älteste Hafen von Frankfurt am Main zu finden. Vielfach wird auch behauptet, die heutige „sauber-geleckte“ Altstadt entspreche nicht der Realität, denn die Altstadt sei früher dunkel und dreckig gewesen. Das ist natürlich totaler Unsinn: Wäre die Altstadt nicht im Bombenhagel des zweiten Weltkrieges verglüht, dann wäre diese nicht weiter verfallen, sondern wäre so, wie alle anderen Altstädte in Deutschland heute auch, mehrfach saniert und herausgeputzt worden. Auch die Mieterstruktur hätte sich natürlich in den letzten 70 Jahren verändert: Aus dem Arme-Leute-Viertel wäre ein zentrumsnahes Viertel mit gut situierten Mietern geworden. Diese Entwicklung kann man bedauern, aber die Altstadt hätte sich auch ohne Kriegszerstörungen zu dem hochpreisigen Wohnviertel entwickelt, das wir heute als wiederaufgebaute Altstadt kennen.1
4.1.5 Wurde die neue Altstadt für Touristen statt für die Bürger gebaut?
Die Frankfurter Altstadt sorgt unbestrittener Weise für eine große Resonanz bei der Stadtwerbung. Etwa 8.000 organisierte Touristen schlenderten vor der Corona-Krise jeden Tag durch die Altstadt. (32) Doch das wieder aufgebaute Areal der Altstadt wurde nicht nur für die Touristen, sondern ganz besonders auch für die Frankfurter Bürger gebaut. Städte sind für die Menschen da und die Altstadt ist das Herz der Stadt. Frankfurt ist ein multikultureller „Meltingpoint“, hektisch, großstädtisch und oftmals anonym. Die Altstadt hat eine wichtige, identitätsstiftende Funktion und stellt, mit ihrem nostalgischen Charme und mit ihrer baulichen Geschlossenheit, etwas ganz Besonderes für das ansonsten eher unruhige und zerfaserte Stadtbild dar.
Der Bau des Technischen Rathauses steht für eine Zeit, in der sich die Politik scheinbar nach Belieben über den Bürgerwillen hinwegsetzen konnten. Dagegen wurden beim DomRömer-Projekt die Bürger im Vorfeld der Umsetzung, durch eine Planungswerkstatt mit einbezogen. Viele Anregungen aus dieser Werkstatt wurden beim Bau der Altstadt berücksichtigt. Der Wiederaufbau eines Teils der Altstadt war keine bloße Idee der Politiker, sondern war schon vorher in den Köpfen der Frankfurter Bürger fest verankert. Wer sich Umfragen vor dem Bau des Altstadtareals anschaut, der sieht auch wie sehr sich die Frankfurter wieder ein historisches Herz in ihrer Stadt gewünscht haben: So sprachen sich bereits 2006 in einer Umfrage 66 % der befragten Bürger für einen historischen Wiederaufbau aus. Nur 26 % votierten für einen modernen Wiederaufbau. (33) 2013 wurden Unterschriften für einen geplanten Bürgerentscheid gesammelt – in kürzester Zeit unterschrieben über 10.000 Bürger für eine vollständige Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt. (34) Bereits für den Aufbau der Römerberg-Ostzeile in den achtziger Jahren stimmten in einer Umfrage 46 % „…für eine Bebauung in einem dem historischen Charakter angepassten Stil“ und „…41 Prozent sogar für die ‚Rekonstruktion historischer Frankfurter Häuser‘.“ (35)
Wer sich heute auf dem wiederaufgebauten Altstadtareal umschaut, der sieht, wie die Frankfurter Bürger sich in den dortigen Restaurants und Cafés treffen und sich mit dem dortigen Angebot identifizieren. Während auf dem Römerberg vor allem Touristen und Hochzeitspaare das Bild dominieren, ist auf dem DomRömer-Areal eine größere Mischung von Touristen und Einheimischen zu erkennen. Es ist ein Integrationsort, der gleichzeitig Heimeligkeit, Tradition und Weltoffenheit ausstrahlt – also genau die Attribute, die Frankfurt am Main schon immer als Stadt ausgemacht haben. Jeder Ort, der in das Thema Identifikation und Integration einzahlt ist wichtig für die Stadt. In Städten mit hohem Identifikationsgrad erwächst auch der Bürgerstolz, so dass Menschen sich in der Stadt engagieren und etwas für die Allgemeinheit spenden und stiften. Der vielbeschworene Zusammenhalt in der Gesellschaft – „der Kitt der Gesellschaft“ – entsteht an integrativen Begegnungsorten wie Schulen, Arbeitsstellen und besonderen Plätzen in der Stadt. Die neue Altstadt ist ein solcher, lebendiger Ort der Begegnung wie er ansonsten in der Frankfurter Innenstadt nur selten zu finden ist. Hier treffen sich Menschen aus verschiedenen Stadtteilen und aus verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten. Die Altstadt ist ein gemeinsamer, identitätsstiftender Raum für die gesamte Stadtgemeinschaft und wurde dementsprechend natürlich nicht nur für die Touristen gebaut.
4.1.6 Hat man beim Altstadtprojekt die Expertenmeinung übergangen?
Bürgerbefragungen sind unter modernen Architekten nicht allzu beliebt, denn regelmäßig entscheiden sich die Bürger für traditionelle, statt für moderne Bauentwürfe. Doch grundsätzlich bleibt trotzdem die Frage: Sollten Bürger überhaupt mitbestimmen, in welcher Form neue Quartiere in der Stadt bebaut werden? Schließlich gibt es ja ausgewiesene Experten wie ausgebildete Architekten und Stadtplaner, die ja eigentlich wissen sollten, was sie tun. Bei der Altstadt waren sich die meisten dieser Experten einig: In der Altstadt sollte es keine Rekonstruktionen geben. Die Moderne sei die Architektur der Zeit. Außerdem wollten die Architekten nicht etwas nachbauen, was es schon gab, sondern eigene Entwürfe umsetzen. Doch der Auftraggeber bestimmt natürlich was am Ende gebaut wird. Und bei der Neuen Frankfurter Altstadt war die Stadt Frankfurt der Bauherr. Es ist also mehr als nachvollziehbar, dass die Bürger der Stadt sich bei diesem stadtbildprägenden Quartier aktiv mit einbringen durften. Es war auch kein Zufall, dass die Bürger sich für die Altstadt traditionelle und nicht moderne Bauten wünschten. Immer wieder mussten die Menschen in der Vergangenheit ohnmächtig mit ansehen, wie nach dem Krieg immer mehr alte Gebäude verschwanden und die Stadt dadurch immer mehr ihr Gesicht verlor. Die Bürger setzten sich deshalb zunehmend für die Bewahrung des verbliebenen historischen Erbes ein. Dabei setzen sich auch immer mehr junge Menschen für die Bewahrung traditioneller Architektur und für Rekonstruktionen ein. Die Nachkriegsgeneration hat sehr radikal ihre geschmacklichen Vorstellungen eines modernen Stadtbildes umgesetzt. Es ist deshalb mehr als legitim, dass die heutige Generation sich erlaubt ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Dass diese dabei ein anderes Bild von zeitgemäßer Architektur hat und auch vielfach Rekonstruktionen befürwortet sollte man dieser Generation unbedingt zugestehen.
Auch für zukünftige Bau- und Rekonstruktionsprojekte sollte man mehr den Bürgern, als einigen Experten trauen. Die meisten Menschen besitzen ein gutes Gefühl für Proportionen von Gebäuden, für harmonische Farben und für Werkstoffe. Deswegen ist Stadtgestaltung bestimmt keine Geschmacksfrage, sondern eine Mehrheit der Bürger kann ganz genau sagen, ob etwas schön und gelungen ist. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen, die beweisen, dass eine monotone Architektur sogar die Menschen krank machen kann. Im Zuge der Evolution bevorzugt der Mensch Abwechslung: Vielfältige Muster sind positiv besetzt, weil sie Nahrung und Überleben garantieren – harte Linien und dominante Rechtecke lösen dagegen eher ein Unbehagen aus. (36) Die Lehren und Erkenntnisse der Architekturpsychologie finden bisher leider noch keine große Beachtung in der Stadt- und Bauplanung. Das fertiggestellte DomRömer-Projekt hat gezeigt, das Fassaden auch in der heutigen Zeit abwechslungsreich und von hoher gestalterischer Schönheit sein können. Warum dieser Sinn für Ästhetik und für ein menschenwürdiges, bauliches Umfeld vielen Architekten, Bauherren und Politikern in den letzten Jahrzehnten immer wieder abhandengekommen ist, bleibt derweil ein ungelüftetes Geheimnis.
Der von einigen Architekten eingeforderte Anspruch in der heutigen Zeit nur modern zu bauen, wurde von den Bürgern beim Altstadtprojekt zu Recht hinterfragt. Bei wichtigen, städtischen Bauprojekten wie bei der Altstadtbebauung sollten sich Architekten, Stadtplaner, Politiker und Bürger auf Augenhöhe austauschen können. Die Meinung von Experten ist wichtig, sie wurde auch nicht übergangen, sondern beim DomRömer-Projekt mit dem Gestaltungsbeirat – einem Sachverständigengremium aus Architekturexperten – ausreichend berücksichtigt. Die ausgewogene Mischung aus Bürger- und Expertenmeinung hat am Ende beim Frankfurter Altstadtprojekt zu einem bestmöglichen Ergebnis geführt.
4.2 Die Altstadtlüge
Sind die wieder hergestellten Altstadtbauten verlogene, heuchlerische Attrappen, die die Geschichte neu schreiben möchten? Die Fakten sprechen allerdings eine andere Sprache: Die Altstadt ist kein gebautes Lügengebilde, sondern ein unverzichtbarer Teil des kulturellen Gedächtnisses der Stadt.
4.2.1 Verklärt der Altstadtwiederaufbau die Geschichte?
Immer wieder wurde von Kritikern des DomRömer-Projektes eine politisch inkorrekte Geschichtsvergessenheit angeprangert, die mit der Rekonstruktion historischer Gebäude verbunden sei. Es sei ein Ausradieren der Kriegswunden und es würde die Spuren der Kriegsschuld ausblenden. Ein historisierender Wiederaufbau sei demnach eine Reinwaschung und eine „Lüge“, die die Tatsache der Kriegszerstörung infolge der Politik des nationalsozialistischen Terrorregimes zu vertuschen versuche. Die Wahrheit ist: Auf dem wieder errichteten, historischen Altstadtareal wird Erinnerungskultur für viele Generationen erst sichtbar. Keiner kann sich die Begebenheiten im alten Frankfurt anhand von vergangenen Erzählungen und vergilbten Fotos vorstellen. Nur wenn man die Orte der Geschichte sehen und anfassen kann, können Ereignisse und Schauplätze erfasst werden. Es ist sogar eher so, dass die konsequente Beseitigung der historischen Orte nach dem Krieg zur Geschichtsvergessenheit beitrug. Wer alle Spuren beseitigt und in der Stadt nur die Moderne sieht, der kann keinen Bezug mehr zu den geschichtlichen Spuren der Stadt finden. Gute Beispiele sind das Technische Rathaus und das historische Museum aus den siebziger Jahren. Kein Mensch Stand vor diesen Betonmonstern und hat durch diese „Brüche im Stadtbild“ eine Erinnerung an die Grauen des Weltkrieges heraufgerufen. Im Gegenteil: Diese Bauten haben dazu beigetragen, dass man die Altstadt und die Zerstörungen des zweiten Weltkrieges komplett vergessen hatte. Es gab kaum einen Ort mehr in der Altstadt, der irgendeine Erinnerung an die Geschichte hervorgerufen hätte. Man wollte nach dem Krieg einen Neuanfang und sich mit der modernen Architektur von der unheilvollen Geschichte absetzen. Das war ein historischer Fehler, denn wo keine Geschichte mehr sichtbar ist und Orte der Erinnerung ausgelöscht sind, ist es bis zur Geschichtsvergessenheit nicht mehr weit. Erst mit der Wiedererrichtung der Altstadt ist in der Stadt wieder eine Diskussion in Gang gekommen, die sich auch mit Krieg, Kriegswunden und Kriegsschuld befasst. Das lange Schweigen und Verdrängen der Nachkriegszeit ist gebrochen. Der Altstadtwiederaufbau verklärt nicht die Vergangenheit und die Geschichte, sondern erklärt einen großen Teil der Stadtgeschichte. Der allseits beklagten Kultur- und Geschichtsvergessenheit wurde mit dem DomRömer-Projekt entgegengetreten. Es gibt nur wenige Orte der Erinnerungskultur in Frankfurt am Main. Mit der Altstadt ist ein weiterer, geschichtsreicher Ort zum Besinnen und Nachdenken hinzugekommen.
Von den einstmals 2000 historischen Gebäuden innerhalb der Stadtmauer wurden lediglich 15 rekonstruiert. Die neue Altstadt macht auf diesem winzigen Areal trotzdem die jahrhundertealte Geschichte erlebbar. Stadtführer und Pädagogen können ihren Besuchern und Schülern jetzt viel leichter einen Einblick in die Geschichte Frankfurts geben. Zusammenfassend kann man sagen, dass das DomRömer-Projekt in keiner Weise eine Geschichtsfälschung betreibt, sondern im Gegenteil die städteräumliche Fassung des Krönungsweges in der Altstadt erlebbar macht und damit zum Geschichtsverständnis beiträgt. Die wiederaufgebauten Fachwerkgebäude mit ihren alten Fragmenten verbinden uns mit der Geschichte der vergangenen Generationen. Die Altstadt hat einen Impuls gesetzt, der sich auch in unzählige Veröffentlichungen und Bücher zu dem Thema ausdrückt. Noch nie wurde sich in der Stadt so mit Geschichte auseinandergesetzt wie beim Bau der Neuen Altstadt. Wer konnte etwas mit dem Krönungsweg und mit Karl den Großen als Gründungsvater bzw. Stadtpatron der Stadt 794 n. Chr. anfangen? Und wer hat sich vorher für die Altstadtsanierung der Nazis interessiert, die Kommunisten und Arbeiter in der Altstadt vertreiben wollten? Kaum jemand interessierte sich vorher für die bewegte Geschichte im Herzen der Stadt. Die Überbauung der Altstadt mit dem Technischen Rathaus hatte die Menschen nicht an die Geschichte erinnert, sondern diese mehr und mehr vergessen lassen.
4.2.2 Steht die Altstadt für Naziarchitektur?
Der vielleicht unsinnigste, kritische Ansatz der Rekonstruktionsgegner ist die Verquickung der Altstadt mit der Zeit des Nationalsozialismus. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, wird aber in erstaunlicher Weise immer wieder in Verbindung gebracht. Als Beweis für die Nähe der Altstadt zur Naziarchitektur werden z. B. gerne Verbindungen zu rechtspopulistischen Parteien gesehen, die ja auch die Altstadt befürworten würden. (37) Das ist natürlich ziemlich scheinheilig, denn nahezu alle Parteien und Bürger haben sich seinerzeit für das DomRömer-Projekt ausgesprochen. Gerne wird auch die Architektur der Altstadt als ewiggestrige Naziarchitektur abgetan. Die Wahrheit ist: Keines der rekonstruierten, historischen Altstadthäuser wurde von einem nationalsozialistischen Architekten oder Bauherren geschaffen. Wie sollte das auch sein, wenn man bedenkt, dass die originalen Altstadthäuser teilweise vor hunderten von Jahren gebaut wurden. Beispiel Goldene Waage: Dieser Bau hat sich im Jahr 1619 ein emigrierter, holländischer Glaubensflüchtling erbauen lassen. Die Altstadt war schon immer ein Ort gelebter Toleranz: Zufluchtsstätte von Migranten, einfachen Arbeitern und Armen. Alles das hassten die Nazis. Die Frankfurter Altstadt und deren Bewohner waren den Machthabern im Dritten Reich ein Dorn im Auge. Zwar gab es eine so genannte Heimatarchitektur mit aufgeräumten Musterbauten auf dem Lande, doch die Fachwerkbauten in der städtischen Altstadt gehörte nicht zum bevorzugten Baustil in der Zeit des Nationalsozialismus. Die in der NS-Zeit vorgenommene Altstadtsanierung war eine reine Propagandashow für die „Stadt des Handwerks“. Die verarmte Wohnbevölkerung in der Altstadt wurde dabei zu asozialen und verbrecherischen Kommunisten abgestempelt. Weitere Altstadtumbaupläne der Nazis wurden durch den einsetzenden Bombenkrieg beendet. „Wie wenig die Nazis von der historischen Bausubstanz übriggelassen hätten, sollten die bedenken, die einen Zusammenhang zwischen Fachwerk und Faschismus herstellen wollen, um Rekonstruktionen zu desavouiren.“. (38)1 Die Faschisten hätten übrigens auch nicht die Altstadt wiederaufgebaut. Hitlers Generalbauinspektor Albert Speer stellte 1943 in einer Rede zur Wiederaufbauplanung fest: „…Soweit die Altstädte zerstört sind, wird man diese nicht wieder aufbauen.“ (39) Für Frankfurt am Main hatten die Nazis eine besondere Vorstellung: Als „Mahnmal an die Verbrechen der Feinde“ sollte die im Weltkrieg zerstörte Altstadt als „…eine durchgrünte Nazi-Paraphrase des antiken Forum Romanum“ dienen – d.h. also nur noch ein Ruinenpark sein. (40)
Der Krieg zerstörte nicht nur die Häuser, sondern zerstörte auch die ursprüngliche Wohnstruktur. Von der ursprünglichen Altstadtbevölkerung war nach Ende des verheerenden Krieges fast nichts mehr übrig: Nach dem Krieg verblieben von den ursprünglich einmal 15.272 Altstadtbewohnern nur noch 917. Die größtenteils verarmten Bewohner der Altstadt hatte im Krieg größtenteils ihre Existenz verloren. Dagegen konnten die meisten Architekten und Stadtplaner, die im Dritten Reich Karriere machten, nach dem Krieg an ihre frühere Tätigkeit und ihren beruflichen Erfolg anknüpfen. Die vielbeschworene „Stunde Null“ gab es für viele zeitgenössische Architekten nicht. „Nicht nur viele bürokratische, rechtliche und wirtschaftliche Institutionen bestanden nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs fort: sondern es blieben auch viele Personen in leitenden Positionen – auch in der Architektur. Diese Architekten und Planer, die in allen Systemen fast bruchlos tätig waren, waren besonders der modernen Formensprache verschrieben.“. (41)
Schauen wir uns die verantwortlichen Planungs- und Baudezernenten des modernen Wiederaufbaus in Frankfurt einmal näher an. Da wäre z. B. Eugen Blanck (Planungs- und Baudezernent 1946-48). Im modernistisch geprägten „Neuen Frankfurt“ gehörte er dem Planungsstab von Ernst May an. Im Dritten Reich war Blanck u.a. Mitglied im Wiederaufbaustab des Reichsministers Albert Speer. Seine Karriere in der Nazizeit war offenbar kein Hindernis, dass er unmittelbar nach Kriegsende als Planungs- und Baudezernent in Frankfurt am Main tätig war. Auf Vorschlag von Blanck gelangte dann Werner Hebebrand in das Amt des Leiters des Stadtplanungsamtes. Auch Hebebrand saß in der Zeit des Nationalsozialismus u.a. im Wiederaufbaustab von Speer. Nachfolger von Hebebrand wurde Herbert Boehm. Er war als Leiter des Stadtplanungsamtes bis zu seinem Tod 1954 tätig. Auch er legte im Dritten Reich eine beachtliche Karriere hin. Boehm war auch einer der Protagonisten des Neuen Bauens unter Ernst May im Frankfurter Stadtbauamt in den 20iger Jahren. An dieser Stelle sieht man schon die Durchlässigkeit der Karrieren in verschieden Systemen, mutmaßliche Seilschaften und Beziehungsnetzwerke und die bruchlose Verfolgung der modernistischen Ideen der Frankfurter Stadtplaner von der Vorkriegszeit, über die Kriegszeit bis hin zur Wiederaufbauzeit. Bemerkenswert ist auch die Rolle von Adolf Miersch, Frankfurter Planungs- und Baudezernent von 1954 bis 1955. Miersch (Spitzname „Napoleon der Fluchtlinien“) stand nicht nur für unsägliche Straßendurchbrüche wie die Berliner Straße und für rücksichtslose Nachkriegsabrisse, sondern auch für eine beispiellose Amtstreue während der Naziherrschaft.1 Er war für die Frankfurter Arisierungsliste zuständig, die kürzlich wiederentdeckt als „Miersch“-Liste in die jüngste Stadtgeschichte einging. (42) Miersch war übrigens auch einer der Stellvertreter von Ernst May in den zwanziger Jahren im Siedlungsamt von Frankfurt am Main und begeisterter Anhänger des „Neuen Bauens“. Miersch hatte zudem in der NS-Zeit die Umbauplanungen für Frankfurt als „Stadt des Deutschen Handwerks“ mitbestimmt.
Es wird schnell klar: Die Werke der Nachkriegsarchitekten taugen nicht als moralisch vorbildliche Beispiele für unbelastete Aufbauleistungen. Alle aufgeführten Stadtplaner und Baudezernenten waren in wichtigen Positionen im Dritten Reich tätig und bestimmten mit ihren Planungen und Bauten die Zeit des modernen Frankfurter Wiederaufbaus. Als „Vertreter der Moderne“ stehen diese Personen scheinbar außerhalb jeglicher Kritik und werden von der Stadt und hohen Institutionen bis heute verehrt: Adolf Miersch ist u.a. Ehrenbürger der Frankfurter Universität und hat eine Ehrengrabstätte auf dem Frankfurter Südfriedhof. Außerdem ist eine Siedlung und eine Straße in Niederrad nach ihm benannt. (43) Nach Eugen Blanck wurde noch 2013 eine Straße im Neubaugebiet in Frankfurt-Kalbach-Riedberg gewidmet. In Frankfurt-Niederrad wurde eine Straße nach Herbert Boehm benannt. Man möchte bestimmt keine Hexenjagd auf die längst verstorbenen Frankfurter Stadtplaner veranstalten – trotzdem ist es etwas irritierend, wenn bis heute Straßen nach diesen zweifelhaften Karrieristen benannt werden. Ausgerechnet die Modernisten aus einer Kollektivschuld auszusparen ist geradezu grotesk. Es ist zudem befremdlich, dass beim Thema Altstadt immer wieder eine Verbindung zum Dritten Reich gesucht wird und dagegen das Vorleben der modernen Nachkriegsplaner offensichtlich keine kritische Untersuchung wert ist. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Anhänger der Altstadt mit allen Mitteln diskreditiert werden sollen, während die modernistischen Wiederaufbauarchitekten und Planer mit ihrem Lebenslauf und Wirken außerhalb jeglicher Kritik stehen.
4.3. Altstadt vs. Moderne
Die zeitgenössische Architektur verneint den Wunsch nach Rekonstruktionen. Auch bei der Vorstellung des DomRömer-Projekts gab es einen Aufschrei bei Architekten und Stadtplanern. Doch Städte waren schon immer vielschichtig und haben Altes und Modernes harmonisch miteinander vereint.
4.3.1 Ist die Moderne in der Altstadt zu kurz gekommen?
In der Hoffnung, dass das DomRömer-Projekt noch irgendwie abwendbar sei, wurde während der planerischen Debatte von einigen Altstadtkritikern mit teils scheinheiligen und vorgeschobenen Argumenten versucht, die Diskussion in eine andere Richtung zu drehen: mal wurde gesagt, ein originaler Wiederaufbau sei angeblich unbezahlbar, mal handwerklich nicht möglich, mal kunsthistorisch nicht zu verantworten und ein anderes Mal gäbe es angeblich keine geeigneten Nutzer. Mit einer befremdlichen Futterneidmentalität wurde zudem von einigen Architekten behauptet, die Moderne würde bei dem Projekt zu kurz kommen. Dabei können sich die Anhänger einer modernen Architektursprache beileibe nicht benachteiligt fühlen, denn die Fülle von modernistischen Nachkriegsbauten ist gerade in Frankfurt besonders hoch. Wenn man die harten Fakten nimmt, dann sieht man wie unsinnig diese Behauptung ist, die Moderne sei beim DomRömer-Projekt zu kurz gekommen: Lediglich 15 Bauten sind dort Rekonstruktionen. Der Rest sind Neubauten in altstädtischer Kubatur, aber mit Anleihen an der Moderne. Wer als Anhänger einer modernen Architektursprache noch nicht einmal das winzige Areal des DomRömer-Projektes akzeptiert, macht sich unglaubwürdig. Dieser wieder errichtete Teil der Altstadt ist nicht einmal größer als ein Fußballfeld und stellt damit nur einen kleinen Bruchteil der ursprünglichen Altstadt dar. Es gibt also keinen Grund sich über zu viele Altstadthäuser zu beklagen und eine ziemlich peinliche Neiddebatte zu führen. Die Altstadt ist keinesfalls eine Niederlage für die zeitgenössische Architektur oder den Städtebau der Gegenwart. Unter den Architekten beim DomRömer-Projekt sind auch einige Verfechter der Moderne, die zeigen, dass man kreativ und rücksichtsvoll im altstädtischen Kontext bauen kann.
Immer wieder wurde auch behauptet, die in der Altstadt wieder errichteten Fachwerkbauten würden für eine längst vergangene, rückwärtsgewandte Architektur stehen. Im Gegenzug verkaufen moderne Architekten mit einem Absolutheitsanspruch ihre Architektur als fortschrittlich und klauen dabei permanent bei der auch schon einhundert Jahre alten, klassischen Moderne. Durch das ständige Wiederholen abstrakt-moderner Formen wird Historisierung betrieben, also genau das was die Mehrheit der modernistisch eingestellten Architekten den Rekonstruktionsbefürwortern immer vorwerfen. (44) Einseitig argumentierende Modernisten entpuppen sich als die wahren, rückwärtsgewandten Bewahrer ihres Architekturstils. Wenn eine Vielzahl zeitgenössischer Architekten und Stadtplaner nur für Bauten der Nachkriegsmoderne eintreten und gleichzeitig für den Abriss historischer Gebäude nur ein Achselzucken übrighaben, dann scheint zudem etwas bei der Wertschätzung vergangener Architektur in Schieflage geraten zu sein. Die hohe Konformität der Gegenwartsarchitektur kann aus gestalterischer Sicht nicht überzeugen. Es steht außer Frage, dass innerhalb der Stadtentwicklung auch Platz für traditionelle Bauformen sein sollte. Städte bestanden zu jeder Zeit aus baulichen Schichten verschiedener Architekturstile. Dieser geschichtsträchtige Reichtum an vielfältigen Formen sollte insbesondere auch im modernen Zeitalter erhalten bleiben, bzw. auch durch behutsame Rekonstruktionen wieder sichtbar gemacht werden. Historische und moderne Architektur kann harmonisch nebeneinander bestehen – so wie es auch in der Frankfurter Altstadt zu sehen ist.
Neue Impulse für die Stadtentwicklung
Hat das DomRömer-Projekt die moderne Stadtentwicklung ausgebremst? Und berauscht sich Frankfurt städtebaulich gar zu sehr an der Vergangenheit? Die Wahrheit ist wie so oft eine andere. Unter dem Strich gesehen, ist das DomRömer-Projekt ein starker Impulsgeber für die Stadtentwicklung und kein Hemmschuh. Es wurde in den letzten Jahrzehnten noch nie so viel über die Stadt und die Stadtentwicklung gesprochen wie seit der Eröffnung des DomRömer-Projektes. Die Stadt wird nicht mehr nur als Spielwiese für Hochhausinvestoren aus der Finanzbranche gesehen, sondern der Mensch rückt wieder in den Mittelpunkt der Stadtplanung. Wo können sich Menschen begegnen, wie wohnen diese und wie schafft man den Spagat zwischen Mobilität und Ruhe in der Stadt? Die Altstadt ist eine Blaupause für eine nachhaltige Stadtentwicklung mit Orten der Begegnung und einer hohen Aufenthaltsqualität. Die Wiederentdeckung der alten, europäischen Stadt kann zu einer Renaissance menschengerechter Wohnviertel beitragen. Frankfurt hat mit dem DomRömer-Projekt im Übrigen keinen architektonischen Sonderweg beschritten, sondern steht in einer Reihe weiterer, erfolgreicher Rekonstruktionsprojekte und New Urbanism-Initiativen in der ganzen Welt.
Der Weg von der modern überformten Stadt zur lebendigen Altstadt war weit. Die europäische Stadt mit ihren historisch gewachsenen Stadtkernen wurde lange Zeit, besonders in den wachstumsstarken Nachkriegsjahren, vernachlässigt. Doch das Modell der Altstadt erfährt, gerade unter dem Zeichen des Klimawandels, eine Renaissance. Qualitätsvoll gebaute Gebäude versprechen Nachhaltigkeit. Enge Altstadtgassen spenden Schatten und kühlen, die im Zuge der Erderwärmung aufgeheizte Stadt, auf ein für den Menschen verträgliches Maß ab. So wie in Südeuropa zu sehen, trotzen die Menschen in den verwinkelten Altstädten mit ihren begrünten Innenhöfen der Hitze. Gleichzeitig stehen die Altstädte für eine bis heute unerreichte Lebendigkeit im Stadtgefüge. Eine Stadt der kurzen Wege hält im ökologischen Sinne ein zukunftsträchtiges Konzept bereit. In allen Altstädten der Welt haben Fußgänger und Radfahrer das Zepter in der Hand. Die Entfernungen sind in den kompakten Altstädten fußläufig und man bewegt sich zudem in einem übersichtlichen und geschützten Raum. Nach dem Erfolg des Altstadtprojektes wurde die qualitative Messlatte für kommende Bauprojekte in Frankfurt am Main sehr hoch gehängt. Die Stadtentwicklung ist in Bewegung gekommen. Eine Bewegung die der Stadt gut tut und gestalterische Alternativen fernab der oftmals banalen Investorenarchitektur der letzten Jahre aufzeigt.
4.3.2 Wurde für die neue Altstadt hochwertige, moderne Architektur abgerissen?
Die Stadtchronik des Instituts für Stadtgeschichte vermeldet für den 4. Mai 1970: „Die restlichen Mieter der zum Abbruch vorgesehenen fünf Häuser in der Braubachstraße verbringen die letzte Nacht in ihren Wohnungen. Sie müssen dem Technischen Rathaus weichen.“ Hinter der nüchternen Meldung aus der Stadtchronik stehen Geschichten von Menschen, die entmietet wurden und deren Wohnraum zerstört wurde. Abgerissen wurden die fünf völlig intakten historischen Bauten in der Braubachstraße für den massiven Bau des Technischen Rathauses. Die große Freifläche zwischen Dom und Römer reichte den damaligen Stadtplanern offensichtlich nicht aus. Die Technischen Ämter mit ihren gewaltigen Raumbedarf sollten eine gigantische Trutzburg aus Beton erhalten. Trotz heftiger Proteste der Bürger peitschte die Stadt das Projekt durch. Der Bauplatz war nicht alternativlos: Es gab Vorschläge, das Technische Rathaus an einer anderen Stelle zu bauen.
Der Abbruch der fünf Gebäude an der Braubachstraße (die heutigen Hausnummern 21 bis 31) besiegelte das Ende von Altstadtbauten, die im Krieg stehen geblieben waren bzw. wieder repariert wurden. Darunter war das Haus Nr. 21 – ein dreigeschossiges Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert, dessen Obergeschosse im Krieg zerstört worden waren. Auf dem historischen Erdgeschoss wurde ein Nachkriegsbetonbau aufgesetzt. Die drei Häuser Nr. 27, 29 und 31 waren 1911 bis 1913 nach dem Durchbruch der Braubachstraße errichtet worden. Das Haus Nr. 23 stammte von 1940. Hinzuzählen zu diesen fünf Bauten müsste man zudem noch das Hintergebäude des Hauses Esslinger, das auch beseitigt wurde. Das Technische Rathaus wurde von dem jungen Frankfurter Architekturbüro Bartsch-Thürwächter-Weber geplant. Als Sieger eines unter Federführung des Frankfurter Baudezernenten Kampffmeyer ausgeschriebenen Wettbewerbs sah die Planung u.a. solitäre Türme vor. Thürwächter ließ sich dabei auch vom 1962 bis 1964 in London errichteten Economist Cluster inspirieren. (45) Eine Bezugnahme zur jahrhundertalten Frankfurter Altstadt war offensichtlich nicht vorgesehen. Doch im Laufe der weiteren Planungen musste Thürwächter, auf Wunsch der Stadt, den Entwurf verändern und Kompromisse eingehen. Die Türme wurden am Ende abgeflacht und ein Sockelbau kam hinzu. Zwischen Radikalität und Rücksichtnahme zur Altstadt entstand am Ende ein Hochbaukörper von mittelmäßiger Qualität. Ein Bau, der sich weder in die Konsequenz des Betonbrutalismus, noch in eine vermittelnde Moderne einreihte. Das Technische Rathaus war keine schützenwerte Ikone der Betonmoderne, sondern ein mittelmäßiger, überdimensionierter Kompromissbau, der von Anfang an am falschen Ort stand. Ein Fremdkörper im historischen Herz der Altstadt. Ein trister Verwaltungsbau, der aus der Altstadt einen kalten, gesichtslosen, unlebendigen Ort machte.
Das 1974 eröffnete Technische Rathaus wurde im Zuge der Planungen für das DomRömer-Projekt 2010 abgerissen. Natürlich ist es immer traurig, wenn ein Architekt den Abriss eines seiner erschaffenen Gebäude miterleben muss. Anselm Thürwächter, Schöpfer des Technischen Rathauses, schilderte 2007 in einem F.A.Z.-Interview seine Beklommenheit hinsichtlich des bevorstehenden Abrisses. Er erklärte jedoch auch, dass die Architekten der Nachkriegszeit, gezeichnet vom Krieg, eine Aversion gegen altes Bauen hatten. Beton sei der Baustoff der Zeit gewesen. Einen Abriss des Technischen Rathauses kann er nicht nachvollziehen. Auf die Anmerkung des Interviewers, dass für den seinerzeitigen Neubau des Technischen Rathauses fünf Altstadthäuser abgerissen wurden, eines sogar mit eingemauerter Rokoko-Fassade, antwortete Thürwächter: „Ich war jung und habe nicht darüber nachgedacht. Einer der Architekten, Hermann Senf, lebte damals sogar noch, aber das war für mich eigentlich kein Problem, das Haus eines Kollegen abzureißen. Ich empfand die Bauwerke als völlig belanglos…“. (46) Diese Aussage ist verstörend und macht nachdenklich. Der zweifelhafte Umgang mit dem historischen Bauerbe ist wohl dem damaligen Zeitgeist geschuldet. Wenn der Architekt Thürwächter allerdings, ohne einen Gedanken zu verschwenden, für seinen Bau Abrisse in Kauf genommen hat und später dann für die Beseitigung seines asbestverseuchten Technischen Rathauses keinerlei Verständnis aufbringt, dann ist dieses schon etwas befremdlich. Auch an anderer Stelle wurden moderne Bauteile der Moderne mit Vehemenz verteidigt. So weigerte sich der Architekt Bangert den so genannten Tisch, ein betonierter Galerievorbau seiner entworfenen Schirn, für das Altstadtprojekt zurückbauen zu lassen. Der Architekturkritiker Bartetzko schrieb dazu: „Überall verfechten gestern noch abrissfreudige Architekten plötzlich das Urheberrecht und die Unantastbarkeit von (meist modernen) Werken der Baukunst.“ (47)
Das technische Rathaus steht exemplarisch für eine Zeit, in der Stadtplaner, Architekten und die damaligen Baulöwen nach Belieben ihre Vorstellungen umsetzen konnten. Beim Bau des Technischen Rathauses gab es zahlreiche Bürgerproteste, die nicht erhört wurden. (48) Der Bau war von Anfang an eine Fehlplanung: Er konnte weder alle technischen Ämter aufnehmen, noch das Kostenlimit einhalten. Später war das Technische Rathaus, auf Grund seiner Klotzigkeit, schnell als Bausünde und „Elefantenfuß“ verschrien. Es war nie in der Bevölkerung beliebt und schon gar keine Sehenswürdigkeit. Der technische Zweckbau im Herzen der Stadt war zum Zeitpunkt seines Abrisses deutlich in die Jahre gekommen. Die dunkle Eingangssituation, die Betonoptik und die Wuchtigkeit des Baukörpers waren nicht mehr zeitgemäß. Immer wieder gab es millionenteure Sanierungen für Brandschutz und für die Asbestentsorgung. Es war ein Fass ohne Boden. (49) Am Ende mussten Spezialbagger anrücken, um das Asbest und PCB verseuchte Gebäude abzureißen und den Bauschutt umweltgerecht zu entsorgen. (50) 20 Millionen Euro kostete wohl der unumgängliche Abriss des für 56 Millionen DM errichten Baus. Diese Summe, die nichts mit den rekonstruierten Bauten zu tun hat, wird von Altstadtkritikern gerne zur Bausumme der Altstadt hinzusummiert, so dass das DomRömer-Projekt utopisch teuer erscheint. Abgerissen worden wäre das Technische Rathaus auch ohne dem Altstadtwiederaufbau. Ein Rückmietverkaufsverfahren lief aus und man machte sich bereits 2004 bei der Stadt Gedanken, wie man mit dem Betonungetüm weiter verfahren sollte. Das Areal des Technische Rathaus war schon vor dem Beschluss des Altstadtprojektes für eine neue Bebauung vorgesehen. Geplant war auf dem frei gewordenen Gelände ein unmaßstäbliches Neubauprojekt mit einem Luxushotel. Kritik an dem Abriss des Technischen Rathauses war zu diesem Zeitpunkt von der Architektenschaft kaum zu vernehmen. Erst als ein Teil der Altstadt auf dem Gelände entstehen sollte, regte sich der Widerstand der Architekten, Planer und einschlägiger Fachmedien. Plötzlich wurde das monströse Technische Rathaus als erhaltenswerte Perle der Nachkriegsmoderne dargestellt. So gesehen war es ein wohl ideologisch getriebener Protest für die Moderne und gegen die Altstadt.
Noch einmal Zusammengefasst: Für den Bau des Technischen Rathauses wurden rücksichtslos mehrere historische Bauten abgerissen und dabei intakter Wohnraum geopfert. Das Technische Rathaus wurde gegen den Bürgerwillen gebaut. Der Bau hatte weder die für diesen Ort typische Kleinteiligkeit, noch eine gestalterische Schönheit oder altstadtgerechte Nutzung. Der Bau strahlte keine Lebendigkeit aus und war für diesen geschichtsreichen Ort einfach unpassend. Er konnte zu keiner Zeit die Herzen der Menschen erobern. Die Mehrheit der Frankfurter Bürger stand hinter dem Abriss des asbestverseuchten Gebäudes. Das stark sanierungsbedürftige Technische Rathaus wäre zudem auch ohne das DomRömer-Projekt abgerissen worden – ein moderner Nachfolgeentwurf lag schon vor. Proteste gegen den Abriss gab es von Modernisten erst, als ein Teil der Altstadt auf dem Areal gebaut werden sollte. Das Technische Rathaus war keine Ikone der Nachkriegsmoderne, sondern ein mittelmäßiger, überdimensionierter Kompromissbau am falschen Ort.
4.3.3 Will in der engen, dunklen Altstadt überhaupt jemand leben?
Während auf der einen Seite die Altstadthäuser als Knusperhäuschen mit Butzenscheiben bespöttelt werden, flanieren viele dieser Kritiker mit einer großen Begeisterung durch die Altstädte von Brügge, Florenz und Avignon und schwärmen von deren authentischen Charme. Die Kritiker trauen den Bürgern in den europäischen Städten zu, mit einer Zufriedenheit in kleinen Altstadtbauten zu wohnen, während man gleichzeitig von einer städtebaulichen Zumutung redet, wenn in Deutschland neuer Wohnraum in der Neuen Altstadt entsteht. Ist die Neue Frankfurter Altstadt mit ihren überschaubaren Häusern also ein Relikt aus dem Mittelalter, indem heute keiner mehr Wohnen möchte und in der Leerstand herrscht? Die Wahrheit ist: Das Gegenteil ist der Fall. Mittlerweile werden die Wohnungen in der Altstadt zu hohen Phantasiepreisen vermietet. (51) Das DomRömer-Projekt umfasst gerade mal 0,7 Hektar und ist damit kleiner als ein bekannter Elektrofachmarkt auf der Zeil. Doch auf dem winzigen Altstadt-Areal boomt es: 65 verkaufte Wohnungen in den 35 Häusern und das veräußerte Gebäude „Hinter dem Lämmchen 2-4“ (Struwwelpeter-Museum) haben der Stadt 90 Millionen Euro gebracht. 900 Bieter gab es für die 65 Wohnungen. Aus einem Kreis von 190 Aspiranten wurden letztendlich die Eigentümer ausgelost. Für die 21 Läden in der neuen Altstadt hat es rund 200 Bewerber gegeben. (52) Neben dem kleinteiligen Einzelhandel mit liebevoll eingerichteten Läden, einem Barbiersalon und ausgesuchten Gastronomieangeboten beherbergt das DomRömer-Areal auch den Archäologischen Garten und das Stoltze- und Struwwelpeter-Museum. Zudem ist eine Dependance des Historisches Museum in der Goldenen Waage eingezogen und zeigt dort, wie bereits vor dem Krieg, die geschmackvoll eingerichteten historischen Stilräume. Auch das berühmte Belvederchen – ein hübscher Dachpavillion – kann in Rahmen von Führungen besucht werden. Darüber hinaus finden sich in der neuen Altstadt die Bürgerberatung Frankfurt sowie soziale Einrichtungen. Im Stadthaus am Markt befindet sich Lectron – eine Tochter des gemeinnützigen Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten und das St.-Katharinen- und Weißfrauenstift. Es ist ein neues, vielfältiges Leben für alle Generationen zwischen Dom und Römer eingezogen.
Die Altstadt ist auch in der heutigen Zeit eine Erfolgsgeschichte, weil die Altstadthäuser kleine Grundrisse für Wohnungen bieten und genau diese kompakten Wohnungen auf dem Immobilienmarkt gefragt sind wie nie. Auch die Ladenlokale bieten regionalen Händlern neue Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei konnten viele Gewerbetreibende an die Geschichte anknüpfen. In der Goldenen Waage, die 1605 der Zuckerbäcker und Gewürzhändler Abraham van Hamel bezog, gibt es auch heute wieder – mit dem eingezogenen Kaffeehaus – ausgesuchte Süßigkeiten zu entdecken. Die Schirn im Roten Haus, in der es im bereits im Mittelalter einen Verkaufsstand für Fleisch und Wurst gab, beherbergt auch heute wieder eine Altstadtmetzgerei. Die Altstadt bietet Kontinuität und Tradition wie kaum ein anderer Ort in der Stadt. Neben der gemischten Nutzung zieht auch die fußläufige Erreichbarkeit von Einkaufsläden und Gastronomiebetrieben sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen, viele Menschen in die Altstadt.
Die Altstadthäuser brauchen sich im Übrigen nicht vor energieeffizienten Neubauten zu verstecken: Die Klimaschutzziele der Stadt Frankfurt wurden von Anfang an bei dem DomRömer-Projekt berücksichtigt. Die neuen Gebäude der Altstadt wurden energetisch optimiert und nach Passivhauskriterien errichtet, soweit keine Aspekte bei der Rekonstruktion dagegensprachen. Eine Studie des Architekten Settembrini besagt, dass Altbauten typologisch sogar besser für den Klimawandel geeignet sind, als neue Bauten. Durch den geringeren Fensteranteil im Verhältnis zum Fassadenanteil sind diese den Neubauten überlegen. (53) Die Altstadt, als Stadtmodell des 21. Jahrhunderts, steht für nachhaltigen Klima- und Ressourcenschutz.1 Es wurde in diesem Sinne ein funktionsgemischtes, lebendiges, energiesparendes Quartier der kurzen Wege geschaffen, in der viele Menschen gerne leben möchten. Selbst die einstigen Kritiker zeigen sich heute zumeist wohlgestimmt und zollen der neuen Altstadt den nötigen Respekt ab.
4.3.4 Ist nicht eigentlich die Skyline, statt die Altstadt, identitätsstiftend für Frankfurt?
Keine Stadt ist wie die andere. Das hat auch seinen guten Grund, denn jede historisch gewachsene Stadt besitzt einen "ortstypischen Charakter", eine eigene „DNA“, die diese einzigartig macht. Diese DNA ergibt sich u.a. aus der Lage der Stadt. Vor über 100 Jahren noch wurden, um den Transport von Baumaterialien besser zu bewältigen, vor allem Baustoffe verwendet, die in der Umgebung der Stadt verfügbar waren. Deswegen hat z. B. Frankfurt am Main seinen ortstypischen – in der Umgebung abgebauten – roten Sandstein für viele seiner Bauten verwendet. In München wurde traditionell mit dem regional verfügbaren Kalktuff und in Hamburg mit Backsteinen gebaut. Je nachdem welche Baumaterialien verwendet wurden, konnten sich natürlich auch die Handwerker und Architekten darauf spezialisieren und schufen so unverwechselbare Stadtensembles von hoher Qualität. Auch die Bauformen sind Ausdruck der örtlichen Gegebenheiten. Dass wir z. B. in der Regel keine Flachdächer haben macht in unseren Breitengraden Sinn, denn natürlich sind geneigte Dächer besser für die Regen- und Schneeentlastung der Häuser als Flachdächer. Insgesamt steht die regional gewachsene Architektur für eine beachtenswerte Kulturleistung, die gerade die historischen Stadtzentren heute noch schützenswert machen. Ensembleschützende Gestaltungssatzungen gab es übrigens schon vor über hundert Jahren und trugen so zu harmonischen Stadtquartieren bei. So konnten in sich geschlossene Städte geschaffen werden, die bis in die heutige Zeit eine hohe Anziehungskraft für die Bürger und Besucher besitzen.
Ohne Zweifel ist neben dem roten Sandstein, die facettenreiche, innerhalb der Stadtmauern entstandene, dichtbebaute Altstadt ein ortstypischer Charakter von Frankfurt am Main. Hier gab es, vor den Zerstörungen des zweiten Weltkrieges, die größte zusammenhängende (Fachwerk-)Altstadt in Deutschland. Diese ist bekanntlich im Krieg verloren gegangen und man könnte nun sagen, das Frankfurt statt der Altstadt nun die Skyline als ortstypischen Charakter erhalten hat. Doch das eine kann natürlich nicht durch das andere einfach so ersetzt werden. Und ob Wolkenkratzer etwas ortstypisches für Frankfurt sind, kann man durchaus diskutieren. Die Skyline mit der Altstadt zu vergleichen, ist wohl eher ein Versuch, die moderne mit der alten Architektur auszuspielen. Dabei ist es völlig egal, ob die Skyline oder die Altstadt das Wahrzeichen ist. Metropolen können mehrere Wahrzeichen haben. Wer allerdings darauf beharrt, dass nur die Skyline der städtebauliche Ausdruck von Frankfurt sei, der überschätzt die Sogwirkung von austauschbaren Hochhäusern auf Touristen. Für Besucher aus Japan, China und den Emiraten, die genug eigene Wolkenkratzer besitzen, ist die Frankfurter Skyline vergleichsweise eher putzig, nichts besonderes und kaum ein Foto wert. So gut wie kein Tourist kommt wegen der Hochhäuser in die Mainstadt. Die Menschen, die in Frankfurt am Main zu Besuch sind, strömen vor allem in die Altstadt. (54) Hier ist mit dem DomRömer-Projekt wieder das lebendige, historische Herz der Stadt entstanden. Hier finden sich einzigartige, nicht austauschbare Orte: Der geschichtsträchtige Krönungsweg, die Goldene Waage, der Römer – das gibt es nur in Frankfurt am Main. Das monströse Technische Rathaus gehörte niemals in diese Reihe, denn es hätte auch an jeden anderen Ort außerhalb der Altstadt stehen können.
Auch wenn kaum noch Menschen leben, die die historische Altstadt mit eigenen Augen gesehen haben, so gab es doch bis in die heutige Zeit eine Sehnsucht in der Stadt nach einem historischen Stadtkern. Diese Identifikation zu unverwechselbaren Bezugspunkten in der Stadt ist über Jahrhunderte gewachsen. Die Menschen brauchen Konstanten im Stadtbild und Identifikationsorte an denen sie sich orientieren können. Es gibt Orte in der Stadt wie die Altstadt und das Goethehaus, die trotz ihrer Auslöschung im Zweiten Weltkrieg, nie in Vergessenheit gerieten. Man könnte genauso gut den Main trockenlegen und trotzdem würden sich die Menschen auch noch in hundert Jahren nach diesem ortstypischen, charakteristischen Flusslauf in Frankfurt sehnen. Die gewachsene Identität, die DNA einer Stadt, kann man nicht auslöschen. Zu dieser DNA der Stadt gehört natürlich mittlerweile auch die Skyline. Und natürlich gibt es auch dort Highlights der Baukultur wie den charakteristischen Messeturm.
4.4 Altstadt: Resümee und Ausblick
Beim DomRömer-Projekt wurden, wie bei große Bauprojekten üblich, natürlich auch eine Reihe von Fehlern gemacht. Doch mit den richtigen, baulichen Ergänzungen, kann die Neue Altstadt ihr großes Potenzial noch weiter ausschöpfen.
4.4.1 Ist wirklich alles gut?
Mit einigen Mythen zur neuen Frankfurter Altstadt konnte in den letzten Kapiteln aufgeräumt werden. Insbesondere die kritischen Töne eines großen Teils der modernistisch eingestellten Architekten, wurden mit Fakten überwiegend widerlegt. Doch natürlich gibt es auch einige Punkte bei der Altstadtbebauung, die man hätte besser machen können. Aus Fehlern lernt man bekanntlich und so sollten die folgenden Punkte bei zukünftigen Altstadt- und Rekonstruktionsprojekten berücksichtigt werden.
Stichwort Wohnungsvergabe: Da die Nachfrage auf die Wohnungen riesig war, hätte man einen großen Teil der Ausgaben für die Altstadt durch ein anderes Wohnungsvergabeverfahren wieder ausgeglichen. Auf jede Wohnung haben sich bis zu zehn Käufer beworben. Die Stadt hätte auch eine Versteigerung an den Meistbietenden durchführen können, statt über das Losverfahren zu verkaufen und so deutlich weniger einzunehmen. (55) Darüber hinaus haben einige Käufer die Wohnungen wohl nur aus Investmentgründen erworben. Als Zweit- oder Drittwohnung genutzt, sind diese Wohnungen für lange Zeit unbewohnt, was sich dann negativ auf die Belebung des Viertels auswirkt. Sehr schade ist die bisherige Entwicklung des neuen Stadthauses am Markt. Der Mitte 2016 als erstes Haus in der neuen Altstadt eröffnete Bau, müsste vielmehr als günstig mietbare Veranstaltungslocation und als Treffpunkt und verbindendes Scharnier für Bewohner und Besucher in der Altstadt fungieren. Hier könnten auch vermehrt Musik- und Kunstevents und Veranstaltungen zur Geschichte der Altstadt stattfinden. Auch das vielfältige Vereinsleben könnte an diesem zentralen Ort einen belebenden Ankerpunkt in der Altstadt erhalten. In den großzügigen Räumen und Gängen des Stadthauses wäre auch eine ständige Ausstellung zur Geschichte der Altstadt denkbar. Da es kein Besucherzentrum in der Altstadt gibt, könnte hier über die bewegenden Zeiten in der Altstadt und über die einzigartige Baugeschichte informiert werden. So hätten auch Schulgruppen und andere Besuchergruppen einen lehrreichen Anlaufpunkt.
4.4.2 Die Altstadt ergänzen
Zur weiteren Belebung der Altstadt ist es anzustreben, noch mehr handwerkliche und kulturelle Mieter wie Kunsthandwerksläden, Manufakturen, Galerien, Concept Stores und Ateliers in das Quartier anzusiedeln. Die Nähe zur Schirn sollte besser genutzt werden: So wäre ein regelmäßiger Kunstmarkt im Stadthaus und ein Pop-Up-Store für Kunst denkbar. Darüber hinaus sollte die Altstadt besser innerhalb des Weihnachtsmarktes integriert werden. Eine Altstadt ohne eine ansprechende Weihnachtsbeleuchtung ist mit Sicherheit weder im Sinne der Touristen, noch der Stadt und schon gar nicht der Gastronomen und Einzelhändler in der Altstadt. Nicht optimal gelöst sind bisher einige Bereiche beim Thema Infrastruktur. 2019 waren zwischen 2,5 und 3,2 Millionen Touristen in der Altstadt unterwegs. Es steht außer Frage, dass für eine so große Anzahl von Besuchern auch die nötige Infrastruktur (Toiletten, Bänke, Fahrradständer etc.) vorgehalten werden muss. (56) Auch Infotafeln zur Geschichte des Areals wären für Besucher hilfreich. Trotz aller Kinderkrankheiten präsentiert sich die Altstadt als gut geplantes Quartier, das sich einer hohen Beliebtheit bei allen Schichten und Altersstufen erfreut.
Das DomRömer-Projekt sollte – wo nötig – auch baulich ergänzt werden. Der U-Bahn-Zugang Schirn irritiert beim Blick zum Krönungsweg – hier sollte eine andere Lösung gefunden werden. Auch die Pergola – die fast wie die Einhausung eines Ziergartens aussieht, sollte stattdessen in Zukunft durch weitere Altstadtbauten ersetzt werden. Überhaupt bleibt die Frage, inwieweit die Altstadt noch mit weiteren schöpferischen Nachbauten ergänzt werden sollte. Einige politische Vertreter in der Stadt haben die Parole ausgegeben, dass jetzt nach dem fertig gestellten DomRömer-Projekt, der Altstadtwiederaufbau insgesamt gesehen abgeschlossen sei und es keine weiteren Rekonstruktionen geben wird. Die Gründe bzw. Argumente für diese Aussage sind vielfältig: So wolle man angeblich die Einzigartigkeit des DomRömer-Projektes erhalten, weitere Rekonstruktionen seien zu teuer, oder es wird auch gesagt, dass jetzt die moderne Architektur wieder den Vorzug haben solle. Fragt man die Bürger in Frankfurt am Main dazu, so kommen ganz andere Ergebnisse dabei heraus. Die Menschen haben die Altstadt in ihr Herz geschlossen und der Ruf nach weiteren Rekonstruktionen ist groß. Im Online-Bürgerdialog zum 2019 verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept, wurden nach den Wünschen der Bürger gefragt. Das Ergebnis: Die sechs am Besten bewerteten Vorschläge hatten den Wunsch nach weiteren Rekonstruktionen zum Inhalt. (57) Dieses eindeutige Votum hat bisher leider keinen Eingang in die Stadtentwicklungspläne der Stadt gefunden. Das ist mehr als bedauerlich, denn herausragende Altstadtbauten wie das Salzhaus oder das berühmte Roseneck sollten auf jeden Fall zukünftig rekonstruiert werden, um das geschichtsreiche Areal zwischen dem Römer und dem Kaiserdom sinnvoll zu ergänzen. Auch der Lange Franz, als Rathausturm und weit sichtbarer Orientierungspunkt in der Stadt, sollte schnellstens wieder seine anmutige Dachkrönung erhalten. Der rührige Brückenbauverein sammelt für dieses Rekonstruktionsprojekt bereits Spendengelder.
5. DIE MODERNE STADT IM FOKUS
Die ausführliche Beschreibung des DomRömer-Projektes macht deutlich, dass historisierende Architektur einen erfolgreichen Baustein in der zeitgenössischen Stadtentwicklung darstellt. Im folgenden Kapitel wird noch einmal näher auf die Nachkriegsmoderne und auf die zeitgenössische Architektur eingegangen. Das vielschichtige Versagen der modernen Architektur hat bei den Bürgern den Wunsch nach Repliken historischer Bauwerke mit ausgelöst.
5.1. Städtebau: Der Abgesang der Nachkriegsmoderne
Während immer mehr Städte wieder an ihr historisches Bauerbe anknüpfen und mit rekonstruierten Bauten ihre Innenstädte füllen, steckt die Nachkriegsarchitektur in einer tiefen Krise. In der ganzen Republik wurden in den letzten Dekaden Bauten der Nachkriegsmoderne wie z. B. Büro- und Verwaltungsbauten, Geschäftshäuser, Parkhäuser und Wohnblocks abgerissen. Alleine in Frankfurt am Main sind in den letzten Jahren eine Reihe von markanten Nachkriegsbauten verschwunden. Waren zunächst nur Gebäude aus den 50iger, 60iger und 70iger Jahren betroffen, sind in letzter Zeit auch vermehrt Bauten aus den 80iger und 90iger Jahren in den Fokus gerückt. Selbst einige Gebäude aus der Postmoderne gibt es nicht mehr. Die Gründe für das Verschwinden vieler Nachkriegsbauten sind vielfältig: Insbesondere die technische und energetische Erneuerung der Gebäude ist zumeist zu aufwändig und zu teuer. Aber auch die Grundrisse passen oftmals nicht in die Zeit und auch optisch sind einige Bauten überholt und finden keine Mieter mehr. Die modernen Betonklötze mit eintönigen Fassaden aus Kunststoff, Glas und Stahl werden von den Menschen zumeist als kalt, unnahbar und hässlich empfunden. Selbst Neubaugebiete überzeugen oft nicht: Raumgreifende, monotone Wohnblöcke bilden unpersönliche, formelle und unwirtliche städtische Lebensräume. Die Proportionen zum Stadtraum stimmen zumeist nicht und das menschengerechte Maß fehlt. Selbst die besten Stararchitekten der Welt, schaffen es zumeist nicht, moderne Stadtensembles mit einer hohen Anziehungskraft zu schaffen. Es ist daher kein Wunder, dass historische Städte eine immer höhere Anziehungskraft genießen.
Würden Architekten und Investoren Marktforschung betreiben, so würde vermutlich kaum noch ein klotzig-moderner Bau errichtet werden, denn die Bürger bevorzugen in der Mehrheit klassische Bauformen. Mit den glatten, ornamentfreien Oberflächen der Moderne können sich viele Menschen nicht identifizieren. Eindrücklich wird diese Einschätzung durch unzählige Untersuchungen belegt. Über alle Altersklassen, Geschlechter und soziale Schichten hinweg bevorzugen die Menschen stilreiche Bauten mit Verzierungen und Ornamenten. (58) Doch der Geschmack einer kleinen Gruppe von modernen Architekten und Stadtplanern bestimmt in welcher Umgebung, die Menschen in den Städten leben sollen. Damit hat die Architektur eine absolute Sonderstellung: Es gibt ansonsten kein Feld im alltäglichen Lebensbereich, der sich so stetig konträr zum Wunsch der Menschen verhält. Doch die Nachkriegsmoderne mit ihren städtebaulichen Fehlentwicklungen bröckelt nun. Der „Abgesang der Moderne“ betrifft nicht nur Gebäude aus dieser Zeit, sondern auch die errichteten Nachkriegsstrukturen aus dem Paradigma der autogerechten, funktional getrennten Stadt. Die Gründe für das Scheitern der Nachkriegsmoderne sind mehr als vielfältig.
Als erstes ist die nachteilige Funktionstrennung und mangelnde Dichte der Nachkriegssiedlungen zu nennen: Das technokratische Ordnungsdenken der Nachkriegszeit, bei der Arbeit, Wohnen, Konsum und Freizeit mit aller Gewalt getrennt wurden, hat sich als nachteilig erwiesen. Den sozial und funktional entmischten Quartieren der Nachkriegsmoderne fehlt die Lebendigkeit mannigfaltiger Nutzung. Reine Wohnsiedlungen ohne Leben in den Erdgeschossen sind genauso trostlos wie reine Einkaufszonen oder die leeren Bürostädte nach dem Feierabend. Mangelt es in den modernen Siedlungen an Läden, Gastronomiestätten und kulturellen Orten, so fehlen die gängigen Begegnungsstätten zum sozialen Austausch. Das fördert die Anonymität und Vereinsamung in den Großsiedlungen. In den in aufgelockerter Zeilenbauweise errichteten Siedlungen mit monotonen Wohnblöcken und isolierten Punkthochhäusern fehlt oftmals eine schützende Blockrandbebauung zu den lärmenden Verkehrsräumen. Die offene Bauweise und die freistehenden Grünanlagen stehen der Intimität und Privatsphäre der Bewohner entgegen. In den weitläufigen, tristen Betonsiedlungen fehlt Dichte und damit die soziale Kontrolle, die belebende Quartiere aufweisen. Teilweise sind in den modernen Trabentenstädten daher Problemviertel mit mangelnder Identifikation und Sicherheit entstanden.
Nicht zu unterschätzen ist auch die hohe Austauschbarkeit und mangelnde Gefälligkeit der zeitgenössischen Architektur. Die Moderne hat zu einer hohen Vereinheitlichung des Bauens geführt. Dem internationalen, global gleichförmigen Baustil fehlt der regionale Bezug um identitätsstiftend zu wirken. Die gesamte traditionelle Architektur, die jahrhundertelang mit regional verfügbaren Materialien und bewährten Formen gearbeitet hat, wurde im Zuge der entlokalisierten Moderne ausgeblendet. Moderne Bauten wurden zudem zumeist ohne Rücksicht auf den städtegeschichtlichen Kontext und ihrer baulichen Umgebung gebaut. Weil nicht auf das historisch gewachsene Stadtgefüge geachtet wurde, sind austauschbare Orte entstanden in denen sich die Menschen nicht heimisch fühlen. Die Moderne steht für gerade Linien und reduzierte Formen. Doch die sachlich-schlichte Architektur mit einer kubus- oder quaderförmigen Kubatur, Flachdächern und sich wiederholenden Rasterfassaden und schießschartartigen Fensterbändern werden zumeist als gesichtslos, abweisend und langweilig empfunden. Viele Bauten sind zudem voluminös, überdimensioniert und unmaßstäblich im Bezug zum Menschen. Durch die hohe Ablehnung moderner Bauformen gibt es keine positive Verankerung dieser Gebäude in der Bevölkerung. Moderne Bauten wirken besonders im Kontrast zu Altbauten. Umgekehrt sieht ein Altbau in moderner Umgebung verloren aus. Mit modernen Bauten können auch kaum schöne Ensembles geschaffen werden. Die individualistischen Neubauten gehen keine Harmonie miteinander ein, denn sie leben von ihren Brüchen und Kontrasten. Nebeneinanderstehende Neubauten haben niemals die Wirkung wie harmonisch aufeinander abgestimmte Ensembles aus Altbauten.
Zu nennen ist auch der überhöhte Absolutheitsanspruch der Moderne. Mit dem Vermächtnis großartiger Architekten wurde in der Nachkriegsmoderne oftmals ohne Kollegialität und Respekt umgegangen. Immer wieder wurde bei der Errichtung modernen Neubauten zudem über den Denkmalschutz des Bestands und über gestalterische Satzungen hinweggesehen. Die Ablehnung althergebrachter Bauformen und der Absolutheitsanspruch der Moderne haben zu einer beispielslosen Vernichtung von historischen Gebäuden geführt. Auch die eingeschränkte Mitbestimmung ist ein großes Thema. Ein kleiner Kreis moderner Stadtplaner und Architekten bestimmte in der Nachkriegszeit, wie die Städte aussehen sollen. Die rigorose Durchsetzung modern-konformer Bauentwürfe geschah oft ohne einen alternativen Diskurs und ohne echte Mitbestimmung anders Denkender. Die Auswahl der Entwürfe in Wettbewerben erfolgt durch Stadtplaner und Architekten, die meistens moderne Bauformen bevorzugen. Die Wettbewerbe sind daher für traditionelle Architekten zumeist undurchlässig. Darüber hinaus wird durch die Meinungshoheit und Beharrlichkeit der Modernisten oftmals das Votum der Bürger für klassische Architekturentwürfe übergangen.
Die Nachkriegsmoderne ist auch aus ökologischer Sicht weitgehend gescheitert. Die funktional-gegliederte Stadt mit ihren locker strukturierten Wohn-Zeilenbauten und großzügigen Verkehrsflächen hat nach dem Krieg zu einem verschwenderischen Ressourcen- und Flächenverbrauch in den Innenstädten geführt. Zudem werden bei modernen Bauten die falschen Materialien verwendet. Zement ist ein Klimakiller, seine Herstellung hat einen eklatanten Anteil an den CO2-Emissionen weltweit. Zement ist zudem so gut wie nicht recycelbar. Auch Beton hat sich nicht als nachhaltiger Baustoff erwiesen. Der hohe Materialeinsatz ist mit einer klimagerechten Stadt nicht vereinbar. Gründerzeitviertel aus Backstein oder Naturstein haben sich dagegen als wesentlich nachhaltiger als Betonbauten erwiesen. Auch bestimmte Bauformen sollte man überdenken: Hochhäuser können je nach Lage, die Frischluftzufuhr in einer Stadt versperren. Auch die reflektierenden Glasfassaden der modernen Büro- und Geschäftsbauten sind aus ökologischer Sicht ungünstig, denn die Stadt heizt sich dadurch zusätzlich auf. Wo im großen Stil gebaut wird, muss das Grundwasser abgesenkt werden. Auch mangelnde Versickerungsflächen durch Versiegelung stehen nicht im Einklang mit den natürlichen Ressourcen.
Nicht zu vergessen ist auch die mangelnde Wertig- und Nachhaltigkeit. Die Moderne steht für Schnelllebigkeit und renditeträchtiges Bauen. Beliebige, austauschbare Entwürfe und billige Materialien führen zu einer „Wegwerfarchitektur“. Die vielfach mangelnde Qualität und Wertigkeit dieser Gebäude führt zu einer kurzen Nutzungsdauer und zu einem schnellen Abriss. Die fehlende Nachhaltigkeit ist nicht umweltgerecht. Auch die fehlende Kontinuität ist ein Problem: Der Stilgeschmack der Moderne wechselt mittlerweile innerhalb von wenigen Jahren. Schnelles Bauen und Abreißen hat fatale Folgen für das Stadtbild und verheerende Auswirkungen für die Ökobilanz der Stadt. Die Moderne hat sich zu einem teuren Millionengrab entwickelt. Die überdimensionierten Bauten sind nur aufwändig erneuerbar, so dass sich aus Kostengründen eine Sanierung oftmals nicht lohnt. Die mangelnde Anpassbarkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit moderner Bauten ist aus ökologischer Sicht nicht tragbar.
Besondern fatal bei der Nachkriegsmoderne ist die einseitige Verkehrspriorität auf das Automobil. In der Nachkriegszeit wurden riesige Verkehrsschneisen durch die gewachsenen Städte getrieben, die ganze Quartiere mit intakten Nachbarschaften getrennt haben. Mit einer erschreckenden Gleichgültigkeit wurden Baudenkmäler für Straßenprojekte und Parkplätze geopfert. Vielerorts wurden Straßenbahnen abgeschafft und der Individualverkehr mit dem Auto als fortschrittlich betrachtet. Mit der „autogerechten Stadt“, hat die Moderne ein für die heutige Zeit überkommenes Modell geschaffen. Die Stadt der Zukunft setzt dagegen auf fußgängerfreundliche, kurze Wege, ÖPNV und andere nachhaltige Verkehrsmittel. Sind Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Ausgehen funktional in der Stadt getrennt, so entstehen unnötige, aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll zu betrachtende Pendlerströme. Nicht zuletzt ist auch die vielfach zu beobachtende, ökologische Rücksichtslosigkeit bemerkenswert. Die Nachkriegsmoderne hatte nicht nur eine zerstörerische Kraft im Umgang mit der historischen Baukultur, sondern walzte auch Natur- und Erholungsanlagen für neue Betonburgen nieder. Vielfach wurden attraktive, innerstädtische Flussläufe begradigt oder verschwanden unter einer Betondecke. Auch vor Parkanlagen machte man keinen Halt: Für den Bau des SGZ-Hochhauses am Frankfurter Reuterweg schüttete man 1972 den beschaulichen Weiher des Rothschildparkes zu und fällte zudem mehrere 120 Jahre alte Platanen. Und für das 1963 eröffnete Intercontinental-Hochhaus planierte man eine parkähnliche Anlage am Main.
Das Fazit: Die Nachkriegsmoderne bietet auf keine Zukunftsfrage der Stadt eine befriedigende Antwort. Weder gestalterisch, noch aus ökologischer oder verkehrstechnischer Sicht bietet diese eine gute Lösung. Besonders die städtische Mischung, Dichte und Kleinteiligkeit fehlt bei der modernen Stadtgestaltung nach dem Krieg. Der Architekt Christoph Mäckler fasst das Dilemma perfekt zusammen: „Bebauungen, die keine Dichte und damit keinen städtischen Raum aufweisen, führen grundsätzlich zum Flächenfraß und zu weitreichender Versiegelung unserer Böden. Sie erzeugen unnötigen Verkehr und die damit verbundenen allmorgendlichen Staus. Sie widersprechen in erheblichem Maße der notwendigen Energieeinsparung und führen zur Verteuerung der Mieten, weil der teure Grund und Boden in einer lockeren Bauweise verschwendet wird. All das ist in der Diskussion um modernen Städtebau unwidersprochen, und man fragt sich, warum wir an dieser Bauweise trotzdem festhalten.“ (59) Als generische mit vielen Nachteilen behaftete „Städte ohne Eigenschaften“, bieten in der Nachkriegszeit überformte Metropolen keine hohe Identifikation für deren Bewohner. Besonders aus ökologischer Sicht bietet die funktional gegliederte Stadt eine Reihe von Nachteilen. Als Konsequenz bleibt nur ein verdichtender Umbau der Städte mit einem gleichzeitigen Rückbau der überholten Nachkriegsmoderne.
5.2 Nachhaltigkeit, Ortslosigkeit und Reproduzierbarkeit moderner Bauten
Ein großer Teil der Nachkriegsmoderne mit ihrem rein funktionalen Leitbild, ist nicht zukunftsfähig. Doch darf man moderne Bauten so einfach zurückbauen oder besser ausgedrückt abreißen? Vielfach enthalten viele Großbauten der Nachkriegsmoderne gesundheitsschädliche Materialien (Asbest etc.), sind klimatisch schlecht nachrüstbar und nicht mehr vernünftig nutzbar. Findet sich also kein Mieter mehr oder die Sanierung des Bauklotzes ist teurer als der Abriss, dann ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben und einem Rückbau steht nichts im Wege. Doch alle diese Punkte sollten natürlich sorgfältig bei jedem Abrisskandidaten vorab geprüft werden. Die „graue Energie“ die bei einem Abriss verloren geht ist enorm. Es gibt auch Beispiele, bei dem eine Transformation von einem Betonbauklotz zu einem stadtbildgerechten Gebäude durch Sanierung und Umbau gelungen ist. Aus Nachhaltigkeitsgründen wird das Bauen im Bestand und das Weiterbauen von bestehenden Gebäuden in Zukunft eine immer höhere Bedeutung erhalten.
Darüber hinaus sind beim Umgang mit Bauten der Nachkriegsmoderne natürlich auch Aspekte des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. In bestimmten Fällen, sind auch Bauten aus der Nachkriegszeit aus künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen, geschichtlichen oder städtebaulichen Gründen schutzwürdig und dürfen in diesem Fall natürlich nicht zum Abriss freigegeben werden. Doch eine inflationäre Unterschutzstellung von Nachkriegsbauten, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, ist nicht sinnstiftend. Es muss zudem berücksichtigt werden, wie der historische Kontext des Nachkriegsbaus war. Für das Technische Rathaus in Frankfurt am Main wurde z. B. wertvolle historische Altbausubstanz abgerissen. Außerdem stand der unmaßstäbliche Verwaltungsbau mitten in der Altstadt und hatte in keiner Weise zur örtlichen Situation gepasst. Ein Abriss des asbestverseuchten Technischen Rathauses war in diesem Sinne mehr als erforderlich und ist auch aus Sicht der Nachhaltigkeit absolut nachvollziehbar. Darüber hinaus ist ein Abriss auch Hinsichtlich der örtlichen Ungebundenheit und der Reproduzierbarkeit der modernen Bauten vertretbar.
Zu den Grundeigenschaften der Moderne gehört die Ortslosigkeit. Schon 1923 hatte Gropius von Internationaler Architektur gesprochen. Die Architektur im industriellen Zeitalter sollte sich von der Geschichte und vom konkreten Ort lösen und universell werden. (60) Auch der Internationale Stil der Architektur der 1920er und frühen 1930er sah sich als von den örtlichen Gegebenheiten abgetrennte Architektur. Ein moderner Bau ist losgelöst vom örtlichen Kontext und von der Geschichte des Ortes. Das macht diesen auch beliebig reproduzierbar. Es ist in diesem Sinne egal, ob z. B. ein moderner Verwaltungsbau mitten in eine Altstadt, am Stadtrand, oder in einem Gewerbegebiet gebaut wird. Ein Beispiel ist das moderne Rathaus von Kaiserslautern: Ursprünglich für Mannheim geplant, wurde es dann 1968 in Kaiserslautern gebaut. Da die Moderne keinen örtlichen Bezug kennt, könnte man denselben Rathausentwurf auch seriell und industriell gefertigt gleichzeitig in mehreren Städten bauen. Wenn es funktional vertretbar ist, könnte man den Bau auch als Hotel an den Ostseestrand stellen oder als Polizeipräsidium in einer südamerikanischen Stadt nutzen. So ist z. B das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen eine Paraphrase auf Mies van der Rohes Nationalgalerie in Berlin, das Haus des Buches in der Berliner Straße ist dem "Pavillion Suisse" in Paris von Le Corbusier angelehnt und das Bayerhaus in Frankfurt am Main, nahm sich das 1957 zerstörte Columbushaus am Potsdamer Platz in Berlin zum Vorbild. Die beliebige Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit sowie die Ortslosigkeit ermöglicht es auch die modernen Bauten jederzeit abzureißen, wenn diese ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Einige Stahlskelettbauten der Moderne waren sogar auf Demontage ausgelegt. Eine spätere Umsetzung des Gebäudes an einem anderen Ort wäre für einige Architekten solcher Bauten wohl vertretbar gewesen. Austauschbarkeit, Massenhaftigkeit und Beweglichkeit gehören zum Kern der Moderne. Es ist kein Verlust, denn man kann diesen Bau ja jederzeit an einer anderen Stelle der Welt, der Ort ist egal, noch einmal bauen. Auf die Spitze getrieben wurden die Austauschbarkeit der Moderne mit den Horten-Kacheln, die bundesweit in den sechziger und siebziger Jahren als vereinheitlichte Wabenfassade der Kaufhauskette fungierte. Das stellt auch die Unterschutzstellung von einigen modernen Bauten in Frage. Da jederzeit eine Vielzahl von Kopien möglich sind, gibt es eigentlich kein Original das man unterschutzstellen kann.
Anders ist es bei den traditionellen Bauten: Diese sind einzigartig und nehmen immer Bezug zu dem Ort, an dem sie gebaut wurden. Sie passen sich zudem in der Regel der Gestalt und Zeit ihrer Umgebung an. Deshalb kann man z. B. historische Gebäude nicht so einfach abreißen und an einer völlig anderen Stelle nochmal bauen, denn der bauliche Kontext fehlt. Die Dresdner Frauenkirche ist zum Beispiel für die altstädtische Umgebung gebaut und ist Teil der städtischen Dresdner Silhouette. Die Frauenkirche würde an anderen Orten ihre Wirkung verfehlen. Außerdem bilden althergebrachte Bauten Ensembles. Die Kubatur dieser Bauten ordnet sich den jeweiligen Straßenräumen, Plätzen und Vierteln unter. Moderne Bauten bilden keine Ensembles, sondern stehen für sich, losgelöst und unabhängig von ihrer Umgebung. Bei einem traditionellen Bau liegt zudem in der Regel eine große baukünstlerische Leistung dahinter. Er ist nicht austauschbar. Er ist in der Regel nur für den Ort, an dem es steht, gebaut.
5.3 Moderne Bauten schützen, weil Sie schön sind?
Schönheit liegt nicht im Auge jedes einzelnen Betrachters. Es ist kein Zufall, dass intakte, gemütliche Städte wie Freiburg, Heidelberg und Münster mit einem historischen Kern und einer hohen Lebensqualität bei den Menschen am beliebtesten sind. Gerade kleinteilige Viertel mit Altbauten haben eine riesige Anziehungskraft. Dagegen finden die meisten Menschen die Gebäude der Moderne hässlich. Egal, ob Häuser aus Waschbeton, kubistische Wohnwürfel oder klassische Bauhausvillen. Bei den Menschen können diese Bauten, z. B. im Vergleich zu stilreichen Gründerzeitbauten, kaum punkten. (61) Das ist auch kein Wunder, denn die Moderne hat nicht den Anspruch schöne Gebäude bzw. schöne Städte zu errichten. Bei der Moderne geht es darum, funktional und nützlich zu bauen. Bei diesem technokratischen Ansatz geht es nicht darum mit seinem Bauwerk zu gefallen. Wer also moderne Städte als hässlich bezeichnet, der beleidigt damit nicht die modernen Städteplaner und Architekten. Eine Beleidigung wäre es, diese Städte als nicht-funktional oder nützlich zu bezeichnen – dann hätte der Architekt bzw. Planer in der Tat etwas falsch gemacht. Die Modernisten haben ja ganz bewusst auf schmückende, ästhetische Elemente bei den Bauwerken verzichtet, weil sie diese als überflüssig empfanden. Man wollte mit den modernen Städten, zumindest in der Anfangszeit, in erster Linie die Lebensumstände der Menschen verbessern und die Wohnungsnot überwinden. Vor hundert Jahren, waren die hygienischen Zustände in den engen Altstädten oftmals miserabel. Die Gassen waren eng, ohne Sonnenlicht verschattet und mit verschmutzter Luft aus den Heizöfen durchzogen. Die Quartiere der Moderne waren genau das Gegenteil: Großzügige, durchgegrünte Wohnblöcke, die für saubere Luft und gesundes Sonnenlicht sorgten. Bei diesen modernen Quartieren ging es auch nicht darum „lebendige Quartiere“ zu schaffen, sondern ganz bewusst, plante man dieses ohne Läden, Cafés und Gewerbeflächen in den Erdgeschossflächen, denn man wollte die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Vergnügen trennen und die Wohnbevölkerung vor Lärm und Gestank schützen. Auch da spielten die Erfahrungen aus den engen Hinterhofquartieren der Altstädte und der industriegeprägten Gründerzeit eine Rolle. Man wollte keine neuen Armuts- und Elendsviertel mit prekären, mischgenutzten Fabriken und staubigen Gewerbeflächen in den Hinterhöfen schaffen. Deshalb schuf man besonders in der Nachkriegsmoderne funktional getrennte Quartiere für Wohnen, Einkaufen und Arbeiten.
Die Strecken zur Arbeit oder zum Einkaufen sollten, dem damaligen Zeitgeist entsprechend, mit dem Auto überwunden werden. Deshalb baute man nicht nur moderne Quartiere, sondern durchzog diese auch mit großzügig angelegten Straßenräumen für den Automobilverkehr. Heute wissen wir:1 Die Nachkriegsmodernisten wollten vielleicht die Lebensumstände der Menschen verbessern, hatten aber – aus heutiger Sicht – die falschen Prioritäten bei der Stadtplanung gesetzt. Es war ein Trugschluss, die Städte auf den Automobilverkehr auszurichten und für die Menschen reine Schlafsiedlungen und verödete Bürostädte zu bauen. Heute gibt es keine prekären Altstädte und industrieverqualmten Gründerzeitquartiere mehr. Sanierte, durchgemischte Altbau- und Gründerzeitviertel gehören heute zu den begehrtesten Wohnvierteln in den Städten. Der Autoverkehr wird mittlerweile mehr und mehr zurückgedrängt und die breiten Verkehrsschneisen der Nachkriegszeit entsprechend zurückgebaut. Unmittelbar nach dem Krieg mit seiner großen Wohnungsnot, waren die modernen Wiederaufbausiedlungen nicht schön, aber nützlich. Heute sind diese Siedlungen weder schön noch besonders nützlich im Stadtgefüge. Der Platzverbrauch der durchgrünten Nachkriegssiedlungen in den Stadtzentren ist immens. Damit werden riesige Flächen verschwendet, die eigentlich für dringend benötigten Wohnraum gebraucht werden.
Noch einmal zusammengefasst: Es ist ein großes Missverständnis von Anhängern der Nachkriegsmoderne, diese Bauten als schön zu bezeichnen, bzw. diese aus diesem Grund unter Schutz zu stellen. Die Nachkriegsplaner hatten für ihre Bauten andere Kategorien wie Schönheit und Ästhetik. Diese Kategorien waren Funktionalität, Nützlichkeit und Vereinheitlichung des Bauens. Das sollte man akzeptieren und nicht mit den falschen Argumenten spielen. Die Erbauer der Altstädte und der Gründerzeit dagegen wollten nicht nur nützliche, sondern zumeist auch schöne und langlebige Quartiere bauen. Das ist diesen Protagonisten des traditionellen Bauens, aus der heutigen Sicht gesehen, mehr als gelungen.
5.4. Warum Moderne nicht gleich Moderne ist
Wenn ich in den vorherigen und in den nächsten Kapiteln das „Scheitern der modernen Architektur“ beschreibe, dann ist damit vor allem die Nachkriegsmoderne der 60iger und 70iger Jahre und die jüngste Investorenarchitektur gemeint, die1 mit ihren gleichförmigen Bürokästen eine global austauschbare, nicht nachhaltige Architektur in den Städten etabliert hat. Diese gescheiterte Moderne ist gerade in Frankfurt am Main besonders präsent. Im Zeitgeist der 60iger und 70iger Jahre wurde, insbesondere auch in der Mainmetropole, ohne Rücksicht auf Verluste gebaut. Besonders im Westend wurden herausragende Villenbauten abgerissen und mit überdimensionierten, gleichförmigen Beton- und Glaskästen skrupellos überbaut. Diese Unkultur wird teilweise bis heute mit Mitteln der modernen Investorenarchitektur weiterverfolgt. Immer noch werden platzübergreifende Blöcke in gewachsene Stadtviertel gesetzt. Wo es geht werden noch links und rechts stehende Altbauten aufgekauft und abgerissen, um eine hohe Grundstücksgröße für den nachfolgenden, voluminösen Investorenbau zu erzielen. Diese beliebigen, austauschbaren Klötze, die sich nicht ihrer baulichen Umgebung anpassen und keine Rücksicht auf den Altbestand nehmen, repräsentieren mit ihren kläglichen Ergebnissen, die gescheiterte, entortete Nachkriegsmoderne.
Dagegen gibt es natürlich auch viele Bauten der Moderne die sich gut ins Frankfurter Stadtgefüge einfügen. Auf dem ehemaligen Schlachthofgelände und in einigen Teilen des Ostends sowie im Westhafen sind einige Quartiere mit urbaner Dichte entstanden, die teilweise von hoher Qualität sind. Besonders die Bauten der Frankfurter Architekten mit ihren Bauten der letzten 20, 30 Jahren passen sich überwiegend gut dem Charakter der Stadt an und überzeugen oftmals mit abwechslungsreichen Fassaden und detailreichen Profilierungen. Auch wenn die Moderne mit ihren in der Charta von Athen 1933 aufgeführten Ideen gescheitert ist, bleiben moderne Ideen erhalten. Doch die „Moderne 2.0“ ist weniger dogmatisch und brachial wie die von Corbusier propagierte Moderne. Alles „Alte“, jedes Ornament sollte damals verschwinden. Die heutige Moderne greift teilweise auch wieder auf Elemente der alten Stadtbaukunst zurück. Dicht und kleinteilig soll die heutige Stadt sein, ohne dass wir uns wie vor hundertzwanzig Jahren in enge und dunkle Hinterhöfe stapeln. Grünflächen sind wichtig, doch eine geschlossene, ressourcenschonende Bebauung genauso.
Fest steht, dass sich die Städte und damit auch die Architekten weiter verändern müssen. Großvolumige, funktional-getrennte Ego-Bauten in den Innenstädten haben keine Zukunft. Der Rückzug des stationären Einzelhandels aus den Innenstädten in Folge der Onlinekonkurrenz und das schrumpfen von Büroflächen durch Remote Work – das Arbeiten von Zuhause aus – nimmt gerade erst Fahrt auf. Hinzu kommt die fortschreitende Klimakrise, die zu weniger Verkehrsflächen und mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit Altbauten führen wird. Die konformistische Moderne von Le Corbusier mit ihren radikalen Ideen und städtebaulichen Zumutungen ist krachend gescheitert. Die traditionelle, vielfach propagierte europäische Stadt, ist dagegen so aktuell wie nie.
6. KRITERIEN FÜR DIE ZUKUNFTSFÄHIGE STADT 2.0
Welche Kriterien sind für eine Stadt wichtig, um die vielfältigen Herausforderungen in der Zukunft zu bewältigen? In diesem Kapitel geht es um die Erfolgskriterien für eine ressourcenschonende, lebendige und attraktive Stadt.
6.1 Die Attraktivität der Stadt steigern
Wie sollte der Städtebau, die Stadtplanung sowie die Stadtbildpflege in Zukunft aussehen? Fest steht, dass die vielfach geforderte lebendige, ökologisch-gerechte Stadt der kurzen Wege nicht in der beschriebenen gescheiterten Moderne, sondern in der kompakten europäischen Stadt zu finden ist. Die Hinwendung zur alten, klassischen Stadt mit traditioneller Gliederung ist kein Zufall, sondern entspringt einem länderübergreifenden Konsens im Zuge einer sich ökologisch stark verändernden Welt. Wie in den vielfältigen Quartieren der europäischen Stadt als Leitbild ablesbar, gibt es unabdingbare Voraussetzungen für einen gelungenen Städtebau. Dazu zählen u.a. eine gute und dauerhafte Gestaltung von Häusern, Straßen- und Platzräumen sowie eine urbane Dichte. Speziell in Deutschland gibt es einige hoffungsvolle Ansätze, um die Qualität im Städtebau zu erhöhen. Stadtbauräte, Dezernenten und Planungsamtsleiter aus zahlreichen deutschen Städten (darunter Hamburg, Hannover, München, Köln und Frankfurt am Main) haben die vom Deutschen Institut für Stadtbaukunst initiierte „Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht“ unterzeichnet. Sie fordert u.a. eine grundlegende Novellierung der Baunutzungsverordnung BauNVO, z. B. hinsichtlich der Dichteobergrenze, damit „in Zukunft schöne und lebensfähige Stadtquartiere planbar werden und nicht an überholten planungsrechtlichen Restriktionen scheitern“ (62). Wenn Frankfurt wieder zu mehr urbane Dichte und Schönheit finden soll, dann ist dies also kein frommer Wunsch von einigen Altstadtnostalgikern, sondern ein städtebauliches Leitbild, das auf überregionaler Ebene fest verankert ist.
Die Gründe für das schöne Bauen liegen auf der Hand: Die Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität für die Bürger und Touristen werden gesteigert. Attraktive Städte können im Wettbewerb der Städte für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Standortvermarktung sorgen. Touristen, Unternehmen und Arbeitnehmer werden so in die Städte gezogen und die lokale Wirtschaftskraft gesteigert. Das ist sehr wichtig, denn nur eine finanziell gesunde Stadt kann seine lebenswichtige Infrastruktur dauerhaft finanzieren. Besonders eine traditionsreiche Stadt wie Frankfurt kann mit ihrem bemerkenswerten, historischen Erbe und mit ihrem kulturellen Angebot ihr Stadtimage weiter schärfen.
6.2 Kriterien für die Stadtplanung
Die Moderne hat die Örtlichkeit nicht nur im Kontext zu ihrem baulichen Umfeld, sondern auch im städteplanerischen Sinne überwunden. Deshalb gehört zu deren Merkmalen auch, dass historisch gewachsene Stadtgrundrisse jederzeit verändert werden können. So planten die Modernisten die Städte nach dem Krieg völlig neu und zeichneten breite Verkehrsschneisen in gewachsene Wohnquartiere. Die Stadt ist in der Moderne nur eine beliebige Blaupause, die den modernen Gegebenheiten unterliegt. Der Vordenker der spätmodernen Architektur Rem Koolhaas hat diesen Gedanken konsequent weiterentwickelt und spricht sogar von einer generischen Stadt. Die generische Stadt ist nicht geplant, sondern entsteht einfach so. Eine eigenschaftslose Stadt ohne Identität, die geradezu zynisch das Ende der historisch gewachsenen Stadt heraufbeschwört. In Frankfurt am Main hatte es die Stadtplanung nach dem Krieg versäumt in sich geschlossene Quartiere zu bauen. Die Gebäude stehen oftmals ohne Bezug zueinander. Die Qualität und Nachhaltigkeit wie in den Gründerzeitvierteln fehlen. Darum werden in der Stadt immer wieder große Areale wie z. B. im Allerheiligenviertels abgerissen und wieder neu bebaut. Die Baustellen der Stadt sind überwiegend in den nach dem Krieg gebauten Quartieren zu finden. Teilweise stehen die modernen Gebäude keine 30-40 Jahre und werden dann schon wieder erneuert bzw. durch Neubauten ersetzt.1
Wenn die moderne Stadtplanung in der Nachkriegszeit überwiegend gescheitert ist, bzw. auch nicht das richtige Rezept für die urbane Stadt der Zukunft mitbringt, muss ein anderes, fortschrittlicheres Stadtplanungskonzept gefunden werden. Es gibt insbesondere viele gute Gründe, die aufgelockerte Stadt der Nachkriegszeit wieder maßvoll zu verdichten. Das menschliche Maß und nicht das Auto muss wieder die Stadtplanung bestimmen. Als Grundsatz der Stadtplanung nach menschlichen Maß muss, laut des wohl führenden Vordenkers in der Stadtplanung Jan Gehl, der Stadtraum mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers erlebt werden. Nur so können Städte für Menschen gemacht werden. (63) Die menschengerecht geplante Stadt der Zukunft sollte, wenn man die aktuellen Erkenntnisse zusammenfasst, folgendermaßen aussehen:
„Eine klima- und ressourcenschonende, lebendige, menschengerechte und sichere Stadt, funktional und sozial gemischt, mit bezahlbarem Wohnraum und Bauten die langlebig, nützlich und schön sind.“
In den Städten, die von Experten geplant und gebaut werden, müssen alle Bürger leben. Bei der Stadtplanung sollten daher die Bürger demokratisch an der Planung beteiligt werden. Bei der Umsetzung sollten die Wünsche der Bürger und Bezugsgruppen u.a. durch Befragungen und Bürgerbegehren berücksichtigt werden. Ziel ist eine partizipierende Mitbestimmung der Bürger, des örtlichen Handels sowie der Kulturträger bei der Planung von Anfang an zu ermöglichen. Viele der hier aufgeführten Elemente für eine menschengerecht geplante Stadt, finden sich auch im 2015 verabschiedeten Innenstadtkonzept der Stadt Frankfurt am Main wieder. Auch hier ist von einer urbanen Durchmischung die Rede, bei der die Monostrukturen der 50ier und 60iger Jahre aufgelöst werden. Fußgänger und Radfahrer sollen laut dem Konzept zudem gestärkt und der motorisierte Individualverkehr zurückgedrängt werden. (64)
6.3 Kriterien für die Bebauung in der Stadt
Wie sollte zukünftig gebaut werden? Die gescheiterte Nachkriegsmoderne liefert dazu nicht die richtigen Lösungen. Wer ökologische und menschengerechte Städte schaffen möchte, der muss sich als Leitbild auf die Vorzüge der urban-kompakten, nutzungsgemischten und nachhaltigen europäischen Stadt besinnen. 2007 haben die 27 in Europa für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister die "Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt" verabschiedet. Darin sind diese Ideen als Grundlagen für eine neue Stadtpolitik in Europa ausformuliert: Wohnen, Arbeiten und Freizeit sollen in diesem Sinne gemischt werden und Einseitigkeit und Monotonie in der Stadtentwicklung vermieden werden. Die Städte werden durch die gemischte Nutzung spannender, lebendiger und sozial stabiler und können sich gegen Krisen (wie z. B. das Sterben von innerstädtischen Kaufhäusern und Einkaufszentren) besser schützen. Insbesondere kompakte Städte mit einer urbanen Dichte sorgen zudem für einen sozialen Austausch. Diese haben sich auch mit ihrem geringen Flächenverbrauch als die nachhaltigste Wohnform erwiesen und der Energie- und Infrastrukturaufwand hält sich in Grenzen. Die kompakte, nach menschlichen Maß geplante Stadt, in der alles im 15-Minuten-Radius erreichbar ist, kann energiesparend zu Fuß oder mit dem Rad genutzt werden, so dass entsprechend auch weniger Emissionen erzeugt werden. Eine urbane Dichte ermöglicht kurze Wege und schafft eine hohe Frequenz für den Einzelhandel und lässt auch nach Ladenschluss das Zentrum nicht veröden.
Hochwertige und schöne Städte mit abwechslungsreichen Straßenfassaden haben bewiesen, dass sie die höchste Attraktivität, Lebensqualität und Nachhaltigkeit bieten. Es sollte daher wieder vermehrt an der Stadtbaukunst der historisch gewachsenen Stadt angeknüpft werden und bewährte Bautypologien, z. B. mit Gebäudesockeln, einem Mittelteil mit gegliederten Fassaden und einem Abschluss, umgesetzt werden. Roter Sandstein, als traditioneller Baustoff in Frankfurt, sollte wieder eine höhere Bedeutung bei Neubauten erfahren. Es sollten hochwertige Materialien verwendet werden, damit Gebäude mit hoher Wertigkeit und Langlebigkeit entstehen. Das führt zu einer hohen, ökologisch angestrebten Nachhaltigkeit. Der lebendige Stadtraum entsteht durch Dichte, Nutzungsmischung und wohlproportionierte Straßenräumen mit vielfältigen Sichtbezügen und spannungsvollen Raumabfolgen. Die meisten Städte die wir bewundern, stellen eine harmonische Abfolge von Variationen von immer gleichen Gebäuden dar. (65) Mit anderen Worten: Eine exzentrische Egoarchitektur die sich nicht dem städtischen Ensemble harmonisch unterordnet, zahlt nicht in die Schönheit einer Stadt ein. Neubauten müssen sich in der Nachbarschaft einfügen.
Es sollte zudem nicht nur – der Rendite folgend – Großvolumig, sondern vermehrt Kleinteilig gebaut werden. Von einer Stadt der kurzen Wege können mehr Menschen partizipieren und es entsteht eine abwechslungsreiche, lebendige Stadt. Es sollten keine geschlossenen Räume („gated Areas“) gebaut werden, sondern großzügige, öffentliche, barrierefreie Räume in der Stadt vorhanden sein. Die Entwicklung von Vielfalt und Multifunktionalität und eine ausgewogene Mischung von Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie und Kultur ist für eine Stadt, die Schönheit, Urbanität und Nachhaltigkeit verbindet, unverzichtbar. Zudem sollte der städtebauliche Kontext berücksichtigt werden, d.h. ein behutsames Bauen mit Gebäuden, die sich in die Umgebung einfügen und Ensembles vervollständigen. Neu gestaltete Bauten sollten sich in der Proportion und in der Gliederung in das Straßenbild einfügen. Die Sicherung des historischen Stadtgrundrisses und der Stadtidentität hat oberste Priorität. Auch im Bestand sollte behutsam gebaut werden. Der historische Grundriss sollte immer berücksichtigt werden, denn auf vorhandenen Straßen und Wegen sind alle Versorgungsleitungen vorhanden und es müssen somit ressourcenschonend keine weiteren Flächen auf der grünen Wiese infrastrukturell erschlossen werden. Nicht nur unnötige Abrisse sollten vermieden werden (Stichwort „graue Energie“), sondern auch sinnloses Bauen von Büro- und Wohnhäusern. Ins Umland ausfransende, uferlos wachsende Städte mit ihrem Flächenfraß schaden der Natur. Darüber hinaus sorgt die Landflucht in die Städte, für sterbende Gemeinden und Dörfer im ländlichen Raum. Aus ökologischer Sicht können nicht die letzten, natürlichen Freiflächen zugebaut werden. Das Thema Nachverdichtung in den Innenstädten ist daher ein großes Thema. Die Städte werden sich nach Innen weiterentwickeln und besonders vertikal und im Untergrund verdichten. Insbesondere Bauten der Nachkriegsmoderne bieten sich für Dachaufstockungen an. Historische Gebäude müssen mit Respekt weitergebaut werden. So kann man Dachaufbauten so gestalten, dass sie von der Straße aus nicht sichtbar sind. Dacherweiterung müssen heute vielfältige Nutzungsanforderungen erfüllen: Als energetisch genutzte „fünfte Fassade auf dem Dach“, müssen diese auch gestalterisch überzeugen und das Potenzial der Gebäude ausschöpfen.
Frankfurt am Main ist eine besonders kompakte Stadt, die sich wegen einer Reihe von Baubeschränkungen und Fluglärmzonen kaum ausbreiten kann. Eine innerstädtische Verdichtung, z. B. durch eine Blockrandbebauung in den platzgreifenden Nachkriegssiedlungen, ist zu begrüßen. Die locker durchgrünte Stadt bietet nicht gleichwertig hohe Erholungsflächen wie Parks. Städtische Parks sollten daher besonders geschützt werden. Im dicht bebauten Frankfurt sollten die Wallanlagen und Freiflächen wie die Mainwasen nicht bebaut werden. Alter Baumbestand darf für neue, großvolumige Bauprojekte nicht einfach so geopfert werden. Frankfurt am Main sollte zur „Schwammstadt“ werden, bei der Regenwasser lokal aufgenommen wird und nicht nur kanalisiert und abgeleitet wird. Innenhöfe, Flachdächer und Garagen sollten dementsprechend begrünt werden. Kleine Freiräume können z. B. als „Pocket-Parks“ umgewandelt werden. Auch große, aufheizende Glasflächen, Flächenfraß und Versiegelung sollten es nicht länger in der Stadt geben. Hochversiegelte Parkplätze und Schottergärten passen nicht mehr in die Zeit. Auf Wegen und Plätzen sollten versickerungsfähige Böden bzw. Pflaster verwendet werden. Alte Bäume und wertvolle Sträucher müssen besonders geschützt werden. Bäume spenden Schatten und die Pflanzen verdunsten Feuchtigkeit, dadurch wird es in der Stadt kühler und den immer häufiger werdenden Hitzewellen kann etwas entgegengesetzt werden. Nicht zuletzt muss dem Individualverkehr zu Fuß oder per Rad und dem öffentlichen Nahverkehr eine höhere Priorität zugewiesen werden. Die ersten Städte haben bereits verbindliche „Freiraum- und Klimasatzungen“ für eine klimagerechte, ressourcenschonende und nachhaltige Stadt erlassen, die in diese Richtung gehen.
Bauen sollte in der Stadt identitätsstiftend wirken. Es sollte ein Gestaltungsbeirat in der Stadt etabliert werden und es sollten zudem gestalterische Vorgaben mit Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen etabliert werden, um den Bestand zu erhalten. Geschützt werden müssen Gebäude, Plätze und Ensembles, die ein Viertel prägen bzw. stark zur Atmosphäre eines Quartiers beitragen. Wichtige Stadtviertel und Straßenzüge müssen in der Folge konsequent mit Erhaltungssatzungen geschützt werden. Für Neubauten in historisch gewachsenen Quartieren müssen Gestaltungssatzungen gelten. Darin werden z. B. bestimmte Dachformen und Bauhöhen vorgeschrieben. In geschützten Gründerzeitviertel sollten sich Neubauten z. B. an der bestehenden Bautypologie orientieren: fein gegliederte Gebäude und harmonische Ensembles mit Sockel, Gesimsen, Sprossenfenstern und Walmdach. Auch eine Orientierung am historischen Grundriss sollte dabei festgelegt werden. So wird ein Bewusstsein für die historische Bausubstanz geschaffen und kontextfremde „Bauklötze“ werden verhindert. Das Stadtplanungsamt Frankfurt am Main hat im August 2019 unter dem Titel „Qualität im Städtebau“ allgemeine Leitlinien für die Bauplanung und Bauberatung herausgegeben. Viele was hier aufgezählt wurde, wie ein Nutzungsmix und eine Gebäudegliederung, ist in ähnlicher Form auch in diesen Leitlinien zu finden. (66) In der Theorie wissen die Städte bereits, dass die Nachkriegsmoderne gescheitert ist und daher besser wieder auf dem Kanon traditioneller Gestaltungsprinzipien zurückgegriffen werden sollte. Diese Baukriterien müssen nun auch im praktischen Alltag konsequent angewendet werden. Ein erstes Neubaugebiet, dass auf die Vorzüge der traditionellen „europäischen Stadt“ zurückgreift, steht am Römerhof in den Startlöchern. In einem Workshop-Verfahren zwischen dem Stadtplanungsamt, der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG und dem Institut für Stadtbaukunst wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts ein städtebaulicher Entwurf vorgestellt, der an die bewährten Quartiere aus der Gründerzeit erinnert. Angestrebt wird eine abwechslungsvolle, dichte Blockrandbebauung mit geschützten Innenhöfen, schön gestalten Straßenräumen und kurzen Wege. Sozial und funktional gemischt soll ein lebendiges Stadtviertel mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. (67)
Den Hochhausrahmenplan behutsam weiterentwickeln
Sehr genau sollte zukünftig auch über die weitere Ausgestaltung des Hochhausrahmenplans in Frankfurt am Main nachgedacht werden. Historisch gewachsene Stadtteile wie das Gutleutviertel, sollten dabei für den Bau neuer Hochhäuser absolutes Tabu sein. Frankfurt hat zum Beispiel im Bankenviertel eine sehenswerte Skyline durch die Clusterbildung der Wolkenkratzer und durch die freistehende Situation hinter den Wallanlagen erzielt. Einzeln verstreute Wolkenkratzer mitten in gründerzeitlichen Wohnvierteln haben dagegen keine positive Wirkung auf die Skyline. Im Gegenteil, diese im Stadtbild eingesprengten Glastürme nehmen nicht nur die Wirkung der Hochhauscluster weg, sondern führen auch zu einer Verschattung und Minderung der intakten Wohnviertel. Man sollte nicht die gewachsenen, innerstädtischen Wohnviertel mit neuen Bürohäusern füllen. Es ist an vielen Stellen sinnvoll, Hochhäuser einer gemischten Nutzung zuzuführen. Doch Wolkenkratzer und Gründerzeitbauten, sollten nicht in einem Quartier wild gemixt werden. Der Drang, dann noch weitere traditionelle Bauten zugunsten von Bürohochhäusern abzureißen ist hoch. Auf Grund ihres großen Volumens, sollte eine öffentliche Sockelnutzung bei allen Wolkenkratzern obligatorisch sein. Diese Flächen können vielfältig genutzt werden z. B. von Kultureinrichtungen, Restaurants, Schulen und Kitas. So entstehen wertvolle Räume für die Menschen in der Stadt. Da es immer schnellere Nutzungswechsel bei Investorenbauten gibt, sollten die Hochhäuser von vorne herein für eine hybride Nutzung konzipiert werden.
6.4 Kriterien für die Stadtbildpflege
Der öffentliche Raum mit seinen Denkmälern, charakteristischen Plätzen und altem Baumbestand sollte geschützt und gepflegt werden. Plätze sollten zudem nicht das ganze Jahr mit Festen und kommerziellen Gewerbeschauen belegt werden. Die lokale, identitätsstiftende Gastronomie und Kultur sollten bewahrt werden. Das Stadtbild im öffentlichen Raum muss besonders vor visueller Verschmutzung geschützt werden: Mit Gestaltungssatzungen sollte gegen den Wildwuchs bei Stadtmöbeln, der Pflasterung, Verkehrswerbung und Abstellflächen vorgegangen werden. Viele Straßen und Plätze sind mit Pollern, Rampen, Mülltonnenboxen und wild parkenden Fahrrädern und Elektrorollern zugestellt. Hier müssen verbindliche, gestalterische Konzepte in der Stadt durchgesetzt werden. Ungepflegte Grünflächen, Straßen und Bürgersteige tragen nicht zu einem schönen Stadtbild bei. Auch eine allgemeine „Vermüllung“ und Vandalismus sollten in der Stadt wirksam unterbunden werden. Es ist nicht hinzunehmen, wenn öffentliche Flächen wie Park- und Rasenflächen mit Müll verschmutzt werden und z. B. Glasscherben zu einer Gefahr für spielende Kinder oder Tiere werden. Auch der zunehmende Vandalismus, bei denen z. B. Stadtmöbel wie Parklampen und Sitzbänke mutwillig zerstört werden, geht mit hohen Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten zu Lasten der Allgemeinheit. Die Stadt als Institution hat offensichtlich nicht immer die personellen Ressourcen, um Vandalismus und Vermüllung im öffentlichen Raum konsequent zu unterbinden. Die Ordnungsämter können daher z. B. von ehrenamtlichen Parkwächtern unterstützt werden. Außerdem sollten die oftmals überquellenden Abfalleimer am Main und in den Parks, insbesondere am Wochenende, regelmäßiger gelehrt werden. Eine konsequente Stadtbildpflege muss eine Selbstverständlichkeit werden, um dem so genannten Littering, d.h. der Vermüllung des öffentlichen Raums, wirksam entgegenzutreten.
6.5 Kriterien für die Stadtreparatur
Ein weiterer, wichtiger Punkt für die Schaffung einer attraktiven, lebenswerten Stadt, ist die kontinuierliche Stadtreparatur. Sanierungen sollten Denkmalgerecht durchgeführt werden und langer Leerstand unter allen Umständen vermieden werden. Um ein harmonisches Stadtbild zu erzielen, sollte auf eine Geschlossenheit der Stadt geachtet werden. Aktiv sollte Stadtreparatur betrieben werden: Leerräume, d.h. völlig ungenutzte Brachflächen im Zentrum, sollten bebaut werden und Baulücken geschlossen werden. Bei der energetischen Sanierung sollten Altbauten stets von innen gedämmt werden, denn mit Dämmmaterial verklebte Altbaufassaden sind weder stadtbild- noch umweltgerecht. Altbauten weisen übrigens, durch die dichtere Bebauung in den Altbauvierteln, per se eine bessere Ökobilanz, als freistehende Bauten in Neubauvierteln auf. Dort wo es geht sollte städtische Fassaden aufgewertet werden, z. B. durch einen regelmäßigen Anstrich mit einem Anti-Graffitischutz sowie durch die Wiederbestuckung von zerstörten Altbaufassaden. Nachkriegsprovisorien wie am Frankfurter Bahnhofsvorplatz, mit fehlenden Etagen und Dächern bzw. Notdächern, sollten nach historischem Vorbild wieder aufgesattelt werden. Betonmonster und Verkehrsschneisen in den Zentren sollten im Sinne einer menschengerechten Stadtreparatur zurückgebaut werden. Insbesondere der öffentliche Raum muss z. B. mit der Anlage von harmonischen Plätzen aufgewertet werden. Nicht zuletzt sollten Rekonstruktionen von geschichtsreichen Bauten in der Stadt gefördert werden. Die Stadtreparatur in den einzelnen Quartieren kann auch mit einer Mischung aus angepassten Neubauten und schöpferischen Nachbauten erfolgen, so wie es im DomRömer-Areal in Frankfurt erfolgreich umgesetzt wurde. Das Rekonstruieren ist übrigens kein Zugeständnis an einige wenige Traditionalisten, sondern spiegelt die mehrheitliche Meinung der Bürger in Deutschland wieder. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage von 2017 im Auftrag der Bundesstiftung Baukultur, wurde die Meinung der Bürger zum Wiederaufbau historischer Gebäude abgefragt: 80 % der befragten Bundesbürger, finden den Wiederaufbau vollständig zerstörter Gebäude nach historischem Vorbild grundsätzlich gut. (68)
6.6 Kriterien für die Markenbildung der Stadt
In einer globalisierten Welt, gleichen sich die Städte durch eine austauschbare "Investorenarchitektur" immer mehr an. Gerade für Finanz- und Messeplätze wie Frankfurt werden daher "weiche Faktoren" wie das kulturelle, gastronomische und das Beherbergungsangebot immer wichtiger. Auch der ortstypische Charakter einer Stadt wird mehr und mehr zur "Visitenkarte", um im globalen Standortwettbewerb bestehen zu können. Historisch gewachsene Städte sollten ihre unverwechselbare Identität bewahren. Diese Identität wird nicht nur durch moderne Bauten verkörpert, sondern mehr noch durch die historischen Spuren, die sich immer noch in vielen Ortsbildern ablesen lassen. Neben den geschichtsreichen Bauten, gehören auch der jahrhundertealte Handel und die traditionelle Gastronomie zum Markenkern von Frankfurt. Es ist ein Armutszeugnis, wenn die Stadt nicht eingreift, wenn z. B. traditionsreiche Apfelweingaststätten schließen müssen, weil Investoren eine höhere Flächenausnutzung anstreben und den Bestand abreißen. Es ist weder nachhaltig, solche Gebäude zu zerstören, noch dient es dem Wirtschaftsstandort Frankfurt. Investoren, Messebesucher, Arbeitnehmer und Touristen meiden austauschbare Städte, ohne eigene Identität. Städte die nur mit den weltweiten Gastronomieketten bestückt sind, haben keinerlei Wiedererkennungswert und damit keinerlei Anziehungskraft. Alte, urige, traditionelle Gastronomieangebote und lokale Einzelhändler sind in der Gunst der Besucher einer Stadt nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen ist auch die so genannte „kreative Klasse“ für eine Stadt. Die kreativen Köpfe einer Gesellschaft und die von ihnen ausgehenden Innovationen sind entscheidend für das ökonomische Wachstum von Städten und Regionen. Es ist kein Zufall, dass z. B. Berlin, mit seinem Image als kreative und kulturstarke Stadt, besonders viele IT-Entwickler und Startups anzieht und auch eine riesige Gigafactory für Elektroautos sich im Berliner Umland angesiedelt hat. Viele Unternehmen aus der wachstumsstarken Softwareindustrie sind den nach Berlin übergesiedelten Entwicklern hinterhergezogen. So ist der kreative Output einer Stadt auch zu einem bedeutenden Faktor für das Wirtschaftswachstum geworden.
Zur Identität von Frankfurt gehören auch die gute Verkehrslage und die damit einhergehende Internationalität der Stadt. Durch eine Laune der Natur gab es auf der Höhe der heutigen Frankfurter Altstadt eine Furt über den Main. Hier konnte der Main überquert werden und so führten immer schon viele Handelswege durch die Stadt. Frankfurt war, durch seine gute Verkehrslage, schon immer eine bedeutende Ankunftsstadt, ein Durchlauferhitzer, der jeden zugezogenen Menschen schnell zu einem Frankfurter macht. Die Internationalität und gelebte Toleranz in der Stadt sind demnach kein Zufall, sondern ein Teil der geschichtsreichen Identität. Bereits früh ließen sich Kaufleute aus Belgien, Frankreich und Italien in Frankfurt nieder. (69) Der Zuzug von Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden im 16. Jahrhundert brachte vier prosperierende Geschäftszweige (Buchhandel, Seidenhandel, das Geldgeschäft und der Goldschmiede- und Juwelenhandel) in die Stadt. In dieser Zeit entstanden auch die prägenden Altstadthäuser von Neubürgern aus den südlichen Niederlanden. Was vor hunderten Jahren in der Altstadt begann war der Urknall für die heutige Messe und für die Finanz- und Bankenmetropole. Es war der Wegbereiter für das kosmopolitische, weltoffene Frankfurt am Main.
7. AUSBLICK: QUO VADIS FRANKFURT AM MAIN?
Der Klima- und Verkehrskollaps sowie ein fortschreitendes Innenstadtsterben setzten die Städte unter großen Druck. Am Beispiel von Frankfurt am Main wird aufgezeigt, wie die großen Potenziale der Stadt für mehr nachhaltiges Wachstum und für eine florierende Stadtkultur genutzt werden können.
7.1 Die Weiterentwicklung der Stadt
Frankfurt sollte als Stadt mit seinen tiefen, historischen Wurzeln noch mehr sein vorhandenes und teilweise noch verstecktes Potential nutzen, um sein Stadtprofil zu schärfen. Viele Orte warten auf ihre (Wieder-)Entdeckung. Neben der historischen Altstadt verfügt Frankfurt z. B. noch über weitere Fachwerkquartiere in Frankfurt-Höchst und in Alt-Sachsenhausen, die noch mehr als besuchswerte Orte für Besucher und Touristen herausgestellt werden müssten. Die Aufwertung des öffentlichen Raumes und der Erhalt der alten Bausubstanz bleiben eine große Kraftanstrengung: Die Quartiere bewegen sich immer wieder zwischen Verfall und Sanierung. Besser sieht es in den Frankfurter Gründerzeitquartieren aus, deren Bauten große, flexible Stadtwohnungen bieten und gut saniert zu den Renditebringern auf dem Immobilienmarkt zählen. Eine Ausnahme ist das Bahnhofsviertel: Ausgestattet mit herrschaftlichen Gründerzeitbauten, schwankt das Viertel zwischen Luxussanierung und Verwahrlosung. Die Stadt steuerte bereits 2005 mit dem Beschluss eines städtischen Rahmenplans zur Förderung von Wohnraum dagegen und sorgte für eine deutliche Aufwertung. Statt Abwanderung ist seitdem ein Zuzug zu vermelden und vor allem auch bei jungen Menschen hat das Viertel an Attraktivität gewonnen. Doch die alten Probleme Drogen und Kriminalität, bleiben bestehen. Das Entree der Stadt wartet auf eine langfristige Weiterentwicklung. Insbesondere der Bahnhof und sein Vorplatz bedürfen einer Neugestaltung und Verschönerung.
Die westliche und südliche Altstadt nachverdichten
Das Quartier um die Alte Mainzer Gasse wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erschlossen, als die Stadt rund um die Kaiserpfalz zu eng geworden war. Das Viertel wurde zunächst Unterstadt genannt, dann entwickelte sich hier das erste Frankfurter Westend. Die Alte Mainzer Gasse war, weil sie auch direkt an den mittelalterlichen Hafen Frankfurts anschloss, der eigentlich Messplatz. Erst im zweiten Weltkrieg ging dieses bedeutsame Quartier unter und verlor dann mit dem Neuaufbau als gelockerte-gegliederte Siedlung ihre jahrhundertealte Bedeutung. Die vorschnell unter Ensembleschutz gestellte westliche Altstadt mit ihren Bauten aus den 50iger Jahren, ist heute ein völlig totes Gebiet, das auf seine Wiederbelebung wartet. Wenige Meter hinter dem lebhaften Römerberg wartet, rund um die Alte Mainzer Gasse und der Limpurgergasse, die große Ödnis. Eine vernachlässigte Vorortoase am falschen Platz. Die beliebigen Wohnzeilen nehmen keine Bezüge zur Geschichte oder Lage des Ortes und könnten überall stehen. Die weitläufigen Zeilenbauten mit einer reinen Wohnnutzung bis hin in die Erdgeschosse, entspricht zudem nicht der innerstädtischen, urbanen Lage des Altstadtgebietes. Hier finden sich städtische Ämter, verwaiste Plätze ohne Aufenthaltsqualität und großzügige Abstellflächen für Kraftfahrzeuge in allerbester Lage. Ein Nachkriegsprovisorium das offensichtlich bis heute nicht in den Fokus der Stadtplanung geraten ist. Der verschwenderische Umgang mit Freiflächen in der Innenstadt ist mehr als verwunderlich, denn in der Stadt herrscht akute Wohnungsnot und es gibt nur wenige Bauflächen im übrigen Stadtgebiet. Hier müsste zeitnah ein lebendiges Quartier mit einer altstadtgerechten, kleinteiligen Bebauung und Läden und Gastronomie in den Erdgeschossen etabliert werden. Ein kleinteilig bebautes Quartier kann dabei aus einer Mischung aus klassischen und neuinterpretierten Altstadthäusern, Townhouses und rekonstruierten Leitbauten bestehen. Dabei sollte es eine stilistische Leitlinie über die Ausgestaltung der Fassaden und die Kubatur der Gebäude geben. In Polen gibt es einige erfolgreiche Wiederaufbauprojekte von Altstadtkernen, die nach diesem
Muster vorgegangen sind. (70) Wichtig ist natürlich auch eine altstadtgerechte Einbindung der romanischen Leonhardskirche und des Karmeliterkloster, die wie Inseln in der tristen Nachkriegsbebauung liegen. Die Kultur des Quartiers muss wiederentdeckt werden: In der in der westlichen Altstadt gelegenen Buchgasse befindet sich der Ursprung der Frankfurter Buchmesse – hier könnte z. B. ein kleines PopUp-Festivalcafe während der Buchmesse eingerichtet werden.
Besonders wichtig ist eine räumliche Neufassung der westlichen Altstadt, mit Bauten, die sich von der Typologie des Ortes ableiten. Durch eine geschlossene Blockrandbebauung kann das mit Freiflächen durchzogene Areal nachverdichtet werden und zudem eine klare Trennung zwischen privaten und öffentlichen Raum erzielt werden. Dabei sollte man nicht den Fehler machen und in der westlichen Altstadt ein Luxusquartier bauen. Spekulanten, die an diesem Ort mit renditeträchtigen Immobilien spielen, werden diesem besonderen Ort nicht gerecht. Hier muss in einem bezahlbaren Rahmen Alt und Jung zusammenleben können und damit ein weiteres Altstadtquartier der Begegnung geschaffen werden. Was für die westliche Altstadt gilt, das gilt z. B. auch für die südliche Saalgasse, die – auf der gegenüberliegenden Seite der postmodernen Wohnhäuser – auch auf eine altstadtgerechte Wiederbelebung wartet.
Die Straßen- und Platzgestaltung in der Stadt
Die richtigen Ideen fehlen bei der Gestaltung der Plätze in der Stadt. Oftmals sind diese von einem unbefriedigenden, gestalterischen Wildwuchs geprägt.1 So wird der Roßmarkt mit dem Goethe- und Rathenauplatz als einzige große, zugige und versiegelte Fläche ohne räumliche Wirkung wahrgenommen. Leben kehrt, im Gegenteil zum Opernplatz, meistens nur bei vorgegebenen Events ein. Die winzigen Bäume haben keine Wirkung und die verstreut und ungeschützt im Raum stehenden Sitzgelegenheiten sind größtenteils ungemütlich. Die mangelnde Aufenthaltsqualität lässt die Menschen den Platz schnell überqueren. Wer atmosphärische Platzräume schaffen möchte, wie wir es von vielen europäischen Städten kennen, der muss auch gastronomische Angebote einbinden und den Platzraum ausreichend beschatten und vom Verkehrsraum besser schützen. Auch kühlende Brunnen sind in Klimawandelzeiten, in den aufgeheizten Städten, existenziell wichtig. Selbst die zentralen Plätze in der Innenstadt, die Hauptwache und die Konstablerwache präsentieren sich als zugig gestaltete, pomadige Nachkriegsrelikte ohne jeglichen Charme. Dabei könnte gerade die zubetonierte Hauptwache mit relativ einfachen Mitteln aufgewertet werden. 1938 hievten die Nazis das Schillerdenkmal von seinem Platz neben der Hauptwache zum Rathenauplatz. 1955 musste es noch einmal umziehen, zu seinem jetzigen Standort in der Taunusanlage. An der Hauptwache könnte eine schöne Platzanlage mit dem Schillerdenkmal entstehen und damit der Stadtraum enorm aufgewertet werden.
Bei den Straßen und Plätzen muss auf eine harmonische und nachhaltige Gestaltung im öffentlichen Raum Wert gelegt werden – nur so schafft man ausgeglichene Orte an denen sich die Menschen wohl fühlen. Für ein stimmiges Gesamtbild muss z. B. auf eine einheitliche Pflasterung geachtet werden. Exotische Pflastersteine fallen oftmals nach einer Zeit aus dem Programm der Natursteinproduzenten und können bei Schäden nicht nachgeordert werden. Nach einigen Jahren hat man dann auf den vormals modisch gepflasterten Straßen und Plätzen einen Flickenteppich aus verschiedenen Steinen und Bodenplatten. An diesem Beispiel sieht man, dass bei der Stadtgestaltung langfristig und nachhaltig geplant werden muss. Straßen müssen zudem besser auf alle Verkehrsteilnehmer zugeschnitten werden. Oftmals sind die Bürgersteige zu schmal, sind nicht mit Bäumen beschattet und die Autoflächen nehmen zu viel Raum ein. Und noch etwas ist bei den Verkehrsflächen wichtig: Radfahrer und Fußgänger brauchen für mehr Sicherheit eigene, vom Autoverkehr baulich getrennte Wegflächen.
Häuser für die Menschen bauen
Insbesondere bei Neubauquartieren sieht man eine immer größer werdende Durchmischung von öffentlichen und privaten Zonen. Oftmals fehlen abgetrennte, schützende Vorgartenzonen mit Hecken und Zäunen, so dass Fußgänger quasi mit einem Fuß im Wohnzimmer stehen. Es scheint so, als ob bei dieser Stadtgestaltung oftmals nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Viele neue Bauten sind nicht an den nachhaltigen Bedürfnissen der Bewohner orientiert, sondern an den schnelllebigen Wünschen der Investoren und Stararchitekten. Und so werden immer neue, für sich stehende Bürohäuser und monotone Wohnsiedlungen gebaut, die nach wenigen Jahren schon wieder ausgedient haben. Unweit der Frankfurter Messe wurde z. B. noch vor wenigen Jahren das triste Europaviertel eingeweiht, das mit seiner reißbrettartig gestalteten Klötzchenarchitektur städtebaulich nicht überzeugen konnte. Das Neubauviertel wirkt mit seinen steril und uniform wirkenden Neubauten kalt, leblos und abweisend. Außerdem sind viele Erdgeschosse mit Wohnungen statt mit Läden und Gastronomie belegt. Statt ein lebhaftes Quartier, finden wir im Europaviertel vor allem eine uniform gestaltete Schlafstadt.
Die gründerzeitliche Architektur einbinden
Das Gegenteil einer monotonen Schlafstadt, ist in den von Bauten aus der Gründerzeit geprägten Frankfurter Stadteilen Sachsenhausen, Bornheim, dem Nordend und dem Bahnhofsviertel zu finden. Es sind die lebhaftesten Stadtteile mit vielen kleinen, inhabergeführten Geschäften und einem großen Angebot an Restaurants, Bars und Cafes. Auch in anderen, stark zerstörten Städten in Deutschland wie Mannheim oder Magdeburg, spielt sich das urbane Leben in den verbliebenen Altbau- und Gründerzeitvierteln ab. Bezeichnenderweise findet oftmals in diesen begehrten Vierteln die Gentrifizierung statt und nicht in stylischen Neubauvierteln.
In der Nachkriegszeit war die Wertschätzung für die gründerzeitlichen Quartiere miserabel. Die überwiegend unsanierten Altbauten hatten teilweise noch Ofenheizung und Gemeinschaftstoiletten. Erst die 68er-Studentengeneration entdeckte wieder die Vorzüge der Altbauwohnungen in den innerstädtischen Vierteln. Hier war Platz genug für alternative Wohnformen, für kommunikative Kommunen und kreative WGs. In anonymen Trabantenwohnhäusern an den Stadträndern hätte sich wahrscheinlich keine Studentenrevolte gebildet. In den siebziger und achtziger Jahren wurden viele Gründerzeitviertel zu Sanierungsgebieten erklärt. Die ertüchtigten Gebäude wurden für alle Bevölkerungsschichten wieder attraktiver. Der gründerzeitliche Altbau hat mittlerweile alle Moden überstanden und ist bei alternativen Studenten genauso beliebt, wie bei der gut situierten Bürgerschaft. Bei diesen Bauten wurde nicht zwischen Funktionalität und Schönheit unterschieden. Die Bauten waren – im Gegensatz zu den Häusern der Nachkriegsarchitektur – nicht nur funktional, sondern auch schön gestaltet. Auch die Mischung ist in den Gründerzeitbauvierteln so vielfältig wie nirgendwo in den Städten: Ob als Studenten-WG, Rechtsanwaltsbüro oder Behausung für StartUps – die über hunderte Jahre alten Bauten eignen sich durch ihre hohe räumliche Flexibilität und langlebige Ausstattung für jegliche Nutzung. Selbst einige der modernen Formensprache verschriebene Architekten, haben ihren Arbeitstisch unter einer Stuckdecke eingerichtet.
Immer noch verbinden einige Modernisten die Gründerzeitviertel mit der oft düsteren Epoche der Kaiserzeit. Kein Bewohner eines Altbaus aus der Gründerzeit – ob linksalternativ oder konservativ eingestellt – wohnt darin, weil er sich den Kaiser zurückwünscht. Es ist schon erstaunlich, wie man z. B. den Rekonstruktionsbefürwortern des Alten Schauspielhauses in Frankfurt am Main in der Standortdiskussion unterstellte, sie würden mit dem prächtigen Opernbau sich auch die Kaiserzeit zurückwünschen. Diese Bürger sehnen sich nicht nach Kaiser Wilhelm und dem preußischen „Pickelhaubenmilitarismus“, sondern möchten ein schönes, repräsentatives Opernhaus im Stadtbild zurückgewinnen. In ganz Europa werden mit einer hohen Selbstverständlichkeit, historische Opernhäuser aus der Gründerzeit bespielt. Diese sind technisch anpassbar, so dass hinter der historischen Fassade mit modernster Technik gearbeitet wird. Spannend wäre es, wenn ein neues Opernhaus, entgegen der Planungen, doch am Osthafen gebaut werden würde. Ein progressives Opernhaus mit der charmanten Lage am Main würde für eine große Außenwirkung sorgen. Gleichzeitig könnte man das avantgardistische Alte Schauspielhaus am Willy-Brandt-Platz rekonstruieren und wieder als attraktives Schauspielhaus nutzen. Eine behutsame Offenlegung der noch vorhandenen historischen Jugendstilfassade würde weltweit für eine große Aufmerksamkeit sorgen und die Stadt immens aufwerten. Im Übrigen: Hätte man in den sechziger Jahren nicht das Gebäude brutal verstümmelt, dann würde heute keiner das Alte Schauspielhaus zur Disposition stellen. Es würde mit demselben Stolz als Spielstätte genutzt werden wie andere, historische Schauspielhäuser in der ganzen Welt.
Auch ein festes Musicalgebäude oder Filmfestspielhaus würde der Stadt guttun. Hier bietet sich die Rekonstruktion des grandiosen Schumannbaus gegenüber dem Hauptbahnhof an. Der ikonenhafte Jugendstilbau hätte mit seiner grandiosen Optik ein touristisches Alleinstellungsmerkmal allererster Güte. Ein weiterer geschichtsträchtiger Bau, der unbedingt wieder aufgebaut werden sollte, ist die spätklassizistische Alte Börse – der erste feste Börsenbau von 1843 in Frankfurt. Die teilerhaltene Ruine wurde 1952 unnötigerweise abgerissen. Eine wieder aufgebaute Alte Börse wäre der geeignete Ort, um dort ein repräsentatives Demokratiezentrum für die nahegelegene Paulskirche unterzubringen. Der Standort wäre direkt am belebten Laufweg zwischen dem Geschäftszentrum mit der Zeil und dem Römer mit der Altstadt. So könnte man viele Bürger und Touristen mit dem Thema Demokratie abholen und die ereignisreiche Geschichte der Paulskirche in einem geschichtsverbundenen Besucherzentrum darstellen.
Stätten für Sport, Kultur und Design schaffen
Neben der Weiterentwicklung von Kulturbauten muss auch die Entwicklung von Event- und Sportstätten im Auge behalten werden. Die Schließung der traditionsreichen Galopprennbahn war sicherlich ein Fehler. Ein integrativer Meltingpoint wurde mit dem Hafenpark geschaffen. Was auf jeden Fall als pulsierende Metropole fehlt ist eine große Multifunktionshalle für große Sport- und Musikveranstaltungen. Wenn stationäre Messen in der Post-Corona-Zeit schrumpfen bzw. zukünftig weniger Platz brauchen, könnte die Multifunktionshalle vielleicht auf dem großflächigen und gut angebundenen Messegelände entstehen.
Weltweit laden die Metropolen, als Motor für die Stadtentwicklung, ihre Quartiere mit Design- und Kunsteinrichtungen auf. Dagegen machen die Stadtplaner in Frankfurt immer wieder den Fehler, nicht mehr genutzte Industriehallen und Kulturstätten rigoros für neue Businessviertel abzureißen. Das ist nicht nachvollziehbar, denn nur wo Kultur blüht, siedeln sich Kreative mit ihren innovativen Unternehmen an. Frankfurt braucht einen zukunftsgerichteten Masterplan für die weitere Stadtentwicklung um sich weiterzuentwickeln. Die Bauwut steht dem ressourcensparenden, ökologisch ausgerichteten Zeitalter entgegen. Seit mehreren Jahrzehnten entstehen in freiwerdenden, innerstädtischen Immobilien und Arealen vor allem großvolumige Immobilienprojekte für den Büromarkt oder für gehobenes Wohnen. Das ist nicht nur eine eindimensionale Stadtpolitik, sondern passt auch nicht mehr in heutige Zeit. Ein gutes Beispiel ist das Alte Polizeipräsidium. Die über Jahre leerstehende Immobilie wäre, auf Grund ihrer perfekten Lage zwischen Hauptbahnhof und Messe, prädestiniert gewesen für eine kulturell-gemischte Nutzung als „House of Creativity“. So ein Ort wird von vielen Kreativverbänden immer wieder gefordert, um als Kulturschaffende gemeinsam mit Wirtschaft, Hochschulen und Start-ups interdisziplinär an der Zukunft des Wirtschaftsstandorts zu arbeiten. (71) Wäre im Alten Polizeipräsidium so ein Kreativhaus entstanden, so wäre es bestimmt auch ein guter Ort für kulturelle Festivals geworden. Vernetzt mit der Messe hätte man dann z. B. auch einen kreativen Meltingpoint für die nach Frankfurt umgezogene Fashion Week gehabt. Doch die Stadt hat bei dem Areal des Alten Polizeipräsidiums leider nicht zugriffen. Das Objekt wird nun von einem Projektentwickler einer neuen Nutzung, u.a. mit Büros und Wohnungen zugeführt.
New Urbanism als Zukunftsmodell
Zu Recht wird kritisiert, dass man auf der einen Seite mit größter Mühe und Sorgfalt, ohne Kosten zu scheuen, einen Teil der Frankfurter Altstadt wieder errichtet hat und auf der anderen Seite – ohne Rücksicht auf die historische Bausubstanz – Bürohochhäuser und Luxusappartements baut (72) und zudem Teile der Altstadtquartier Alt-Sachsenhausen und Höchst verfallen lässt. Auch andere Zeugnisse der Baukultur, wie das 2014 modern-überformte Senckenberg-Areal, wurden unzureichend vor einer grob-modernistischen Umgestaltung geschützt. Selbst Immobilien, die im städtischen Eigentum sind, werden oftmals vernachlässigt und nicht richtig gepflegt. Ein Beispiel ist das 300 Jahre alte Kulturdenkmal Oberforsthaus, in dem selbst Goethe im 19. Jahrhundert Gast war. Jahrzehntelang wurden die letzten Reste des früheren Ensembles auf unverantwortliche Weise dem Verfall preisgegeben. 2021 brannte bei dem ungeheuerlich verwahrlasten Baudenkmal der Dachstuhl ab. Es ist ganz klar: Frankfurt muss demütiger mit seinem Erbe umgehen und seine historischen Bauten in Zukunft besser schützen. Es müssen strenge Gestaltungsrichtlinien beschlossen werden und der Denkmalschutz tätig werden, um die Stadtquartiere in ihrer Besonderheit und Schönheit zu erhalten. Alles was in Zukunft gebaut wird, sollte sich den drei Grundprinzipien Nützlichkeit, Langlebigkeit und Schönheit unterordnen. Alles das sind Attribute, die auch in der Altstadt zu finden sind und das DomRömer-Projekt zu einer weltweit beachteten Erfolgsstory werden ließ.
Ein gutes Rezept für die weitere bauliche Zukunft bieten New Urbanism-Konzepte mit einer Hinwendung zum traditionellen Städtebau. Doch warum hat sich ausgerechnet in der heutigen, hochtechnologisierten Zeit der Spätmoderne eine New Urbanism-Bewegung mit einer Rückbesinnung auf die historische Stadt gebildet? Wir befinden uns gerade in einer unruhigen Übergangsphase an der Schwelle zum digitalisierten Zeitalter. Die einstigen Versprechungen der Moderne werden zunehmend in Frage gestellt. Die Technikgläubigkeit wurde nicht zuletzt durch die Fukushima-Atomreaktorkatastrophe und die teilweise hilflos geführte Bekämpfung der weltweiten Covid-19-Pandemie erschüttert. Zudem hat sich der bedrohliche Klimawandel enorm beschleunigt. Fossile Brennstoffe und die Atomkraft sind aus ökologischer Sicht nicht mehr zukunftsfähig. Eine Umbruchphase der Veränderung mit einem gesellschaftlichen Modernisierungsprozess ist im vollen Gange. Wir erleben gerade deshalb einen enormen Umbruch der Wirtschaft, der Bildung, der Medien uvm. Auch die Städte sind in einer Umbruchphase, wie wir es zuletzt nach dem Ende des letzten Weltkrieges erlebt haben. In einer Zeit der Unruhe und Veränderung suchen Menschen verlässliche Konstanten wie die Familie und einen vertrauten Lebensort, denn auf fluide Moden kann man sich nicht verlassen. Die Hinwendung zur alten Stadt verleiht nicht nur Geborgenheit und Sicherheit, sondern bietet auch einen sicheren Weg in die Zukunft.
Die nach dem Krieg etablierte moderne Stadtplanung mit ihren eindimensionalen Schwerpunkten auf den autozentrierten Individualverkehr und schnelllebiger Investorenarchitektur ist größtenteils gescheitert. Die mischgenutzte, dichte Stadt zeigt sich dagegen resilient und flexibel, um die Umbruchphase hin zu einer diversen, nachhaltigen Stadt vorausschauend zu bestehen. New Urbanism-Projekte stehen für eine menschengerechte Architektur, die dem landschaftsfressenden Siedlungsbrei ausufernder Vorstädte entgegentritt. Durch die Planung fußgängerfreundlicher Wegenetze und die Förderung lokaler Produktion wird zudem in das Thema Nachhaltigkeit eingezahlt. Es ist also mehr als nachvollziehbar, dass viele Elemente des New Urbanism weltweit Einzug in der zeitgenössischen Stadtplanung gefunden haben.
7.2 Wohnungs- und Gewerbeflächenmangel
Städte sind die neuen Staaten. Einige Städte können es von ihrer Wirtschaftskraft her, sogar mit den Volkswirtschaften von souveränen Staaten aufnehmen. München hat z. B. 2021 ein eigenes Klimapaket mit einem Millionenvolumen geschnürt. Schon in Frühzeiten agierten historische Stadtstaaten wie Venedig und Florenz wie Republiken. Autonom handelnd und vernetzt in der Welt setzen auch die heutigen Metropolen ihre gemeinsamen, sozialpolitische Ziele um. Bei Themen wie Klimaschutz und Förderung der E-Mobilität oder wie zuletzt bei der Pandemiebekämpfung sind die Städte voran gegangen und haben ihre eigene Agenda durchgesetzt. Frankfurt am Main ist zwar nicht in der Liga der großen Megacities der Welt, hat aber auch immer wieder eigene Akzente gesetzt, die weit über die eigene Region herausragten. Während auf der einen Seite Frankfurt mit seiner Vielfalt als zukunftsweisendes „Labor für andere Städte“ dienen kann, bleiben andere Herausforderungen weiterhin noch ungelöst. Insbesondere der teure Wohnraum ist mittlerweile zur Hauptsorge der meisten Stadtbewohner geworden.
Im Zeichen der Gentrifizierung: Unbezahlbarer Wohnraum
Gebaut wird in Frankfurt viel – doch wenn, dann insbesondere für wohlhabende Bevölkerungsschichten. Der Trend geht dabei u.a. hin zu hybriden Hochhäusern mit einem Büro- und Wohnanteil und zu reinen Wohnhochhäusern. Doch diese Bauten werden bisher vor allem nur im Luxussegment etabliert. In diesen weitgehend abgeschirmten Hochhaus-Communitys ist zumeist keine „Stadt für alle Schichten“ zu finden. Viele der Luxuswohnungen stehen dauerhaft leer, weil sie nur als globales Anlageobjekt erworben wurden. Auch bei Mietwohnungen geht der Trend in Richtung Luxus. Aufwändig saniert werden diese zunehmend in hochpreisige Eigentumswohnungen umgewandelt. Die Gentrifizierung von ganzen Stadtquartieren, meistens attraktive Altbauviertel, gehört zu den größten Herausforderungen der Metropolen dieser Welt. Auch in Frankfurt gibt es solche Stadtteile, wie z. B. das Ostend, das durch den Zuzug der EZB für Investoren zunehmend attraktiver geworden ist und dementsprechend immer teurer und unbezahlbarer für die angestammten Bewohner wird. Insbesondere Alte, Kranke und sozial schwache Bewohner bleiben bei diesen Quartiersumformungen auf der Strecke.
Investoren in der Stadt sind zunehmend global tätige, juristische Personen aus der Immobilien- und Finanzbranche, oftmals ohne jeglichen Bezug zu den lokalen Gegebenheiten. Die Rendite steht im Mittelpunkt des schnelllebigen, kommerziellen Bauens mit allen Nachteilen für die angestammten Stadtbewohner: hohe Flächenausnutzung, spekulativer Leerstand und gated Areas. Es gibt immer mehr abweisende, nichtöfftentliche „Unorte“ in der Stadt, mit eigenen, kommerziellen Regeln: Willkommen sind dort nur Konsumenten und Arbeitskräfte, die dort tätig sind. Der Druck der Investoren auf die Stadt bleibt groß. Hier müsste mit Erhaltungssatzungen der gewachsene Wohnraum und der lokale Einzelhandel sowie die traditionelle Gastronomie besser geschützt werden. Des Weiteren geht das soziale Bauen in Deutschland zurück. Die Stadt Frankfurt versucht mit Quoten für geförderte Wohnungen eine bessere soziale Mischung zu erreichen. Dringend benötigter Wohnraum könnte eventuell durch nicht mehr benötigte Büroflächen hinzukommen. Die zunehmende Digitalisierung lässt immer mehr Arbeitnehmer von zu Hause arbeiten, so dass immer weniger Flächen für die Dienstleistungsgesellschaft gebraucht werden.
Ohne Zukunft? Gewerbe in der Stadt
Es ist ein großer Spagat für die Städte: Auf der einen Seite werden die knappen Flächen in der Stadt für dringend benötigten Wohnraum gebraucht und auf der anderen Seite stehen Gewerbetreibende in der Warteschlange, um verzweifelt weitere Flächen für ihren Betrieb zu finden. Das Problem ist, dass die Städte auf die Gewerbesteuern angewiesen sind, um ihren Haushalt zu finanzieren. In Frankfurt wird immer wieder über eine mögliche Wohnnutzung des attraktiven Osthafens diskutiert. Vielleicht liegt die Lösung darin, wo Lärm und Schmutz nicht im Wege stehen, noch mehr nutzgemischte Gebiete zu entwickeln. In diesen Gebieten werden zukünftig auch zunehmend ökologische Industrien in die Städte einziehen. Lokal, vor Ort entwickelte und produzierte Produkte werden vielfach die ökologisch fragwürdigen, weiten Lieferwege der globalen Wirtschaft ersetzen. Im Moment ist eine sehr einseitige Ansiedlung von Rechenzentren zu beobachten. Frankfurt gehört als Internetknoten zur Spitze der globalen Digitalwelt. Doch die Rechenzentren müssen zukünftig noch nachhaltiger werden, denn sie gehören zu den größten Energieverbrauchern in der Stadt. Die meisten Rechenzentren beziehen bereits Ökostrom, doch auch die Fassaden und Dächer der riesigen Bauten müssen noch konsequenter begrünt werden und die Abwärme besser genutzt werden.
Da in Frankfurt immer weniger Gewerbeflächen zur Verfügung stehen, rücken andere Umsatzbringer wie Messen und Kongresse in den Fokus. Bisher zog die Stadt viele Messen alleine wegen der großen Messehallenkapazität an. Doch immer mehr Messen werden parallel Online veranstaltet, so dass die großen Messegelände nicht mehr nur ausschlaggebend für die Entscheidung der Messeveranstalter sind. Außerdem sind auch in den letzten Jahren immer mehr Messeflächen in China entstanden, so dass der wachsende asiatische Markt seine eigenen Messen durchführen kann. Frankfurt muss daher zukünftig mit „weichen Faktoren“ punkten, um den Zuschlag für weltweite Messen zu erhalten. Es müsste ein ureigenes Interesse der Messebetreiber, aber auch des Flughafenbetreibers sein, dass die Attraktivität von Frankfurt als Stadt gesteigert wird. Städte mit einem hässlichen Stadtbild werden gemieden, denn dafür gibt es genug attraktive Konkurrenz unter den weltweiten Städten. Frankfurt muss also ein gutes Entree, sowie eine architektonisch reizvolle und lebhafte Innenstadt bieten, um die Messegäste anzulocken. Eine schöne Stadt ist nicht nur Selbstzweck, sondern ein entscheidender Punkt für den zukünftigen Erfolg von Frankfurt als erfolgreiche Messe- und Kongressstadt.
7.3 Die Bauwende
Gebäude gehören zu den größten Klimasündern und machen einen großen Anteil am globalen CO2-Ausstoß aus. Sowohl der Bau, der Flächenfraß, aber auch der Betrieb durch Heizen, Warmwasser, Strom und Klimaanlagen schaden der Umwelt. Darüber hinaus hat die Baubranche einen hohen Ressourcenverbrauch: Es werden nicht nur Millionen Tonnen von mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Gipssteins sowie Kies und Sand verbaut, sondern es fallen auch Millionen Tonnen von Abfällen ab, die größtenteils nicht recycelt werden. Die Bauabfälle durch Bodenaushub und Bauschutt machen mehr als die Hälfte des deutschen Müllaufkommens aus. Durch renditeorientiertes Bauen wird zudem immer schneller gebaut und abgerissen. Jedes Gebäude ist ein Klimafresser: Es müssen nicht nur einzelne Baustoffe wie Beton und Stahl hergestellt werden, sondern auch Materialien und Maschinen und auch der Transport zu den Baustellen verbraucht viel Energie. Es gibt viele Lösungsvorschläge: Eine Möglichkeit Ressourcen zu sparen wäre z. B. Urban Mining. Damit ist gemeint, dass Rohstoffe aus bereits bestehenden Gebäuden wieder verwertet werden. Beispielsweise könnten die Steine eines alten Hauses für den Bau eines neuen dienen. Findet das Ganze an Ort und Stelle statt, ist das sehr ressourcenschonend, denn auch die energiefressenden Transportwege fallen weg.
Alles was zum Bau eines Hauses beiträgt wird als „graue Energie“ bezeichnet. Wenn man die gesteckten Klimaziele erreichen möchte, muss also zukünftig nachhaltiger gebaut werden und zudem weniger abgerissen werden. Selbst der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten will weg vom Abriss und Neubau von Gebäuden. Die Frankfurter Gruppe stellte im Mai 2021 ein Forderungskatalog an die Stadtregierung und wirbt dafür, Gebäude zu sanieren, statt abzureißen. Sie wirbt zudem dafür, mit einer hohen Dichte zu bauen und neue öffentliche Frei- und Grünräume zu entwickeln. (73) Das Bauen wird in Zukunft auf jeden Fall grüner werden: Es gibt schon Wohntürme in Holzbauweise und bepflanzte Hochhäuserfassaden, die mehr Nachhaltigkeit versprechen. Es wird mehr Klinker, Holz und Lehm statt Stahl und Glas geben. Doch bei der alternativen Verwendung von Materialien, wird man auch die weitere Entwicklung bei den Rohstoffpreisen ins Auge nehmen müssen: 2021 gab es z. B. einen extremen Baustoffmangel und enorme Preissteigerungen bei Holz. Die Wälder mit ihrem Holz sind zudem als Energiespeicher sehr wertvoll.
Ein wichtiges Thema ist auch die Bodenversiegelung durch Gebäude und Außenanlagen. In Frankfurt wurde deshalb eine Gestaltungssatzung für Freiraum- und Klima auf den Weg gebracht. Damit will die Stadt auch der zunehmenden Versiegelung von privaten Grundstücken – insbesondere durch so genannte Schottergärten – Einhalt gebieten. Geeignete Dachflächen und Teile der Fassade sollen zukünftig begrünt werden. Bei oberirdischen Stellplätzen soll für eine ausreichende Verschattung gesorgt werden. Dächer von Carports, Garagen und Nebenbauten sind nach der Satzung mit einer Vegetationstragschicht zuzüglich einer Filter- und Drainageschicht zu begrünen. Eine Kombination mit Solaranlagen, insbesondere Photovoltaik ist zulässig, wenn die Funktion der Dachbegrünung nicht beeinträchtigt wird. Auch Fassaden bei Neu- und Umbauten müssten nach der Satzung dann in der Regel teilweise begrünt werden. (74) Neben der Begrünung müssen Bauten natürlich auch z. B. mit Wärmedämmverbundsystemen gut isoliert sein, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch lassen sich Heizkosten einsparen und damit auch Emissionen. Dämmen ist ein wichtiger Faktor, um den CO2-Ausstoß von Gebäuden zu verringern. Aber um die Systeme kosteneffizient umzusetzen, werden zur Dämmung oft Materialien eingesetzt, die sowohl bei der Herstellung als auch beim Recycling aus ökologischer Sicht oftmals problematisch sind. Dämmen sollte dementsprechend kein Selbstzweck sein, sondern immer einer ökologisch sinnvollen Gesamtbilanz folgen.
Nicht zuletzt können die Städte z. B. integrative Wohnprojekte in den Förderrichtlinien verankern und ihre Wohnungsgesellschaften dazu bringen, dass sie sich verstärkt neuen Wohnmodellen widmen. Grundstücke sollten von der Stadt nicht grundsätzlich zum Höchstpreis veräußert werden, sondern an den gehen, der das beste Konzept vorlegt. Mieten und Gewerbeflächen in den Städten müssen bezahlbar bleiben. Hier bietet es sich an, auch vermehrt genossenschaftliches Wohnen zu fördern. Ein gutes Beispiel, um Wohnraum zu sparen, sind Wohnungstauschbörsen. Sie könnten dabei helfen, dass Menschen, die allein in großen Wohnungen leben, kleinere Apartments finden. Auch das bundesweite Projekt „Wohnen für Hilfe“ bietet einen guten Beitrag, um Wohnraummangel zu beseitigen. Die Idee: Ältere, hilfsbedürftige Menschen mit großen Wohnungen vermieten Wohnraum für wenig oder gar kein Geld an Studierende oder Auszubildende, die dafür als Gegenleistung die Älteren im Alltag z. B. im Haushalt, beim Einkaufen und im Garten unterstützen.
7.4 Die Verkehrswende
Neben einer klimagerechten, ökologisch und sozial nachhaltigen Bauweise, wird im Rahmen des Transformationsprozesses der Städte der Verkehrsraum umgebaut werden. Insbesondere eine autoarme Innenstadt soll erreicht werden – darin sind sich die meisten Verkehrspolitiker, Umweltverbände und Stadtvertreter einig. Die stauverstopften Straßen und die schlechte Luft durch Schadstoffbelastungen haben die Blechkisten als maßgebliche CO2-Schleuder in Verruf gebracht. Die Autos nehmen zudem öffentlichen Raum weg und gefährden Fußgänger und Radfahrer. Besonders der Autoverkehr in den Innenstädten mit seinen Staub- und Lärmemissionen steht schon länger im Fokus der Stadtplaner. Noch vor einigen Jahren ging es in erster Linie darum, einen Verkehrsinfarkt und die Parkplatznot zu verhindern. Städte wie London, Stockholm und Mailand führten deshalb die City-Maut ein, um die Staus in den verkehrsverstopften Innenstädten einzudämmen. Doch heute geht es nicht mehr darum, dass die Autos in den Städten über genug Platz zum Rollen und parken verfügen, sondern dass Fußgänger und Radfahrer mehr vom Stadtraum erhalten.
Mit einer Verkehrswende – weg von autozentrierten Verkehrsräumen, hin zu einem fußgänger- und radfahrerfreundlichen Umfeld –, sollen die Städte umweltfreundlicher gestaltet werden. Damit steht ein Paradigmenwechsel von der autogerechten zur menschengerechten Stadt an. Nach dem Weltkrieg propagierten die Stadtplaner noch getrennte Funktionsräume und planten breite Verkehrsschneisen durch die Städte. Die weiten Wege zur Arbeit und zum Einkaufen sollten vor allem mit dem eigenen PKW überwunden werden. Damals war auch noch der Kraftstoff günstig und niemand machte sich über die hohe Schadstoffbelastung der Fahrzeuge Gedanken. Heute haben die als „Klimakiller“ verschrienen Autos – zumindest in den Innenstädten – keine große Zukunft mehr. Doch auch die aufkommenden Elektromobile werden wohl nicht die Städte zurückerobern. Der Platz ist in den Städten rar geworden und genau von diesem kostbaren Platz verbrauchen die zahlreichen Kraftfahrzeuge viel zu viel.
In den Städten war es schon immer eng. Im 19. Jahrhundert verstopften noch Kutschen und Pferdefuhrwerke die Straßen, bevor dann im 20. Jahrhundert das Auto die Welt eroberte. Doch bereits sehr früh gab es neben dem Individualverkehr auch einen öffentlichen Nahverkehr, so dass bald neben den Automobilen auch Busse und Straßenbahnen in den Städten verkehrten. Doch die schon zitierte „autogerechte Stadt“ der Nachkriegsplaner hob den Individualverkehr auf eine neue Stufe, so dass z. B. in den fünfziger und sechziger Jahren zahlreiche Straßenbahnen abgeschafft wurden. Mittlerweile haben einige Städte wieder die Straßenbahnen zurück ins Stadtbild geholt. Der ÖPNV ist und bleibt einer der wichtigsten Bausteine, um Menschen umweltgerecht von A nach B zu bringen. Im letzten Jahrzehnt hat sich durch den digitalen Wandel und durch die Entwicklung alternativer Antriebe eine weitere Kategorie an Fortbewegungsmitteln etabliert, die sich mit dem Begriff „Mikromobilität“ recht gut umschreiben lässt. Gemeint sind Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Bikes und E-Scooter, die zum Beispiel mit Hilfe von einer App entliehen werden können, um zumeist kurze Strecken in der Stadt zu überwinden. Doch die ökologische Sinnhaftigkeit dieser Kleinstfahrzeuge ist nicht immer gegeben. Doch weder ein gut ausgebauter ÖPNV, noch neue, innovative Fahrzeugangebote haben bisher die Autos aus den Städten verdrängt. Zwar gibt es in den meisten Städten schon große Zonen in den Autos tabu sind – doch dort wo gewohnt wird, befinden sich in der Regel in der näheren Umgebung auch Verkehrswege und Abstellflächen für Autos. Und noch etwas verhält sich konträr zu allen Bestrebungen eine Verkehrswende herbeizuführen: Der Fahrzeugbestand in Deutschland und besonders auch im Rhein-Main-Gebiet, steigt immer noch kontinuierlich an. (75)
Verkehrsberuhigung und -rückbau
Wie können die Städte die Automassen und die Emissionen wirksam reduzieren? Ein bewährtes Mittel sind verkehrsberuhigende Maßnahmen. In verkehrsberuhigten Straßen mit Tempo 30-Zonen reduziert sich der Spritverbrauch und die Abgasemission sowie der Autolärm. Zudem reduziert sich die Gefahr für Kinder, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer, Opfer eines schweren Verkehrsunfalls zu werden. Spanien hat z. B. bereits 2021 flächendeckend Tempo-30 in den Städten eingeführt. Auch in Frankreich und in vielen anderen Ländern Europas haben schon viele Städte auf Tempo 30 umgeschaltet. Schnell fahrende Autos brauchen mehr Platz als langsam fahrende Autos. Durch Verkehrsberuhigung können Flächen für Schnellstraßen eingespart werden. Zudem sorgt ein langsam fließender Verkehr auch für mehr Lebendigkeit in der Stadt.
Nach und nach werden in vielen Städten die raumgreifenden Verkehrsflächen der autogerechten Stadt zurechtgestutzt: Überbreite, autobahnartige Schneisen in den Stadtzentren werden zurückgebaut und die Flächen für Fußgänger und Radfahrer erhöht. Doch die Verkehrsplanung in Frankfurt fußt teilweise noch auf Konzepten, wie aus Großvaters städtebaulicher Mottenkiste. So werden Altstadt und Innenstadt immer noch von der Berliner Straße, dem brachialen Straßendurchbruch der autogerechten Stadt, getrennt. Hier muss dringend eine Lösung gefunden werden, um diese trennende Verkehrsschneise zurückzubauen und zudem die Flächen für Fußgänger und Radfahrer zu erweitern. Andere Städte sind da schon viel weiter: Düsseldorf hat seine Nachkriegs-Trasse Berliner Allee bereits umgebaut und somit wieder eine in sich geschlossene Innenstadt zurückgewonnen. Auch Stuttgart hat schon konkrete Pläne, um die Innenstadtschneise B14 zurückzubauen und einen neuen, verbindenden Stadtraum zu erhalten. Und in Karlsruhe wird die autobahnähnliche Kriegsstraße zu einem innerstädtischen Boulevard umgebaut. Einen interessanten Weg zur Verkehrsberuhigung hat Barcelona eingeschlagen: Dort hat man jeweils neun Straßenblöcke zu Superilles, katalanisch für „Superinseln“ zusammengefügt. Mit Sitzmöbeln, Spielgeräten und Gemeinschaftsgärten wurden dabei die Kreuzungen stillgelegt und die Straßenblöcke verkehrsberuhigt und vor Durchgangsverkehr geschützt. In vielen Städten der Welt wurden Stadtmöbel, so genannte „Parklets“, auf ehemaligen Parkplatzflächen gestellt, um die nachbarschaftliche Aufenthaltsqualität zu erhöhen.
Viele Verbesserungen im Verkehr wurden in den letzten Jahren schon in den deutschen Städten ungesetzt. In den meisten Städten dürfen z. B. LKWs nicht mehr ohne Weiteres durch die Innenstadt durchfahren. Mancherorts werden auch Straßen komplett für den gesamten Autoverkehr gesperrt. In Frankfurt hat die Sperrung der Hauptwache für den motorisierten Verkehr zu keinen Problemen geführt. Manchmal, wie bei der Mainkaisperrung, scheitert jedoch eine autofreie Zone. Hier hatte sich der Verkehr auf die Sachsenhäuser Mainseite verlagert und dort für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Auf der anderen Seite gibt es Vorschläge, zur Belebung der Innenstädte, die Autos sogar wieder in Einkaufsstraßen zurückzuholen. Die reinen Fußgängerzonen, bei der die Innenstädte nach Ladenschluss verwaisen, sind zum Teil nicht mehr zukunftsfähig. So wäre es denkbar die Zeil nach Geschäftsschluss als verkehrsberuhigte Einbahnstraße für Taxis, Busse und Radfahrer zu öffnen und so die abendliche Frequenz und Sicherheit in der nach Geschäftsschluss verlassenen Einkaufsstraße zu erhöhen. Der Architekt Christoph Mäckler hat bereits einige Ideen zur Belebung der Zeil hervorgebracht: Er möchte, dass dort Straßenbahnen, Fahrräder und Autos fahren. (76)
Pendler- und Besuchsströme steuern
Ein Auto in der Stadt? Für viele Stadtbewohner lohnt sich das nicht mehr. Mit dem Rad und mit dem öffentlichen Nahverkehr lässt sich zumeist die Strecke zum Stadtzentrum praktischer überwinden. Mit attraktiven Angeboten wie 1 Euro/Tag-ÖPNV-Tickets, gut ausgebauten Radwegen und Carsharing-Möglichkeiten wird das eigene Auto immer unwichtiger. Doch noch wird ein großer Teil des öffentlichen Raums durch Parkflächen belegt. Wer als Anwohner in seinem Quartier einen freien Parkplatz gefunden hat, der fährt oftmals nicht wieder weg, weil er Angst hat den Parkplatz zu verlieren. Die Autos stehen somit manchmal eine ganze Woche unbewegt auf der Parkfläche und werden eigentlich gar nicht genutzt. Viele Autos in der Stadt stammen allerdings von Pendlern. 384.000 Menschen bzw. 64 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt hatten 2020 ihren Arbeitsplatz in Frankfurt am Main, wohnten aber außerhalb der Stadt. Der ÖPNV muss also noch viel besser ausgebaut werden. Mit einer Verknappung und Verteuerung von Autoparkflächen könnte man zumindest einige spontane Stadtbesucher zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen. Grundsätzlich sollte zwischen notwendigen und beliebigen Autoverkehr unterschieden werden. So sollte es z. B. Ausnahmen für Handwerker geben, die mit Gewerbeparkausweisen ausgestattet werden könnten. Darüber hinaus lässt sich durch eine intelligente, digitalisierte Verkehrssteuerung der Verkehr so steuern, dass er relativ gut fließt und Parkplatzsucher ohne Umwege zu einem freien Parkplatz geleitet werden. Das würde den Verkehr erheblich reduzieren, denn ein Großteil des heutigen Verkehrs entsteht durch die Suche nach einem freien Parkplatz. In der Zukunft werden Einwohner und Besucher, per App-Buchung, vielleicht auch von emissionsarmen, selbstfahrenden „Robotertaxis“ eingesammelt und zu ihrem Zielort in der Innenstadt gebracht.
Die Innenstädte werden auch zukünftig Verkehrsknoten bleiben, doch es sind intelligente Lösungen für die Zukunft der Städte gefragt. Neben Busbahnhöfen und Straßenbahnhaltestellen werden z. B. auch Flugtaxi-Hubs in die Städte einziehen und Mobilitätsstationen für die wachsende Mikromobilität mit Fahrradabstellanlage, Rad- und Lastenradverleih, Car-Sharingstation und E-Bus-Shuttle die Verkehrsknoten bereichern. Es müssen auf jeden Fall verstärkt Verkehrslösungen für die vielen Pendler in die Innenstädte gefunden werden. Die meisten Städte bilden zudem ein wichtiges Zentrum für die Versorgung des Umlands. Selbst wenn man also alle Einwohner dazu bringen würde in das Stadtzentrum nur noch zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zu gelangen, so bleibt immer noch der Individualverkehr aus dem Umland bestehen. Mit einem gut ausgebauten, sichereren und preiswerten öffentlichen Nahverkehr in Verbindung mit intelligentem Park Ride-Angeboten am Stadtrand, lässt sich ein großer Teil des automobilzentrierten Individualverkehrs reduzieren. Mit elektrisch betriebenen Rufbussen können auch abgelegenere Orte in der Stadt erreicht werden. Der ÖPNV muss auf jeden Fall erheblich ausgebaut werden. In Frankfurt am Main wären zum Beispiel eine Weiterführung der Straßenbahn nach Offenbach und eine Schnellbahnlinie nach Wiesbaden empfehlenswert. Denkbar ist auch, dass der Main mit neuen, wassertauglichen Verkehrsmitteln erschlossen wird.
Das Verkehrsmittel der Zeit ist allerdings das Rad. Doch eine einseitige Priorisierung des Radverkehrs zu Lasten des Fußgängerbereiche führt nicht zum gewünschten Erfolg. Mit Radschnellwegen mitten durch belebte Fußgängerbereiche entsteht eine große Gefahr. Auf Strecken, die von Radfahrern frequentiert werden, muss zudem genauso auf Tempolimits und Regeln gepocht werden wie beim Autoverkehr, denn schon heute konkurrieren langsame Räder mit schnellen E-Bikes. Viele Städte sind mittlerweile zu Radikallösungen übergegangen und haben ihre City komplett für Autos gesperrt oder lassen nur noch Anwohner mit ihren Autos in die Innenstadt. Eine neue Entwicklung ist bei den Berufspendlern zu beobachten: Das in Coronazeiten erlernte Remote-Work, mit dem Arbeiten von zu Hause aus, reduziert immer mehr Wegzeiten zu den Arbeitsstätten.
Parkhäuser als Urban Hubs
Die Städte werden sich zukünftig weiter verändern. Der Platz für Autos wird in den Innenstädten kleiner und für den Individualverkehr größer werden. Aber es werden noch ganz andere, neue Stadträume entstehen, nämlich dann, wenn Parkhäuser und Parkflächen im Zeichen der Verkehrswende einer erweiterten oder neuen Nutzung zugeführt werden. Einige große Parkhausbetreiber sehen ihre Parkhäuser in der Zukunft als so genannte Urban Hubs. Die meisten Parkhäuser sind nicht ausgelastet und nur samstags voll. Die gute innerstädtische Lage macht daher einen Wandel zu multifunktionalen Urban Hubs attraktiv. Parkhäuser werden demnach zu Mobilitätsknotenpunkten mit Batterieladestationen für Mietwagen, -fahrrad und -roller und zum Start- und Landeplatz für neuartige Lufttaxis. Darüber hinaus bieten die Urban Hubs Logistikinseln und Mikrodepots mit Paket-Abholstationen und Umladestation für Paketdienstleister. Von hier aus können dann z. B. Pakete mit energiesparenden Elektro-Lastenfahrrädern und autonomen Lieferrobotern in der Stadt ausgeliefert werden.
Die großräumigen Flächen der Parkhäuser könnten zudem zukünftig als Miet-Lagerräume, Abholstationen und als Start- und Landeplatz für Frachtdrohnen dienen. In den Urban Hubs sind auch Drive-in-Waschsalons und Quartiersgaragen – die das Anwohnerparken auf der Straße ersetzen – vorstellbar. (77) Nicht zuletzt können Parkhäuser auch zum ökologischen Vorzeigebau werden: Solarzellen auf dem Dach liefern Strom für die Beleuchtung des Hauses und für das Aufladen der dort parkenden E-Mobile. Ein sensorgesteuerter Parkassistent weist den nächstgelegenen freien Platz zu und hilft, den Parkplatzsuchverkehr zu minimieren. Die Terrassen des Gebäudes sind in Zukunftsparkhäusern bepflanzt und mit Nistmöglichkeiten für Vögel ausgestattet. Ehemalige Parkflächen bieten zudem Platz für vertikale Stadtfarmen und moosbepflanzte Citytrees können sogar die Klimabilanz in einer Stadt verbessern. Doch insgesamt gesehen scheint die Zeit großer, innerstädtischer Parkplätze langsam abzulaufen. Auf den kostbaren Grundstücken entstehen zunehmend Wohnbauten für die wachsenden Städte. In Frankfurt ist bisher noch keine Weiterentwicklung in der Parkhauslandschaft zu erkennen. Ausgerechnet ein Parkhaus aus den 50iger Jahren, das Parkhaus Hauptwache, macht mit seinen Läden in der Erdgeschosszone vor, wie sich Parkhäuser in der Stadtlandschaft nützlich, lebendig und ästhetisch integrieren lassen.
7.5 Sterbende Innenstädte: Der Weg aus der Krise
Die Innenstädte haben eine wichtige Zentrumsfunktion, die durch den stark gewachsenen Online-Handel und durch die Auswirkungen der Corona-Krise stark in Mitleidenschaft geraten sindt. Doch was heißt überhaupt Zentrumsfunktion im Zusammenhang mit den Innenstädten? Die Zentrumsfunktion leitet sich aus verschieden Faktoren ab. So sind die innerstädtischen Zentren z. B. wichtige Verkehrsknoten. Hier sammeln sich die Bewohner und Besucher der Stadt, steigen aus und um, damit sie zu ihrem eigentlichen Ziel gelangen. Wartezeiten werden oftmals mit Erledigungen in der Innenstadt gefüllt. „Etwas zu erledigen“ habe viele Menschen in der City. Das städtische Zentrum ist auch ein Infrastrukturknoten: Hier findet man Ämter, Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, Post und Banken, den Friseur uvm. Darüber hinaus gehen viele ins Zentrum, um ihre Freizeit zu vertreiben, etwas zu erleben, zu kommunizieren oder zu konsumieren. Hier entstehen Begegnungen in Cafes, Restaurants und Bars und auf den Straßen und Plätzen. Viele gehen einfach auch nur zum Shoppen in die Innenstadt oder zum Lebensmittel einkaufen, z. B. auf dem Markt. In den Innenstädten finden sich zudem die meisten Kulturstätten wie Museen, Theater und Kinos. Nicht zuletzt steuern viele Menschen die Innenstädte aus beruflichen Gründen an, oder weil sich dort die Uni oder die Schule befindet. Bei dieser Aufzählung ist schnell zu sehen, dass trotzt einer Krise der Innenstadt, wohl viele Stadtfunktionen auch zukünftig nicht wegfallen oder ersetzt werden. Wer zum Arzt oder Friseur in die Innenstadt muss, der wird es auch zukünftig tun. Anders sieht es vor allem im Bereich Shopping aus: Hier ist ein Kaufhaus- und Modefilialsterben zu beobachten. Schon vor Corona hatten Onlineportale dem Handel zugesetzt. Der Umsatzschwund während der Pandemie hat für viele Läden den endgültigen Todesstoß gebracht. Großflächiger Einzelhandel wird zukünftig wohl durch kleinere, lokale Mischnutzungen mit einem erhöhten Wohnanteil ersetzt werden. Dabei könnten bezahlbare Mikroapartments in den Obergeschossen von Geschäftshäusern vermehrt auch junge Berufsanfänger und Studenten in die Citys holen und diese nachhaltig beleben. Aber auch Senioren sollte man mit seniorengerechten Wohnformen zurück in die Städte holen. Und nicht zuletzt sollten auch Kinder und Jugendliche von innenstadtgerechten Angeboten wie Fördereinrichtungen, Jugendclubs und Spielplätzen partizipieren.
Neue Nutzungsformen für Einzelhandelsflächen
Um zukünftig dem Innenstadtsterben, bzw. vor allem dem Ladensterben entgegenzuwirken, müssen neue Nutzungsformen und Besuchsanlässe geschaffen werden, um für eine hohe Frequenz in den Einkaufsstraßen zu sorgen. Nur mit einem konsequenten Stadtumbau kann neues Leben in den Stadtkernen entstehen. Um diesen Weg zu bestreiten muss als erstes die Monostruktur und Nutzungstrennung in den Städten aufgebrochen werden. Wenn die Innenstädte nur aus Laden- und Büroflächen bestehen und keinen Wohnanteil besitzen, dann veröden diese Quartiere schnell. Neben der Funktionsmischung (z. B. durch Erhöhung des Wohnanteils) und dem Verkehrsumbau ist die Kleinteiligkeit, der dritte wichtige Punkt, um die Städte zukunftsfähig zu machen. Die monströsen Kaufhäuser und überdimensionierten Ladenflächen der Filialisten sind unflexibel und verursachen in Krisenzeiten einen riesigen Leerstand in den Cities. Viele der großflächigen Monolithen werden wohl in Zukunft mit Shop-im-Shop-Konzepten einer neuen Nutzung zugeführt. Auch die erfolgsverwöhnten Einkaufscenter sind in einer Krise. Diese haben zwar durch einen Nutzungsmix versucht die lebendige Stadt nachzuahmen, doch durch die Zunahme überregionaler Ladenketten sind diese immer langweiliger und austauschbarer geworden. Aus den heutigen Shopping-Malls werden zukünftig z. B. individuelle Gebäude – unter einem gemeinsamen Dach. Filialisten hatten bisher in den Haupteinkaufsstraßen teilweise einen Anteil von bis zu 90 % der verfügbaren Ladenflächen. Wer kreativen, kleinteiligen, lokalen Handel stärken möchte, der muss zukünftig kleindimensionierte und bezahlbare Ladenflächen anbieten. Doch zukünftig nur auf kleinteiligen, lokalen Handel zu setzen, wird nicht reichen: Es müssen weitere, neue Nutzungsformen und Unterhaltungsangebote gefunden werden, z. B. Boulderhallen und E-Sport-Arenen, um die Innenstädte zu beleben. Um den Erlebnischarakter zu erhöhen muss insbesondere auch das gastronomische Angebot, z. B. mit trendigen Markthallen und Streetfood-Angeboten erhöht werden. Zudem werden wohl zukünftig auch Start-Ups und Onlinehändler vermehrt Showrooms in den Innenstädten installieren. Es wird Coworking- und Eventflächen für Workshops und Präsentationen geben und dort wo vorher Einzelhandelsketten waren, werden z. B. Fitnesscenter, Pop-Up-Stores, Fahrrad- und Bastelwerkstätten und Tauschbörsen einziehen. Kombinierte Orte, z. B. mit Barbier und Bike Service, werden viele frühere Einzelhandelsflächen zu kreativen, urbanen Melting Points transformieren. Auch Hotels und Boardinghouses und Service Apartments für Geschäftsleute, Senioren und Studenten werden zukünftig vermehrt in den Stadtzentren zu finden sein.
In der Innenstadt werden in neuartigen Shops auch Elektrogroßgeräte und Möbel von Kunden besichtigt und ausgewählt werden, die dann anschließend online bestellt werden. Eine Reihe von Möbelmärkten, sind bereits wieder in die Innenstädte gezogen. Es wird in Zukunft viele Zwischennutzungen für großteilige Ladenflächen und Warenhäuser in den Innenstädten geben. Auch mobile Lifestyle-Angebote, z. B. neue Anbieter von Elektroautos, werden zukünftig mit Showrooms und Erlebniscentern die Cities bespielen. Mit anderen Worten: Die heutigen Gewerbegebiete bekommen Konkurrenz von den Innenstädten. Vieles was wir heute noch auf der grünen Wiese finden, wird in kleinerer Dimension in die Stadtkerne wandern. Großräumige Parkplätze und Autos werden bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Bau- und Gartenmärkte) zum Shoppingerlebnis nicht mehr benötigt. Es wird von den Kunden nur noch vor Ort im Laden die Ware ausgesucht, um sich diese dann bequem nach Hause liefern zu lassen. Darüber hinaus wird die Stadt zukünftig einen wachsenden Mikrokosmos als sein eigener Selbstversorger bilden. Die Produktion wird kleinteiliger, lokaler und individueller: Makerstudios und Manufakturen werden die Innenstädte beleben. Bäcker, Konditoren und Käsereien werden in gläsernen Show-Produktionsstätten ihr Können zeigen. Auch die Gastronomie wird mit kleinen Hausbrauereien und eigenen, kleinen Dachgärten zum urbanen Selbstversorger. Neben kleinen Dachgärten werden in der Zukunft wohl auch riesige vertikale Farmen in den Städten entstehen. Was unten in der Markthalle verkauft wird, wird in den Stockwerken darüber angebaut werden.
Die kurzen Wege in den Innenstädten sind unschlagbar – deshalb wird es viele alternative Nutzungen in den Stadtkernen geben. Vielleicht werden auch Kulturangebote die einstigen Laden- und Büroflächen beleben. Dort wo ein Einkaufscenter stand, wird vielleicht bald ein Kultur- und Veranstaltungscenter stehen. Ateliers, die an den Stadtrand gedrängt wurden, werden vielleicht mit günstigeren Mieten wieder ins Stadtzentrum gelockt. Auch neue Museen und Bibliotheken und Mediencenter mit Eventflächen für Talks und Workshops, die auch abends und am Wochenende geöffnet sind, könnten die Innenstädte am Abend beleben. Größere Flächen in der Innenstadt werden wahrscheinlich zukünftig auch von Health Centern belegt werden mit Fachärzten, Wellnessbereichen und Angeboten der ästhetischen Schönheitsmedizin. Zudem könnten auch Schulen, Kitas und Behinderteneinrichtungen vom Stadtrand in die besser erreichbaren Cities ziehen. Und auch einige in Außenbezirken liegenden Unis, werden vielleicht in der Postcorona-Zeit belebende Ableger in den Innenstädten erhalten. Die Stadt Siegen hat zum Beispiel ein Teil ihrer Universität in einem früheren Kaufhaus im Stadtzentrum untergebracht. In mischgenutzten Bauten in den Innenstädten sollten dementsprechend auch preiswerte Apartments für Studenten zu finden sein. Wo vorher Kaufhäuser waren, sind vielleicht bald auch Orte des „lebenslangen Lernens“ mit Volkshochschulen, Sprachschulen, modernen Media-Bibliotheken und anderen Fortbildungsstätten.
Fest steht: Die Städte sind im Umbruch und die Vielfalt der Städte ist nur mit einer vielfältigen Gestaltung zu erreichen. Auch die Stadtplanung in Frankfurt am Main wird in Zukunft wohl noch mehr auf gemischt-genutzte Quartiere setzen. Heutige Städter verlangen von einer Stadt nicht nur dass sie funktioniert, sondern auch urban ist. Mit ökologischer Nachhaltigkeit geplante, lebendige und dichte Innenstadtareale sind deshalb Heute und in Zukunft gefragt. Die Magnetwirkung der Städte wird auch in Zukunft hoch bleiben: Auch wenn Corona für einen Dämpfer gesorgt hat, wird der grundsätzliche Trend zur Stadt wohl zukünftig ungezügelt weitergehen. Trotzdem wird man die Stadt „neu denken“ müssen, denn die grenzenlos wachsenden Metropolen müssen sich im Zeitalter der Klimakrise zu einer ökologisch vertretbaren Siedlungsform wandeln. Neben der Klimakrise, sind vor allem gestalterischen Fragen, der gravierende Wohnungsmangel, die Einzelhandelskrise und der Verkehrskollaps die aktuellen Leitthemen, mit denen sich eine Stadt wie Frankfurt zwingend auseinandersetzen muss.
Fazit und Ausblick
Weltweit haben die Städte mit denselben Problemen zu kämpfen. Im Zeichen des Klimawandels ist ein höher, schneller, weiter wie bisher in den Metropolen der Welt ausgeschlossen. Die Städte werden sich verändern, die Frage ist, welche Stadt am besten den Veränderungsprozess bewältigen wird. Bisher hat die Stadt Frankfurt immer mit Stolz verkündet, wenn die Einwohnerzahl in der Stadt mal wieder gestiegen ist, oder wenn mal wieder ein neues, noch größeres Hochhausprojekt in der Stadt initiiert wurde. Die weiteren Wachstumsmöglichkeiten sind insbesondere in Frankfurt jedoch sehr begrenzt. Möchte man zukünftig die letzte Baulücke, die letzte Wiese und den letzten Acker im Stadtgebiet noch bebauen? Und was hat die Stadt oder vielmehr die Bürger davon, wenn Investoren mal wieder einen neuen Büroturm hochziehen? Die Stadt sollte besser andere Dinge messen und darauf ihren Fokus legen. Wie glücklich sind die Menschen in der Stadt? Wie hat sich die Wasser- und Luftqualität verbessert? Wieviel neue Bäume konnten im letzten Jahr gepflanzt werden? Wenn man die Stadtpolitik auf solche Parameter ausrichtet, dann muss man sich auch keine Gedanken um die Zukunft machen. Lebenswerte Städte haben eine enorme Anziehungskraft für Besucher, Touristen und Investoren aus zukunftsträchtigen Branchen. Die Menschen meiden dagegen schmutzige, unsichere und hässliche Städte. Die Investition in die Schönheit der Städte lohnt sich mehr denn je. Menschen meiden auch austauschbare Orte: Deshalb sollte Frankfurt auch in seine Einzigartigkeit investieren. Die traditionelle Gastronomie, Bauten die Geschichten erzählen und die Menschen in der Stadt sind nicht austauschbar. Sie sind einmalig. Das ist der unverwechselbare Charakter von Frankfurt.
Die Stadtentwicklung muss zukünftig noch mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger eingehen. Die Menschen möchten mitgenommen werden, mitbestimmen wie die Stadt in Zukunft aussehen wird. Die Stadt muss zudem für alle da sein. Wenn sich die Wohnung keine Krankenschwester, kein Feuerwehrmann und keine Verkäuferin mehr leisten kann, dann hat die Stadt ein großes Problem. Großspuriges, luxuriöses, eindimensionales Bauen sollte der Vergangenheit angehören. Die Stadt muss bezahlbar bleiben: Auch für kleine Unternehmer und Ladenbesitzer und für lokale Gastronomen. Die Vielfalt der Neuen Altstadt wünscht man sich auch für andere neue Stadtviertel. Die Altstadt hat einen hohen Maßstab gesetzt: Kompakt und fußläufig, verkehrsberuhigt und mischgenutzt. Wer nur Spott und Häme für die Neue Altstadt hat, der sollte sich überlegen, welches neue Quartier in den letzten Jahrzehnten eine ähnlich hohe Lebendigkeit erreicht hat. Die Altstadt ist, da gibt es keinerlei Zweifel, ein Erfolgsmodell. Ohne Frage: Es gibt noch viele andere städtebauliche Modelle, die erfolgreich sein können. Aber es gibt keinen Grund, erfolgreiche Elemente aus der Neuen Altstadt nicht für künftige, neue Quartiere zu nutzen.
Nach dem in diesem Buch geführten Diskurs über die zurückliegende und zukünftige Frankfurter Stadtentwicklung wurde sehr deutlich, dass mit der Neuen Altstadt in Frankfurt kein Quartier von Vorgestern geschaffen wurde. Im Gegenteil: Die kleinteilige, dichte Bebauung gibt gute Antworten auf die Stadt im Zeichen der Klimawende. Sieht man die Neue Frankfurter Altstadt jedoch im Kontext zu anderen Wiederaufbauprojekten wie in Dresden oder Potsdam, so wird jedoch sichtbar, dass die Neue Frankfurter Altstadt bisher keine Signalwirkung für weitere, historisierende Bauprojekte in der Stadt hatte. In Dresden wurde mit dem Aufbau der Frauenkirche dagegen schnell klar, dass auch die Umgebung im traditionellen Stil mit originalen und vereinfachten Nachbauten wiederhergestellt werden sollte. Auch in Potsdam hat der Wiederaufbau des Schlosses zu weiteren Wiederaufbauten im Zentrum rund um den Alten Markt geführt. Bereits 1990 beschloss die Stadtverordnetenversammlung in Potsdam die Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss und -aufriss. In Frankfurt dagegen, gab es bisher keine Bestrebungen nach dem Wiederaufbau der Neuen Altstadt weitere Quartiere in der Altstadt wieder aufzubauen. So als wäre jetzt die „Pflicht erfüllt“ hat man bei der Stadt das Kapitel Altstadt beiseitegelegt und widmet sich jetzt wieder der zeitgenössischen Architektur. Dabei könnte man jetzt an die neu gewonnene Altstadt anknüpfen und die altstadtgerechte Bebauung weiter ergänzen. Der bei der Neuen Altstadt gewonnene Erfahrungsschatz ist riesig. Anerkennung für die Aufbauleistung kommt zudem aus der ganzen Welt. Fest steht: Auch jenseits von originalgetreuen Rekonstruktionen kann in der Altstadt und in den angrenzenden Vierteln von Frankfurt am Main, noch eine Menge Stadtreparatur betrieben werden. 1
Quellenverzeichnis
(1) Vgl. Studie: Hochhäuser am Hauptbahnhof https://www.skylineatlas.de/hochhaeuser-hauptbahnhof-frankfurt/
(2) Loos, Adolf: Ornament und Verbrechen, Wien, 1908
(3) Gropius, Walter: Internationale Architektur, München, 1925
(4) Vgl. Tageslicht und frische Luft, in: FNP, 30.07.16
(5) Vgl. Allihn, Karen: Wohnungen statt Römerpark in Frankfurt, FAZ, 23.09.19
(6) Vgl. https://ernst-may-gesellschaft.de/das-neue-frankfurt/wohnsiedlungen/siedlung-hoehenblick.html
(7) Vgl. Praschl, Peter: Le Corbusier war der Faschist des rechten Winkels, in: Die Welt, 19.05.15
(8) Rieck, Barbara-Ann, Speers Erbe, in: Der Tagesspiegel, 06.06.05
(9) Vgl. Historisches Museum präsentiert die Schnitzkunst vom „Salzhaus“, in FAZ, 09.11.04
(10) Geschichte der Rekonstruktion - Konstruktion der Geschichte, Nerdinger 2010, S. 434 ff.
(11) Vgl. Hage, Volker: Feuer vom Himmel, in DER SPIEGEL, 3/1998, 11.01.98
(12) Vgl. Stimmann, Hans: Die Achtundsechziger haben unsere Altbauten gerettet, in: Die Welt, 17.05.18
(13) Vgl. Elser, Oliver: Tiefenbohrungen im Netzwerk,22.01.19, in:1 https://www.marlowes.de/tiefenbohrungen-im-netzwerk/
(14) Vgl. Michels, Claudia: Bundesrechnungshof. Denkmal kaum noch zu retten, Frankfurter Rundschau, 30.11.11
(15) Vgl. Schönberger, Agnes: Ein Offenbacher als Ideengeber, in: FR, 24.05.18
(16) Vgl. Reger Zuspruch von Architekturbüros aus ganz Europa, in: DomRömer Zeitung, Ausgabe Januar/Februar 2011, Seite 3
(17) Vgl. https://www.atlasobscura.com/articles/urban-planning-disneyland
(18) Vgl. Faltin, Thomas: Die Sehnsucht nach der alten Stadt, in: Stuttgarter Zeitung, 10.06.12
(19) Vgl. https://www.bauhandwerk.de/artikel/bhw_Handwerkliche_Rekonstruktion_des_Fachwerkhauses_Zur_Goldenen_Waage_in_3501206.html
(20) Vgl. „Vergangenheit sichtbar machen“, Interview mit Jochem Jourdan, in: Frankfurter Rundschau Geschichte, Band 8, 2018, Die neue Altstadt
(21) Vgl. Neue Altstadt in Frankfurt erringt Preis auf Immobilienmesse, in: Die Welt, 15.03.19
(22) Vgl. Wilhelm von Boddien: „Seien wir von Zeit zu Zeit einmal tolerant“, in: Die Welt, 05.01.01
(23) Vgl. „Kulissenhafte Rekonstruktion möglich“, in: FAZ, 27.09.06
(24) Vgl. Guratzsch, Dankwart: Dürfen wir eigentlich Gebäude kopieren?, in: Die Welt, 03.08.10
(25) Schulz, Bernhard: Rekonstruktion: Wie zerronnen, so gewonnen, in: Der Tagesspiegel, 29.07.10
(26) Vgl. Göpfert, Claus-Jürgen: Altstadt wird noch teurer, in FR, 12.12.16
(27) Vgl. „Die Leute wollen Selfies mit mir machen“, in: FAZ, 27.09.18
(28) Vgl. Nikolai Alexander Mader und Friedrich Thießen: Der Wert stilgeprägter Architektur, in: Schriftenreihe Stadtbild Deutschland e.V., 2018
(29) Vgl. Schönberger, Agnes: Der Kaiserlei-Umbau zwischen Frankfurt und Offenbach wird deutlich teurer, in: FR, 20.02.20
(30) Vgl. Göpfert, Claus-Jürgen: Es ist eng in der neuen Altstadt, in: FR, 06.12.18
(31) Vgl. Prof. DW. Dreysse u.a., Dokumentation Altstadt, Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt am Main, Oktober 2006
(32) Vgl. Göpfert, Claus-Jürgen, Es ist eng in der neuen Altstadt, in: FR, 06.12.18
(33) Vgl. Eindeutige Mehrheit für historisch geprägten Wiederaufbau., in: FAZ, 15.02.2006, Nr. 39, S. 46
(34) Vgl. Schulze, Rainer: Nicht genug Unterschriften für Bürgerentscheid, in: FAZ, 22.09.13
(35) Michels, Claudia: Viel Spott für die „Lüge“ im historischen Herz der Stadt
(36) Vgl. Diese Architektur tut nicht gut, 16.08.18, Monika Leykam, Immobilien Zeitung
(37) Vgl. Trüby, Stephan: Wir haben das Haus am rechten Fleck, in: FAS, 08.04.18
(38) Alexander, Matthias: Frankfurts langer Weg zur neuen Altstadt, in: FAZ, 22.09.18
(39) Werner Durth, Niels Gutschow: Träume in Trümmern, 1993, S. 53-54
(40) Voigt, Wolfgang: „Hier muss Hass heilig werden“, in: DIE ZEIT, 35/2018, 22.08.18
(41) Lampugnani, Vittorio Magnago: Weder rein noch reaktionär, in: DIE ZEIT, 27.01.84
(42) Vgl. Teutsch, Oliver: Frankfurter findet Liste mit arisierten Gebäuden, in: FR, 31.01.19
(43) Vgl. Teutsch, Oliver: „Adolf Miersch: Ein Frankfurter Bürokrat in drei Systemen“, FR, 31.01.19
(44) Vgl. „Ein klassisches Paradoxon!“ (Philipp Maaß interviewt von Katharina Wiechers), in: PNN, 02.01.2014
(45) Maximilian Liesner: Zwischen Radikalität und Rücksichtnahme – Das Technische Rathaus und das historische Museum, In: Die immer neue Altstadt, 2018, S. 92 ff.
(46) Das kann den Steuerzahler nicht gefallen, Gespräch von Hannes Hintermeier mit Anselm Thürwächter, in: FAZ, Nr. 125, S. 40, 01.06.07
(47) Bartetzko, Dieter: Das kommt uns nicht mehr auf den Tisch! In: F.A.Z., 24.04.09, Nr. 95, Seite 31
(48) Vgl. Widerstand gegen das Technische Rathaus. In: Frankfurter Rundschau Geschichte, Die neue Altstadt, Band 8, 2018, S. 53
(49) Vgl. Michels, Claudia: Das Ende eines Vorbilds. In: Frankfurter Rundschau, 04.01.10
(50) Vgl. Lausberg, Margarete, Stadt Frankfurt am Main, Presse und Informationsamt, Der Elefantenfuß ist bald Geschichte,1 www.frankfurt.de, 24.11.2009
(51) Vgl. Göpfert, Claus-Jürgen: Wuchermieten in der neuen Altstadt, In: FR, 06.07.18
(52) Vgl. Göpfert, Claus-Jürgen: Frankfurter Altstadt ab Februar offen, FR, 20.11.17
(53) Vgl. Maurus, Kim: „Wir sollten nicht auf große Fenster und helle Wohnungen verzichten“, in: FAZ, 03.08.19
(54) Vgl. Berling, Janis: Neue Altstadt als Touristenmagnet: „Hochhäuser habe ich zu Hause genug“, in: FR, 22.11.19
(55) Vgl. Elliesen, Moritz: Kritischer Blick hinter die Fassade der Altstadt, in: FR, 11.07.18
(56) Vgl. Göpfert, Claus-Jürgen: Frankfurter Altstadt lockt Millionen – doch viele Probleme bleiben bestehen, in: FR, 05.12.19
(57) Vgl. Murr, Günter: Das wünschen sich die Bürger, in: FNP, 30.07.16
(58) Vgl. Thießen, Friedrich u.a., Fluch und Segen des Bauhausstils, TU Chemnitz, WWDP 130/2017 Mit dem Bau der Altstadtstrecke 1966-71
(59) Mäckler, Christoph: Die Stadt braucht Dichte, In: FAZ, 13.05.20
(60) Vgl. Deutschlandfunk Kultur, Wie ein Architekt das Markenzeichen Bauhaus erfand, Adolf Stocks, 24.07.19 https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-gropius-prinzip-wie-ein-architekt-das-markenzeichen.976.de.html?dram:article_id=454669
(61) Vgl. Oberhuber, Nadine: Eintönige Neubauten, In: FAZ, 26.04.17
(62) https://www.stadtbaukunst.de/homepage-2-2/konferenz-no-10-4/
(63) Vgl. Gehl, Jan: Städte für Menschen, Jovis Berlin, 2015
(64) Vgl. Innenstadtkonzept Frankfurt am Main https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/innenstadtkonzept_5276.html
(65) Vgl. Kuratorium Kulturelle Frankfurt e.V.: Die Stadt der Zukunft, 200 Jahre Polytechnische Gesellschaft – Sonderausgabe der Kulturellen Kurznachrichten. Vittorio Magnago Lampugnani: Damit wir unsere Städte wieder bewundern lieben, S.16
(66) Vgl. Qualität im Städtebau. Allgemeine Leitlinien, Stadtplanungsamt und Bauaufsicht, Frankfurt am Main, 2019 https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/qualit_t_im_st_dtebau_18612.html?psid=4f4nohs209q4sl647762vq6i37
(67) Vgl. Mechthild Harting und Rainer Schulze: Ein zweites Nordend am Römerhof, In: FAZ, 18.06.20
(68) Vgl. Baukultur Bundesstiftung, Baukulturbericht 2018/19, S. 170
(69) Vgl. Scheiblauer, Anne Christin, Frankfurt am Main - Die historische Altstadt, 2. Aufl., 2019, S. 201
(70) Vgl. Guratzsch, Dankwart: In Ostpreußen werden die Altstädte neu erfunden, in: Die Welt, 01.01.11
(71) Vgl. Schleidt, Daniel: Der Traum von einem Zentrum für Kreative, in: FAZ, 04.03.21
(72) Vgl. Weißmüller, Laura: Mainmärchen, in: Süddeutsche Zeitung, 07.10.171
(73) Vgl. Manus, Christoph: Frankfurt: Appell für Sanierung statt Abriss, in; FR, 07.05.21
(74) Vgl. Grodensky, George: Frankfurt: Mehr Grün auf den Grundstücken, in: FR, 10.03.21
(75) Vgl. Leclerc, Florian: Immer mehr Autos im Rhein-Main-Gebiet, in FR, 30.08.20
(76) Vgl. Schmidt, Thomas J.: Spektakulärer Vorschlag für die Zeil in Frankfurt – Steht die Fußgängerzone vor dem Aus?, in: FNP, 15.03.21
(77) Vgl. Apcoa will aus Parkhäusern „Urban Hubs“ machen, RND, 16.02.21
Literaturverzeichnis
DAM 2005, Rob Krier: Ein romantischer Rationalist
Deutsche Architekten, Werner Durth 1992
Die Unwirtlichkeit unserer Städte-Anstiftung zum Unfrieden, Alexander Mitscherlich
Die gemordete Stadt, Siedler1
Tod und Leben großer amerikanischer Städte, Jane Jacobs
Daniel Fuhrhop, Verbietet das Bauen!
Gernot Wagner, Stadt, Land, Klima
Die immer Neue Altstadt, Philipp Sturm / Peter Cachola Schmal (Hg.)
Alt-Frankfurt ein Vermächtnis, Hartmann, Georg (Hg.) und Fried Lübbecke
Anne Christin Scheiblauer, Die historische Altstadt
Schauplätze: Frankfurt in den 50er Jahren, Michael Fleiter, Tobias Picard
Tobias Picard, Frankfurt am Main in frühen Farbdias 1936 bis 1943
Markus Kutscher, Rund um den Römer, Ein Spaziergang durch die Frankfurter Altstadt
Hans-Otto Schembs, Frankfurt in den Jahren 1945 bis 1960
Eva-Maria Bast, Julia Rieß, Frankfurter Geheimnisse
Freddy Langer, Frankfurts Neue Altstadt
Herbert Nordmeyer, Tobias Picard, Unvergessenes Frankfurt.
Fred Kickhefel, Markus Kutscher, Frankfurt am Main Stadt im Wandel
Sandra Pappe, Architekturführer Frankfurt am Main
Francofordia Photographien von Anselm Jaenicke. Texte von Benno Reifenberg. 1963
Heinz U. Krauss, Frankfurt am Main: Daten, Schlaglichter, Baugeschehen, 1997
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Fakten und Mythen zur neuen Frankfurter Altstadt?
Viele Fakten und Mythen ranken sich um die Neue Frankfurter Altstadt, über die insbesondere während der Planungsphase viel diskutiert wurde. Es werden verschiedene Aspekte behandelt, von der Frage, ob es sich um ein "Disneyland" handelt, bis zur Debatte über die Kosten und die architektonische Qualität des wiederaufgebauten Viertels.
Ist mit der neuen Altstadt ein „Disneyland“ entstanden?
Der Vorwurf, die Altstadt sei ein "Disneyland", wird widerlegt, indem auf die hochwertige Bauausführung, die Verwendung authentischer Materialien und die historische Grundlage der Rekonstruktionen hingewiesen wird. Die Bauten stehen an den Originalstandorten und sind keine bloßen Kulissen.
Sind Rekonstruktionen nicht eigentlich verboten?
Das angebliche Verbot von Rekonstruktionen wird diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass viele berühmte Sehenswürdigkeiten weltweit Rekonstruktionen sind und dass die Charta von Venedig, die oft als Begründung für das Verbot genannt wird, keine klare Antwort auf die massenhaften Kriegszerstörungen bietet.
War der Altstadtwiederaufbau zu teuer?
Die Kosten des DomRömer-Projekts werden analysiert. Es wird argumentiert, dass ein Großteil der Ausgaben durch Verkaufserlöse, Steuereinnahmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen kompensiert wird und dass die Investition langfristig der Stadt zugutekommt.
War die historische Altstadt ein Viertel ohne hochwertige Architektur?
Es wird darauf hingewiesen, dass die Altstadt nicht nur ein Arme-Leute-Viertel war, sondern auch stolze Bürgerhäuser und bedeutende Gebäude beherbergte. Die Altstadt ist das wichtigste Zeugnis der Stadtgeschichte.
Wurde die neue Altstadt für Touristen statt für die Bürger gebaut?
Die Altstadt wurde für Touristen und die Bürger gebaut. Sie ist identitätsstiftend und ein Ort der Begegnung für alle Generationen.
Hat man beim Altstadtprojekt die Expertenmeinung übergangen?
Der Bürgerwille ist wichtig, aber man hatte ausgewiesene Experten wie ausgebildete Architekten und Stadtplaner. Die Bürger sollten daher von Anfang am Planungsprozess beteiligt und deren Willen berücksichtigt werden. Schließlich gehört die Stadt nicht nur Investoren und Politikern, sondern in erster Linie den Bürgern.
Verklärt der Altstadtwiederaufbau die Geschichte?
Auf dem wieder errichteten, historischen Altstadtareal wird Erinnerungskultur für viele Generationen erst sichtbar.
Steht die Altstadt für Naziarchitektur?
Dieses ist zu verneinen. Einer Kriegsschuld kann niemals mit der Beseitigung alter Gebäude und einer radikalen, baulichen Erneuerung getilgt werden.
Ist die Moderne in der Altstadt zu kurz gekommen?
Nein. Es wurden auch 20 Neubauten hinzugefügt. Es wird mehr die Anmutung über den modernen Bauten kritisiert.
Wurde für die neue Altstadt hochwertige, moderne Architektur abgerissen?
Ja, mit der Abriss von der Technische Rathaus wurden restlichen historischen Bauten, die im Krieg stehen geblieben waren bzw. wieder repariert wurden, abgerissen.
Will in der engen, dunklen Altstadt überhaupt jemand leben?
Das Gegenteil ist der Fall, in der neuen Frankfurter Altstadt ist sehr begehrt zu wohnen. Die Wohnungen werden zu hohen Preisen vermietet.
Ist nicht eigentlich die Skyline, statt die Altstadt, identitätsstiftend für Frankfurt?
Beides ist korrekt. Die traditionelle Gastronomie, Bauten die Geschichten erzählen und die Menschen in der Stadt sind nicht austauschbar. Sie sind einmalig. Das ist der unverwechselbare Charakter von Frankfurt.
Ist wirklich alles gut?
Manche Dinge könnten ergänzt oder geändert werden, wie: Wohnungsvergabe, Infrastruktur. Ansonsten läuft es gut in der neuen Altstadt.
Die Altstadt ergänzen
Zur weiteren Belebung der Altstadt ist es anzustreben, noch mehr handwerkliche und kulturelle Mieter wie Kunsthandwerksläden, Manufakturen, Galerien, Concept Stores und Ateliers in das Quartier anzusiedeln.
- Quote paper
- Thomas Petzinna (Author), 2022, Stadtentwicklung in Frankfurt am Main. Der Weg von der neuen Frankfurter Altstadt in die Zukunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1167834