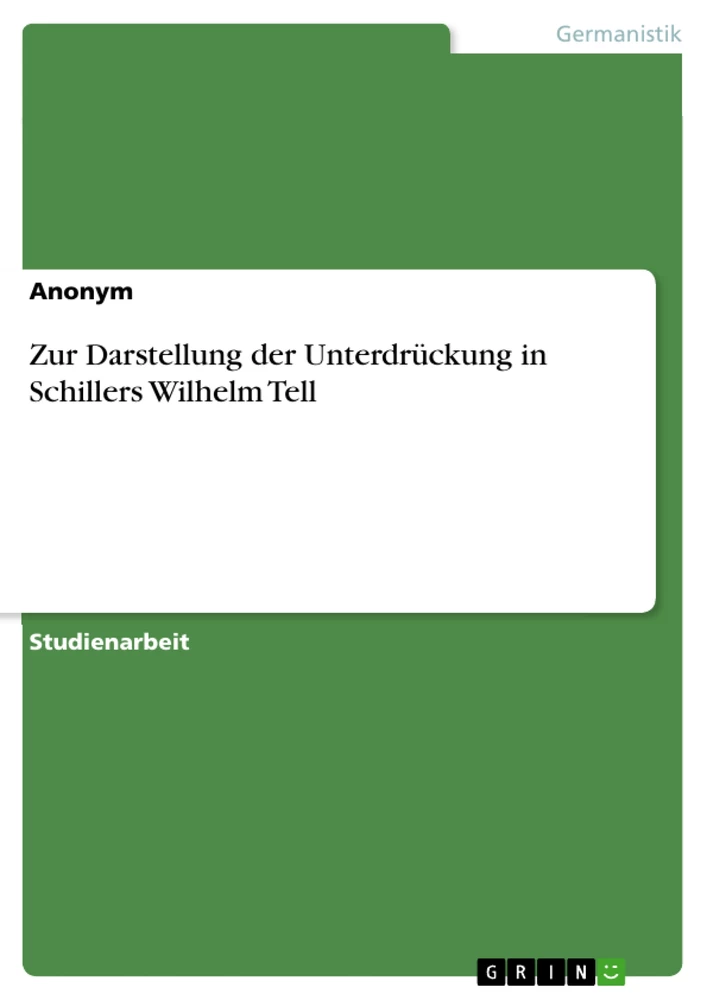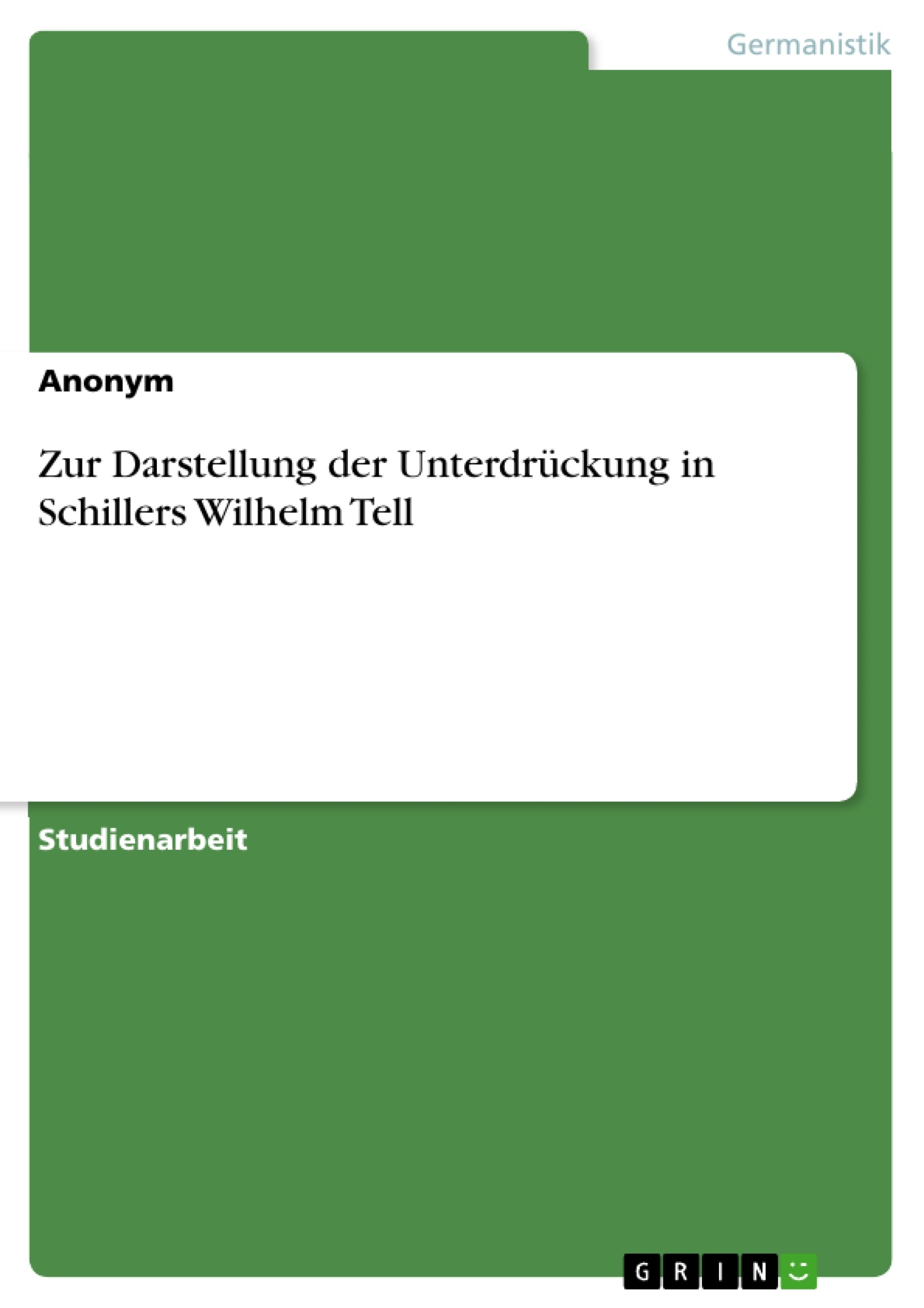Wilhelm Tell ist ein Drama von Friedrich Schiller, das er 1803 im Alter von 44 Jahren begonnen hatte und im Februar 1804 fertigstellte. Es ist Schillers vorletztes vollendetes Drama, bevor er im Mai 1805 an einer Lungenentzündung starb. Charlotte von Lengefeld berichtete Schiller bereits im April 1789 in einem Brief von der Tellsage und dem damit verbundenen Heldenmythos. Schiller verhielt sich dem gegenüber allerdings eher skeptisch, sodass ihn erst Goethe, vermutlich bei zwei gemeinsamen Spaziergängen im Juli 1803, zur schriftlichen Bewältigung dieses epischen Stoffes überzeugen konnte. Schiller lebte und wirkte in einer Zeit des Umbruchs, geprägt von der Aufklärung. Durch diese erlebte er den Wandel vom absolutistischen zum bürgerlichen Zeitalter mit. Schillers Werke werden literarisch sowohl der Bewegung des Sturm und Drang als auch später der Weimarer Klassik zugeordnet. Sein Werk Wilhelm Tell fügt sich dem an und appelliert an Vernunft, Humanität und Freiheit. Der Aufbau, Stil und der zeitliche Rahmen der Entstehung des Dramas deutet auf die Weimarer Klassik hin, der Inhalt bedient sich jedoch auch zentralen Motiven des Sturm und Drang, in dem politische und gesellschaftliche Machtinstanzen abgelehnt wurden und die Freiheit einen besonderen Stellenwert erlangte.
In Wilhelm Tell greift Schiller diese Abneigung gegenüber politischen Machtinstanzen auf und verbindet sie mit der Tellsage, die sich durch ihn als fester Teil der schweizerischen Entstehungsgeschichte etablierte. Die Darstellung von Unterdrückung ist in Wilhelm Tell eine leitende Thematik, welche sich in sämtlichen Bereichen der Konzeption des Dramas, also der Figuren-, Schauplatz- sowie Handlungsdarstellung, widerspiegelt. Eine Analyse der Konzeption ermöglicht eine Deutung der Wirkungsabsicht Schillers und kann dadurch rückblickend die literarische Bedeutung von Wilhelm Tell verdeutlichen.
Dazu wird untersucht, auf welche Weise die Unterdrückung in Wilhelm Tell explizit und implizit dargestellt wird. Anschließend folgt eine Analyse der Verbindung von Unterdrückung mit der Figuren-, Schauplatz- und Handlungsdarstellung. Grundlage für diese Analyse ist die heutige Lesefassung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematisierung von Unterdrückung in Wilhelm Tell
- Explizite Beschreibung von Unterdrückung
- Mittels Figuren
- Synonyme und nahestehende Wörter
- Implizite Beschreibung von Unterdrückung
- Analepsen
- Symbol der Unterdrückung
- Explizite Beschreibung von Unterdrückung
- Verknüpfung von Unterdrückung mit der Figurendarstellung
- Figurenkonstellation innerhalb der Szenen
- Personifizierte Unterdrückung
- Verknüpfung von Unterdrückung mit der Schauplatzdarstellung
- Schauplätze mit direktem Bezug zur Unterdrückung
- Schauplätze mit indirektem Bezug zur Unterdrückung
- Verknüpfung von Unterdrückung mit der Handlungsdarstellung
- Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung von Unterdrückung in Schillers Wilhelm Tell. Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen der Darstellung – explizit und implizit – zu untersuchen und deren Zusammenspiel mit der Figurenkonstellation, den Schauplätzen und der Handlung zu beleuchten. Die Analyse soll Aufschluss über Schillers Wirkungsabsicht und die literarische Bedeutung des Dramas geben.
- Explizite und implizite Darstellung von Unterdrückung
- Verbindung von Unterdrückung mit der Figurenkonstellation
- Die Rolle von Schauplätzen in der Darstellung von Unterdrückung
- Unterdrückung als Handlungsmotiv
- Schillers Wirkungsabsicht und die literarische Bedeutung von Wilhelm Tell
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und gibt einen Überblick über die Entstehungsgeschichte von Schillers Wilhelm Tell. Sie hebt die Bedeutung des Dramas im Kontext der Weimarer Klassik und des Sturm und Drang hervor und stellt die zentrale Rolle der Unterdrückung als Leitmotiv des Dramas heraus. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die explizite und implizite Darstellung von Unterdrückung untersucht und deren Verbindung zu den verschiedenen Ebenen der Dramenkonzeption analysiert.
Thematisierung von Unterdrückung in Wilhelm Tell: Dieses Kapitel erörtert die grundlegende Bedeutung der Unterdrückung als Grundlage für die Handlung und den darauffolgenden Akt der Befreiung. Es wird die kontrastive Figurenkonstellation von Unterdrückern (österreichische Vögte) und Unterdrückten (Schweizer Volk) analysiert. Das Kapitel differenziert zwischen expliziter und impliziter Darstellung der Unterdrückung und leitet zu den folgenden Kapiteln über, die diese Aspekte detaillierter untersuchen.
Verknüpfung von Unterdrückung mit der Figurendarstellung: Dieses Kapitel analysiert, wie die Figur des Gessler die Unterdrückung verkörpert und wie die Schweizer Widerstand leisten. Es untersucht die Darstellung von Unterdrückung durch die Figuren und ihre jeweilige Rolle im Konflikt. Besonderes Augenmerk wird auf die verschiedenen Arten gelegt, wie die Unterdrückung sprachlich und durch Handlungen zum Ausdruck gebracht wird.
Verknüpfung von Unterdrückung mit der Schauplatzdarstellung: Hier wird untersucht, wie die Schauplätze des Dramas die Atmosphäre der Unterdrückung erzeugen und verstärken. Die Analyse fokussiert auf die symbolische Bedeutung der jeweiligen Orte und deren Funktion in der Darstellung des Konflikts zwischen den Unterdrückern und den Unterdrückten. Es wird zwischen direkten und indirekten Bezügen zu Unterdrückung unterschieden.
Verknüpfung von Unterdrückung mit der Handlungsdarstellung: In diesem Kapitel wird analysiert, wie die Handlung des Dramas die Unterdrückung aufzeigt. Es werden konkrete Handlungssequenzen untersucht, die die Unterdrückung und den Widerstand dagegen veranschaulichen. Die Analyse beleuchtet, wie die Handlungen der Figuren die Thematik der Unterdrückung unterstützen und verstärken.
Schlüsselwörter
Wilhelm Tell, Friedrich Schiller, Unterdrückung, Österreich, Schweiz, Tyrannei, Freiheit, Widerstand, Figurenkonstellation, Schauplatzdarstellung, Handlungsdarstellung, Weimarer Klassik, Sturm und Drang.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Darstellung von Unterdrückung in Schillers Wilhelm Tell"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Unterdrückung in Friedrich Schillers Drama "Wilhelm Tell". Sie untersucht explizite und implizite Formen der Unterdrückungsdarstellung und deren Verbindung zur Figurenkonstellation, den Schauplätzen und der Handlung des Dramas. Ziel ist es, Schillers Wirkungsabsicht und die literarische Bedeutung des Werks zu beleuchten.
Welche Aspekte der Unterdrückung werden untersucht?
Die Analyse umfasst sowohl die explizite (z.B. durch Figuren und Sprache) als auch die implizite Darstellung von Unterdrückung (z.B. durch Analepsen und Symbole). Es wird untersucht, wie die Unterdrückung durch Figuren, Schauplätze und die Handlung selbst veranschaulicht wird. Die Rolle der Figurenkonstellation (Unterdrücker vs. Unterdrückte) und die symbolische Bedeutung der Schauplätze spielen eine wichtige Rolle.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analysemethode, die die verschiedenen Ebenen der Dramenkonzeption – Figurendarstellung, Schauplatzdarstellung und Handlungsdarstellung – untersucht und deren Zusammenspiel im Hinblick auf die Thematik der Unterdrückung beleuchtet. Es werden sowohl sprachliche als auch narrative Mittel analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel "Einleitung", "Thematisierung von Unterdrückung in Wilhelm Tell", "Verknüpfung von Unterdrückung mit der Figurendarstellung", "Verknüpfung von Unterdrückung mit der Schauplatzdarstellung", "Verknüpfung von Unterdrückung mit der Handlungsdarstellung" und "Schluss und Ausblick". Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Unterdrückungsdarstellung in "Wilhelm Tell".
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Analyse umfasst die kontrastive Figurenkonstellation von Unterdrückern (österreichische Vögte) und Unterdrückten (Schweizer Volk), die symbolische Bedeutung der Schauplätze und konkrete Handlungssequenzen, die die Unterdrückung und den Widerstand dagegen veranschaulichen. Es werden sowohl sprachliche Mittel als auch die Handlungen der Figuren untersucht.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Darstellung von Unterdrückung in Schillers "Wilhelm Tell" zu entwickeln und deren Bedeutung für das Verständnis des Dramas im Kontext der Weimarer Klassik und des Sturm und Drang zu ergründen. Die Arbeit soll Aufschluss über Schillers Wirkungsabsicht geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Wilhelm Tell, Friedrich Schiller, Unterdrückung, Österreich, Schweiz, Tyrannei, Freiheit, Widerstand, Figurenkonstellation, Schauplatzdarstellung, Handlungsdarstellung, Weimarer Klassik, Sturm und Drang.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Zur Darstellung der Unterdrückung in Schillers Wilhelm Tell, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1167348