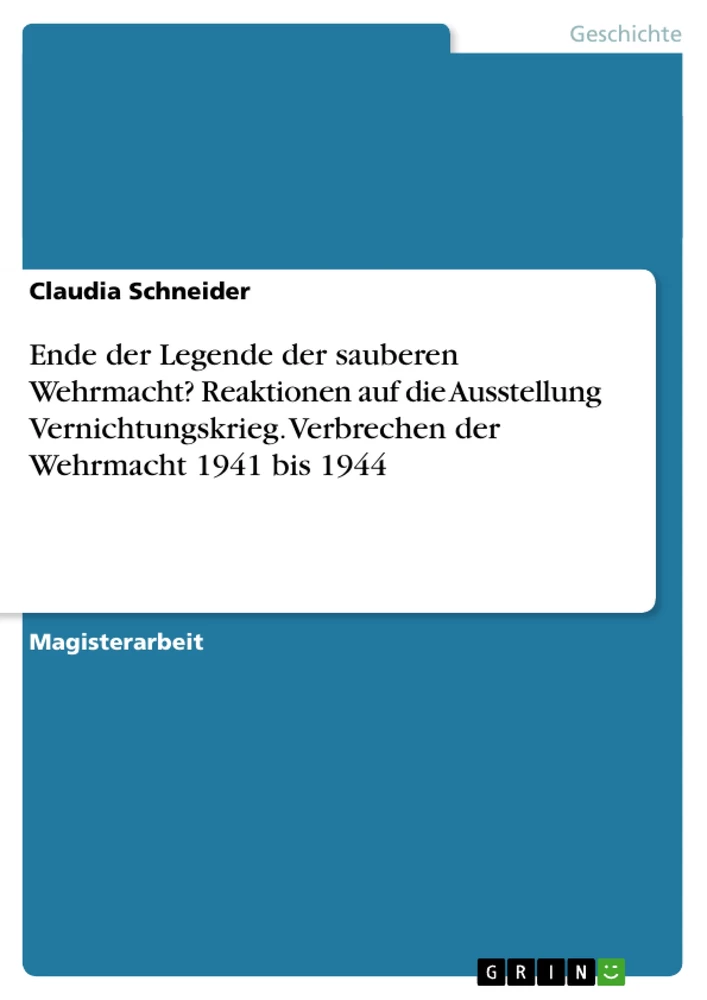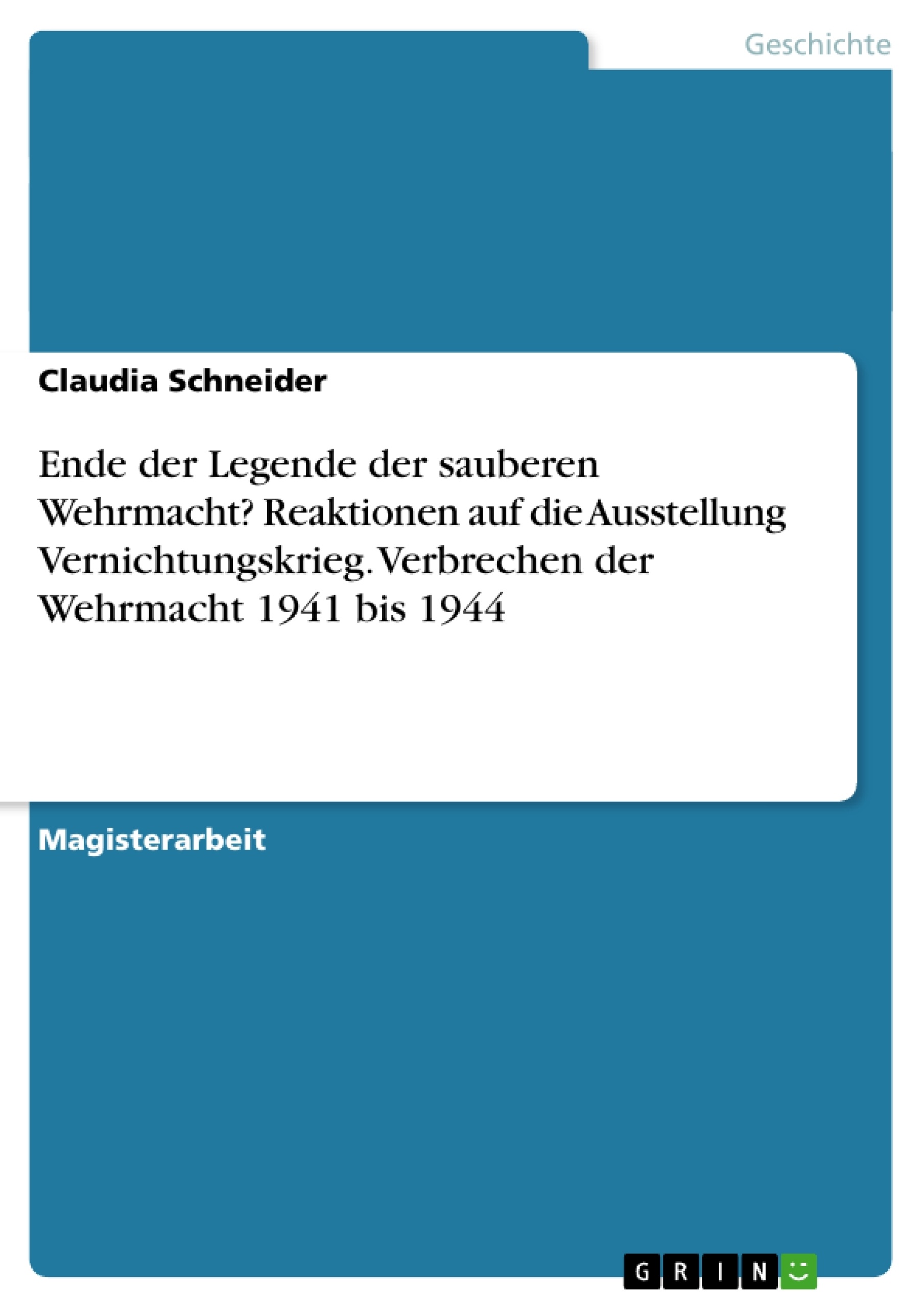In dieser Arbeit steht die Analyse der kontroversen Reaktionen auf die Ausstellung
„Vernichtungskrieg“ im Vordergrund. Auch die ausländische Presse hat über die
Ausstellung ausführlich berichtet,5 doch löste sie mit Ausnahme von Österreich
nirgendwo sonst eine derart intensive Debatte aus. Deshalb beschränkt sich die
Untersuchung auf die deutschen Reaktionen.
Dabei geht es nicht darum zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß es
Verbrechen in der Wehrmacht gegeben hat. Im Hinblick auf die wissenschaftlichen
Erkenntnisse der letzten Jahre kann heute kein seriöser Historiker bestreiten, daß sich
Teile der Wehrmacht mitschuldig gemacht haben an den Verbrechen im Osten.
Gleichzeitig gab es aber auch Soldaten, die erst nach dem Krieg von den Verbrechen
erfahren haben. Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, sich in den Prozentstreit um die
Anzahl der „schuldigen“ Soldaten einzureihen. Vielmehr steht die Frage im
Vordergrund, wie die deutsche Öffentlichkeit mit ihrer Vergangenheit umgeht und
was die Ausstellung „Vernichtungskrieg“ zum gegenwärtigen Geschichtsbild und der
Erinnerungskultur beigetragen hat.
Vom Hamburger Institut für Sozialforschung geplant als ein Bestandteil des Projekts
„Angesichts dieses Jahrhunderts“, löste sich die Ausstellung bereits bei ihrer
Eröffnung im März 1995 aus diesem Rahmen und entwickelte in der deutschen
Öffentlichkeit eine Eigendynamik wie kaum ein Ausstellungsthema zuvor. Die
Diskussion um die Frage nach der Beteiligung von Wehrmachtssoldaten am
Vernichtungskrieg im Osten verlief anfangs überwiegend auf einer sehr persönlichen
und emotionalen Ebene, die hauptsächlich von der lokalen Presse aufgegriffen
wurde. Von besonderem Interesse sind dabei die Reaktionen der Generationen
innerhalb der Gesellschaft, die auf unterschiedlichste Weise von den Ereignissen im
Zweiten Weltkrieg geprägt wurden, deren Auswirkungen aber auch in der
Enkelgeneration noch zu spüren sind. Wie gehen die ehemaligen
Wehrmachtssoldaten damit um, nach 50 Jahren noch einmal mit den
Kriegserlebnissen konfrontiert zu werden? Wie reagieren ihre Söhne und Töchter bei
dem Gedanken, daß ihre Eltern möglicherweise bereits im Krieg von den Verbrechen gewußt haben oder daran beteiligt waren? [...]
5 Vgl. dazu Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944; in: Mittelweg 36, 3/1995, S. 87.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsgegenstand
- 1.2 Forschungsstand und Quellenlage
- 2. Die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“
- 2.1 Konzeption
- 2.2 Kontext
- 3. Die Wehrmacht in der historischen Forschung
- 4. Die Legende der „sauberen Wehrmacht“
- 4.1 Was besagt sie?
- 4.2 Die Entstehung der Legende
- 4.3 Die Konsolidierung des Mythos in den 50er Jahren
- 4.4 Das Bild der Wehrmacht in der Gesellschaft
- 4.5 Fazit
- 5. Ende eines Mythos? Reaktionen auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg“
- 5.1 Die deutsche Gesellschaft: „Die Schuld ist wieder näher gerückt“
- 5.1.1 Die Erinnerung der Kriegsteilnehmer
- 5.1.2 Die Generation der Söhne und Töchter
- 5.1.3 Der Umgang der Enkel mit der jüngsten Geschichte
- 5.1.4 Fazit
- 5.2 Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland
- 5.2.1 Die Funktion der Wehrmacht im Holocaust
- 5.2.2 Eine gespenstische Diskussion um Differenzierung
- 5.2.3 Fazit
- 5.3 Die radikalen Gegner der Ausstellung: „Tribunal gegen deutsche Soldaten“
- 5.3.1 Erscheinungsformen des Protestes
- 5.3.2 Abwehrfront der Veteranenverbände
- 5.3.3 Die Sprecher der konservativen Opposition
- 5.3.4 Rechtsextremer Aufmarsch in München
- 5.3.5 Fazit
- 5.4 Der Konflikt um die offizielle politische Anerkennung der Ausstellung „Vernichtungskrieg“
- 5.4.1 Die Kontroverse in München
- 5.4.2 „Bremen ist nicht München“
- 5.4.3 Die Bundestagsdebatte
- 5.4.4 Fazit
- 5.5 Das Bild der Wehrmacht in der Bundeswehr
- 5.5.1 Neugründung oder Nachfolgeorganisation?
- 5.5.2 Die Traditionsdebatte
- 5.5.3 Die Resonanz der Bundeswehr auf die Ausstellung
- 5.5.4 Fazit
- 5.6 Die Rezeption in der Fachwelt
- 5.6.1 Die Ausstellung als Chance zur Aufklärung
- 5.6.2 Forderung nach Differenzierung
- 5.6.3 Eine neue Dimension der Kritik
- 5.6.4 Die Ergebnisse der Kommission
- 6. Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Reaktionen auf die Wanderausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ und deren Einfluss auf das Bild der Wehrmacht in der deutschen Gesellschaft. Sie analysiert, wie die Ausstellung den Mythos der „sauberen Wehrmacht“ herausforderte und welche Kontroversen dies auslöste.
- Der Mythos der „sauberen Wehrmacht“ und seine Entstehung.
- Die Reaktionen der deutschen Gesellschaft auf die Ausstellung.
- Die Rolle der Ausstellung in der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit.
- Die Kontroversen und Debatten um die Beteiligung der Wehrmacht an Kriegsverbrechen.
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Kriegsteilnehmern, Nachkommen und der Fachwelt.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand – die Reaktionen auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ – vor und skizziert den Forschungsstand sowie die verwendeten Quellen. Sie verdeutlicht die Bedeutung der Ausstellung für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die Debatte um die Rolle der Wehrmacht.
2. Die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“: Dieses Kapitel beschreibt die Konzeption und den Kontext der umstrittenen Ausstellung. Es erläutert das Ziel der Ausstellung, die Beteiligung der Wehrmacht an Kriegsverbrechen aufzuzeigen und eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Der Kontext beleuchtet den historischen Hintergrund und die gesellschaftliche Relevanz zum Zeitpunkt der Ausstellung.
3. Die Wehrmacht in der historischen Forschung: Dieses Kapitel analysiert die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Wehrmacht und ihren Taten. Es beleuchtet verschiedene historische Interpretationen und zeigt die Entwicklung der Forschung zum Thema auf. Die verschiedenen Perspektiven und methodischen Ansätze in der Geschichtswissenschaft werden hier genauer betrachtet.
4. Die Legende der „sauberen Wehrmacht“: Dieses Kapitel beschreibt den Mythos der „sauberen Wehrmacht“, seine Entstehung und Konsolidierung in der Nachkriegszeit. Es analysiert die Mechanismen, die zur Verbreitung dieses Mythos beitrugen und seine Wirkung auf das gesellschaftliche Bild der Wehrmacht. Die Kapitel untersucht zudem die Rolle von verschiedenen Akteuren (Medien, Politik, Veteranenverbände) bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieses Mythos.
5. Ende eines Mythos? Reaktionen auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg“: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die vielschichtigen Reaktionen auf die Ausstellung. Es untersucht die Reaktionen verschiedener Gruppen (deutsche Gesellschaft, jüdische Gemeinde, radikale Gegner, Bundeswehr, Fachwelt) und differenziert deren Motive und Argumente. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Strategien zur Bewältigung der Konfrontation mit der NS-Vergangenheit und analysiert die politischen und gesellschaftlichen Folgen der Ausstellung.
Schlüsselwörter
Wehrmacht, Vernichtungskrieg, Ausstellung „Vernichtungskrieg“, „saubere Wehrmacht“, NS-Vergangenheit, Holocaust, Kriegsverbrechen, Erinnerungskultur, Kontroverse, gesellschaftliche Reaktionen, historische Forschung, Mythos, Tradition, Bundeswehr.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Reaktionen auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg“
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Reaktionen auf die Wanderausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ und deren Einfluss auf das Bild der Wehrmacht in der deutschen Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht die Analyse, wie die Ausstellung den Mythos der „sauberen Wehrmacht“ herausforderte und welche Kontroversen dies auslöste.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Mythos der „sauberen Wehrmacht“ und seine Entstehung; die Reaktionen der deutschen Gesellschaft (einschließlich Kriegsteilnehmer, Nachkommen und jüngerer Generationen) auf die Ausstellung; die Rolle der Ausstellung in der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit; die Kontroversen und Debatten um die Beteiligung der Wehrmacht an Kriegsverbrechen; und die unterschiedlichen Perspektiven von Kriegsteilnehmern, Nachkommen und der Fachwelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung (Forschungsgegenstand, Forschungsstand); 2. Die Ausstellung „Vernichtungskrieg“ (Konzeption und Kontext); 3. Die Wehrmacht in der historischen Forschung; 4. Die Legende der „sauberen Wehrmacht“ (Entstehung, Konsolidierung, Wirkung); 5. Ende eines Mythos? Reaktionen auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg“ (Reaktionen der deutschen Gesellschaft, jüdischen Gemeinde, radikaler Gegner, Bundeswehr, Fachwelt); 6. Bilanz.
Welche Reaktionen auf die Ausstellung werden analysiert?
Kapitel 5 analysiert die vielschichtigen Reaktionen auf die Ausstellung „Vernichtungskrieg“, differenziert nach verschiedenen Gruppen: der deutschen Gesellschaft (einschließlich der Erinnerungen von Kriegsteilnehmern, deren Kindern und Enkeln), der jüdischen Gemeinde in Deutschland, den radikalen Gegnern der Ausstellung, der Bundeswehr und der Fachwelt. Die Analyse umfasst die unterschiedlichen Motive, Argumente und Strategien im Umgang mit der Konfrontation mit der NS-Vergangenheit.
Wie wird der Mythos der „sauberen Wehrmacht“ behandelt?
Der Mythos der „sauberen Wehrmacht“ wird in Kapitel 4 ausführlich behandelt. Es werden seine Entstehung und Konsolidierung in der Nachkriegszeit analysiert, die Mechanismen seiner Verbreitung untersucht und seine Wirkung auf das gesellschaftliche Bild der Wehrmacht beleuchtet. Die Rolle verschiedener Akteure (Medien, Politik, Veteranenverbände) bei der Schaffung und Aufrechterhaltung des Mythos wird ebenfalls untersucht.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem umfassenden Quellenstudium, das im Kapitel zur Einleitung genauer erläutert wird. Die genauen Quellenangaben finden sich im Literaturverzeichnis der vollständigen Magisterarbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in Kapitel 6, der Bilanz, zusammengefasst. Diese Zusammenfassung fasst die Ergebnisse der Analyse der Reaktionen auf die Ausstellung und deren Auswirkungen auf das Bild der Wehrmacht in der deutschen Gesellschaft zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wehrmacht, Vernichtungskrieg, Ausstellung „Vernichtungskrieg“, „saubere Wehrmacht“, NS-Vergangenheit, Holocaust, Kriegsverbrechen, Erinnerungskultur, Kontroverse, gesellschaftliche Reaktionen, historische Forschung, Mythos, Tradition, Bundeswehr.
- Quote paper
- Claudia Schneider (Author), 2003, Ende der Legende der sauberen Wehrmacht? Reaktionen auf die Ausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11670