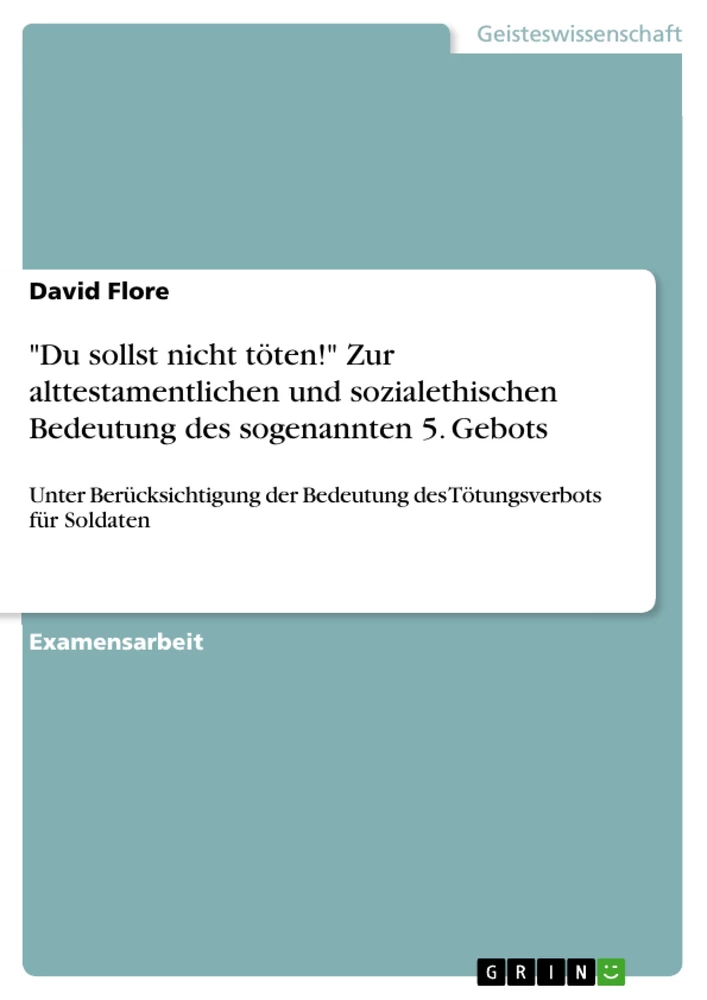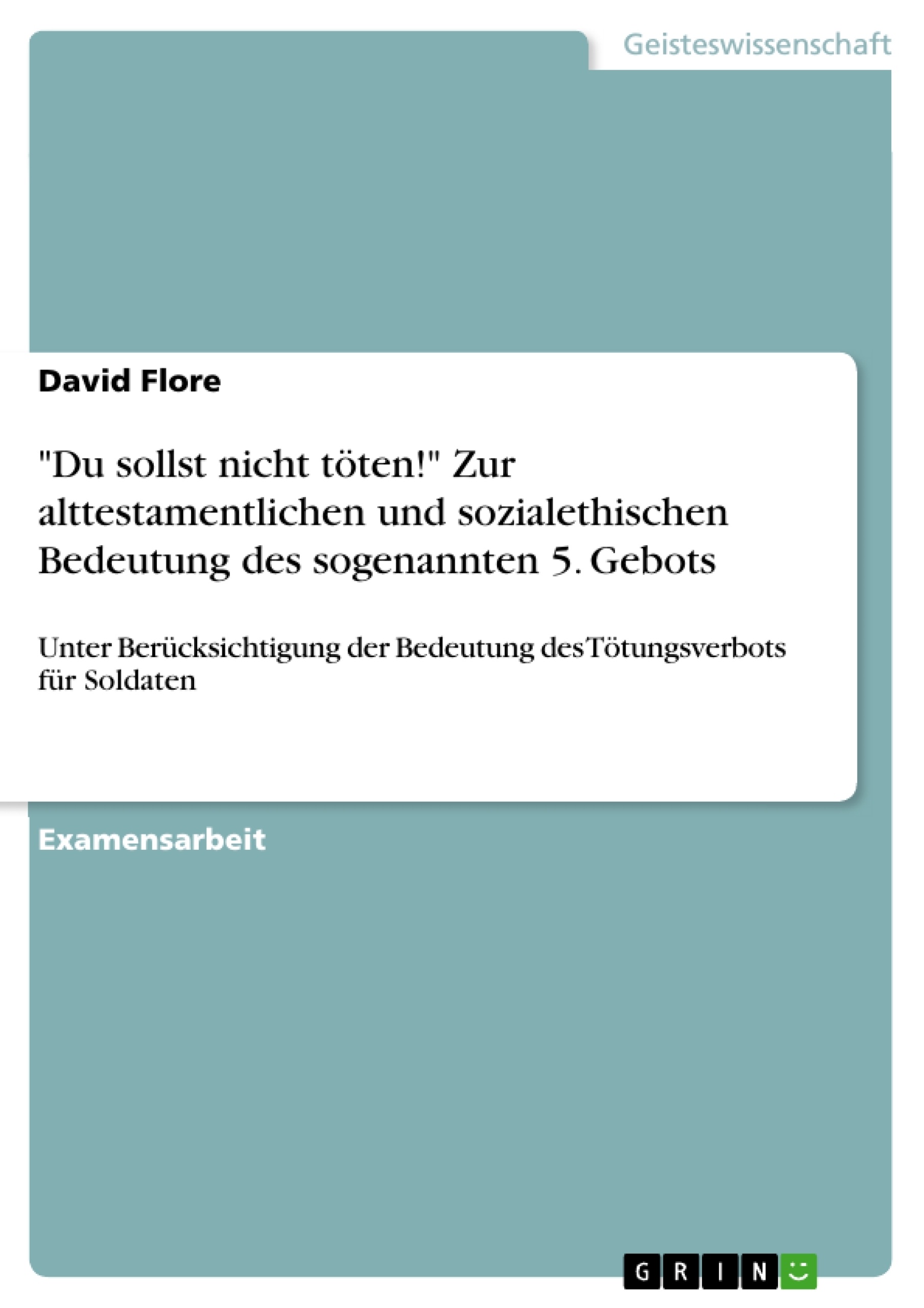Das Gebot „Du sollst nicht töten!“ steht in jüngerer und in jüngster Zeit immer wieder direkt oder indirekt im Fokus der Öffentlichkeit. Der „Gemeinsame Hirtenbrief der Deutschen Bischöfe über die Zehn Gebote als Lebensgesetz der Völker“ von 1943, die gemeinsame Erklärung der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz „Grundwerte und Gottesgebot“ von 1979, der jüngst erschienene Hirtenbrief zur Fastenzeit 2008 über das Thema Sterbehilfe vom Paderborner Erzbischof Hans‐Josef Becker oder der Fall der Sterbehilfe des Hamburger Ex‐Senators Roger Kusch betonen die Aktualität des Themas.
Aus der Motivation heraus, dass der Autor die Ausbildung zum Offizier der Reserve durchlaufen hat, wurde sich mit der Bedeutung des Tötungsverbots für Soldaten befasst, die im Ernstfall nicht auf tödliche Gewalt verzichten können. Macht sich der Soldat beim Gebrauch seiner Waffe im Sinne des Gebotes schuldig und begeht er daher eine Sünde? Sollte dies der Fall sein, besteht dann wenigstens eine Ausnahme in einer Notwehrsituation? Stecken Christen, die die äußerste Gewalt anwenden, mit Blick auf die Bergpredigt nicht von vornherein in einem Dilemma? Es scheint lohnenswert, sich einmal genauer mit militärischer Gewalt und der Frage der Sünde zu befassen. Um diesem Problem nachzugehen, wird zunächst im Kapitel eins auf den Dekalog, dem Widerspruch zwischen Zehnernorm und Anzahl der Gebote und die Entstehungsgeschichte des Dekalogs eingegangen. Daran schließt sich eine Analyse des entscheidenden Verbes razach im sogenannten fünften Gebot an, um im dritten Kapitel eine Aktualisierung des Themas an Hand der Berufsgruppe der Soldaten vorzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Sitz im Leben
- 1.2. Der Dekalog
- 1.2.1. Die Doppelüberlieferung
- 1.2.2. Der Widerspruch zwischen Zehnernorm und Anzahl der Gebote
- 1.2.3. Die Entstehung in mythologischer und formkritischer Perspektive
- 1.2.4. Vorsätzliche und fahrlässige Tötung im Alten Testament
- 2. Bedeutung des Verbs razach
- 2.1. razach innerhalb der Restgruppe
- 2.1.1. Deuteronomium 22,26
- 2.1.2. Richter 20,4
- 2.1.3. 1 Könige 21,19
- 2.1.4. 2 Könige 6,32
- 2.1.5. Hosea 6,9
- 2.1.6. Psalmen 62,4
- 2.1.7. Psalmen 94,4
- 2.2. razach innerhalb der Trias von Töten, Ehebrechen und Stehlen
- 2.3. razach innerhalb der Asylgesetze
- 2.3.1. Deuteronomium 19
- 2.3.2. Josua 20,1-9
- 2.3.3. Deuteronomium 4,41-43
- 2.3.4. Numeri 35,9-34
- 2.3.5. Genesis 9,6
- 2.4. Fazit der Bedeutungsanalyse
- 2.4.1. Der Tatbestand
- 2.4.2. Die Übersetzung razachs
- 2.4.3. Der Geltungsbereich des Tötungsverbots im Alten Testament
- 2.4.3.1. Die Tiertötung
- 2.4.3.2. Die Todesstrafe
- 2.4.3.3. Die Vernichtungsweihe
- 2.4.3.4. Der Krieg
- 2.4.3.5. Die Selbsttötung / Selbstopferung
- 3. Legitimiertes Töten in unserer Zeit
- 3.1. Indirekte Tötung
- 3.1.1. Indirekte Tötung- Ein Eingrenzungsversuch
- 3.2. Selbstmord oder Selbsttötung?
- 3.2.1. Die Selbsttötung und Selbstopferung
- 3.2.2. Gott als Herr des Lebens
- 3.2.2.1. Aufopfernde Selbsttötung
- 3.2.3. Resümee
- 3.3. Notwehr
- 3.3.1. Nothilfe
- 3.3.2. Notwehr als indirekte Tötung oder Tötung eines Schuldigen
- 3.3.3. Resümee
- 3.4. Der gerechte und der ungerechte Krieg - Meilensteine einer Diskussion
- 3.4.1. Von Konstantin bis Luther
- 3.4.2. Zum gerechten Krieg unter Berücksichtigung des Katechismus der Katholischen Kirche
- 3.4.2.1. Das Recht zur Verteidigung
- 3.4.2.2. Die im Krieg zu beachtenden Grundsätze
- 3.4.3. Der Soldat als Mörder?
- 3.4.4. Christus und die Soldaten
- Die Entstehung und Entwicklung des Dekalogs im Alten Testament
- Die Bedeutung des Verbs razach im Kontext des Tötungsverbots
- Die ethische Problematik des Töten im Krieg und in anderen Kontexten
- Die Frage nach der Vereinbarkeit von christlicher Lehre und militärischem Dienst
- Die Bedeutung des 5. Gebots für die sozialethische Diskussion unserer Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der alttestamentlichen und sozialethischen Bedeutung des sogenannten 5. Gebotes „Du sollst nicht töten!“. Sie untersucht die Entstehung und Interpretation des Dekalogs, analysiert die Bedeutung des Verbs razach im hebräischen Text und beleuchtet die Frage nach legitimiertem Töten in unserer Zeit, insbesondere im Kontext des Militärdienstes.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Tötungsverbots ein und beleuchtet den Dekalog als wichtigen Bestandteil der jüdisch-christlichen Tradition. Es untersucht die verschiedenen Deutungen des Dekalogs und setzt sich mit der Frage auseinander, wie das Tötungsverbot in der Geschichte interpretiert wurde.
Im zweiten Kapitel wird das hebräische Verb razach, das im 5. Gebot verwendet wird, eingehend analysiert. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Bedeutungen des Wortes und seine Verwendung in unterschiedlichen Kontexten des Alten Testaments.
Das dritte Kapitel widmet sich der Frage nach legitimiertem Töten in unserer Zeit. Es beleuchtet die Problematik des Töten im Krieg und in anderen Situationen, wie zum Beispiel im Kontext von Notwehr oder Sterbehilfe. Die Arbeit diskutiert die ethischen und theologischen Aspekte dieser Themen und setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich das 5. Gebot auf diese modernen Herausforderungen anwenden lässt.
Schlüsselwörter
Dekalog, Tötungsverbot, razach, Krieg, Notwehr, Sterbehilfe, Militärdienst, christliche Ethik, sozialethische Fragen, Alten Testament, Heiliges Land, Bibel, Theologie.
- Quote paper
- David Flore (Author), 2008, "Du sollst nicht töten!" Zur alttestamentlichen und sozialethischen Bedeutung des sogenannten 5. Gebots, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/116669