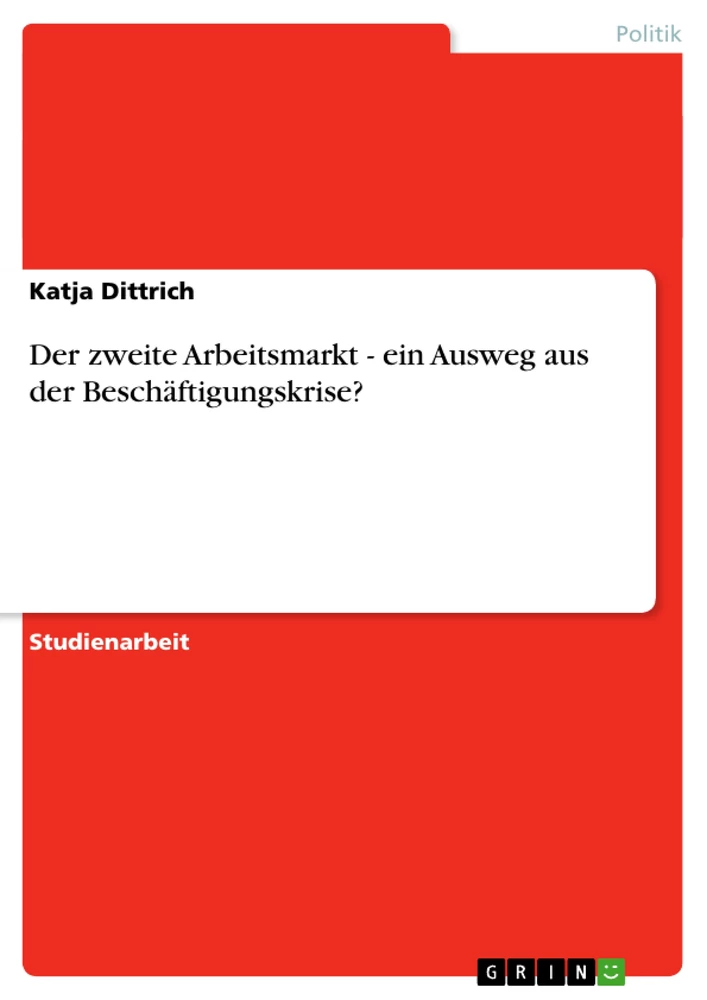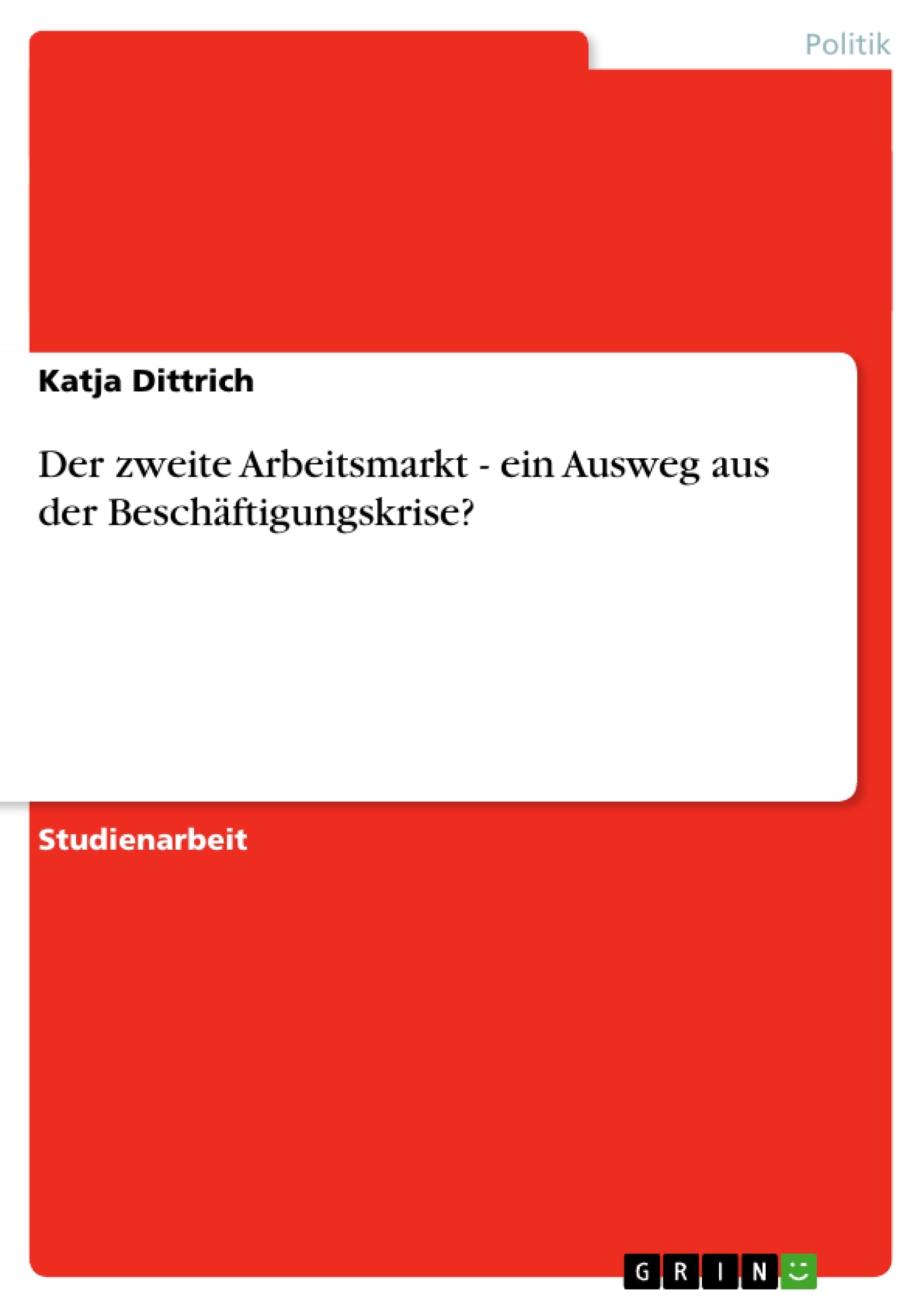Die Prognosen für die deutsche Wirtschaft und den deutschen Arbeitsmarkt sind ernüchternd: Die weltweite Wirtschaftsflaute hat dazu geführt, dass seit August 2001 die Arbeitslosenzahlen wieder über dem Stand des Vorjahres liegen und der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda, geht nach dem weitgehend ausgebliebenen Herbstaufschwung von 3,85 Millionen Erwerbslosen im Jahresdurchschnitt 2001 aus1. Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD) prognostiziert für die nächsten Monate mehr als vier Millionen Arbeitslose und es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass das Ziel von Finanzminister Hans Eichel (SPD) nicht einzuhalten ist den Bundeszuschuss für die Bundesanstalt für Arbeit im kommenden Jahr auf Null zu fahren. Aufgrund der Flaute am Arbeitsmarkt wird die Bundesanstalt für Arbeit im laufenden Jahr einen Nachschlag von 2,4 Milliarden DM benötigen.
Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit stellt in wirtschaftlicher Hinsicht eine grobe Verschleuderung der möglichen Ressourcen dar, weil ein erheblicher Anteil des Produktionsfaktors Arbeit ungenutzt bleibt und das tatsächlich realisierte Volkseinkommen beträchtlich hinter dem eigentlich möglichen Volksaufkommen zurückbleibt. Die Massenarbeitslosigkeit ist aber auch in bezug auf ihre politisch-gesellschaftlichen Konsequenzen außerordentlich bedenklich. Die Lage des Arbeitsmarktes beeinflusst in erheblichem Ausmaße die Bürger bei ihren Entscheidungen an der Wahlurne. Die Gefahr einer politischen Radikalisierung wächst mit der Zahl der vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen.
Das Selbstwertgefühl der Arbeitslosen sinkt mit zunehmender Dauer, da die Gesellschaft noch immer den moralischen Anspruch an jedes Mitglied der Gemeinschaft, hat seine individuellen Fähigkeiten in den Arbeitsprozess mit einzubringen. Die Bereitschaft zur Kriminalität steigt und das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft und Demokratie nimmt ab. Seit zwei Jahrzehnten ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland und Europa zu einem Problem geworden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt wie kein anderes gefährdet.
Im Streit über Rezepte zum Abbau der Arbeitslosigkeit sind Regierung und Opposition unterschiedlicher Meinung. Während die CDU härteres Vorgehen gegen arbeitsunwillige Erwerbslose und generell flexiblere Regelungen fordert, versucht die Regierung durch das neue „Job-Aktiv-Gesetz“, das eine Lockerung der Restriktionen für Beschäftigungsgesellschaften beinhaltet, [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Lage des Arbeitsmarktes
- 2. Definition des zweiten Arbeitsmarktes
- 3. Die Entwicklung des zweiten Arbeitsmarktes
- 4. Instrumente des zweiten Arbeitsmarktes
- 5. Argumente für den zweiten Arbeitsmarkt
- 6. Kritik am zweiten Arbeitsmarkt
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den zweiten Arbeitsmarkt in Deutschland, seine Entstehung, Entwicklung und seine Rolle im Kontext der Arbeitsmarktkrise. Sie analysiert die Wirksamkeit der Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes und diskutiert die damit verbundenen Vor- und Nachteile.
- Die Lage des deutschen Arbeitsmarktes und die Herausforderungen der Massenarbeitslosigkeit
- Definition und Eingrenzung des Begriffs "zweiter Arbeitsmarkt"
- Entwicklung und Wandel des zweiten Arbeitsmarktes im Laufe der Zeit
- Instrumente und Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes
- Kritik und kontroverse Diskussionen um den zweiten Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Lage des Arbeitsmarktes: Dieses Kapitel beschreibt die ernüchternde Lage des deutschen Arbeitsmarktes Anfang der 2000er Jahre, geprägt von hoher Arbeitslosigkeit und einer sich verschärfenden Wirtschaftsflaute. Es werden Prognosen zu steigenden Arbeitslosenzahlen präsentiert und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Massenarbeitslosigkeit, wie Ressourcenverschwendung, politische Radikalisierung und sinkendes Selbstwertgefühl der Arbeitslosen, ausführlich diskutiert. Die unterschiedlichen Positionen von Regierung und Opposition bezüglich der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit werden ebenfalls dargestellt, wobei die Notwendigkeit aktiver Arbeitsmarktpolitik hervorgehoben wird, und die zunehmende Bedeutung des zweiten Arbeitsmarktes im Kontext der Krise beleuchtet wird.
2. Definition des zweiten Arbeitsmarktes: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des zweiten Arbeitsmarktes. Aufgrund der fehlenden allgemein verbindlichen Definition wird eine Eingrenzung vorgenommen. Der zweite Arbeitsmarkt wird als Instrument zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik beschrieben, die darauf abzielt, Beschäftigung zu schaffen, welche der reguläre Arbeitsmarkt nicht bereitstellt. Es werden die Unterschiede zum ersten Arbeitsmarkt herausgearbeitet, insbesondere die öffentliche Förderung der Beschäftigung, die zeitlich befristete Natur der Arbeitsverhältnisse und die Zielgruppe (Langzeitarbeitslose und Schwervermittelbare). Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und ABS-Gesellschaften werden als integrale Bestandteile des zweiten Arbeitsmarktes identifiziert.
3. Die Entwicklung des zweiten Arbeitsmarktes: Das Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des zweiten Arbeitsmarktes nach, beginnend mit dem Ausbau der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Zuge des Arbeitsförderungsgesetzes Ende der 1960er Jahre. Es beschreibt die anfängliche Idee der präventiven Arbeitslosigkeitsbekämpfung durch Förderung von Mobilität und die steigenden Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik. Die Kapitel analysiert den Wandel vom Fokus auf Arbeitsförderung hin zu einer sozialpolitischen Instrumentalisierung mit der Folge eines Imageschadens und des dringenden Reformbedarfs. Die Reformbemühungen im Kontext des dritten Sozialgesetzbuches (SGB III) werden angesprochen, welche die Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Erweiterung der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik zum Ziel hatten.
Schlüsselwörter
Zweiter Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktpolitik, Massenarbeitslosigkeit, aktive Arbeitsmarktpolitik, passive Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABS-Gesellschaften, Deutschland, Wirtschaftsflaute, soziale Marktwirtschaft.
FAQ: Analyse des Zweiten Arbeitsmarktes in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den zweiten Arbeitsmarkt in Deutschland. Sie untersucht seine Entstehung, Entwicklung, Rolle im Kontext der Arbeitsmarktkrise, die Wirksamkeit seiner Maßnahmen und die damit verbundenen Vor- und Nachteile.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Lage des deutschen Arbeitsmarktes, die Definition und Abgrenzung des zweiten Arbeitsmarktes, seine historische Entwicklung, die Instrumente und Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes sowie die Kritik und kontroversen Diskussionen um ihn. Es werden auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Massenarbeitslosigkeit beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: 1. Die Lage des Arbeitsmarktes, 2. Definition des zweiten Arbeitsmarktes, 3. Die Entwicklung des zweiten Arbeitsmarktes, 4. Instrumente des zweiten Arbeitsmarktes, 5. Argumente für den zweiten Arbeitsmarkt, 6. Kritik am zweiten Arbeitsmarkt und 7. Zusammenfassung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel "Die Lage des Arbeitsmarktes" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die schwierige Lage des deutschen Arbeitsmarktes Anfang der 2000er Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsflaute. Es werden Prognosen zu steigenden Arbeitslosenzahlen, die Folgen der Massenarbeitslosigkeit (Ressourcenverschwendung, politische Radikalisierung, sinkendes Selbstwertgefühl) und unterschiedliche Positionen von Regierung und Opposition zur Arbeitslosigkeitsbekämpfung dargestellt. Die zunehmende Bedeutung des zweiten Arbeitsmarktes wird hervorgehoben.
Wie wird der "Zweite Arbeitsmarkt" definiert?
Da es keine allgemein verbindliche Definition gibt, wird der zweite Arbeitsmarkt in dieser Arbeit als Instrument zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik eingegrenzt. Er schafft Beschäftigung, die der reguläre Arbeitsmarkt nicht bereitstellt, und zeichnet sich durch öffentliche Förderung, befristete Arbeitsverhältnisse und die Zielgruppe Langzeitarbeitslose und Schwervermittelbare aus. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und ABS-Gesellschaften sind integrale Bestandteile.
Wie hat sich der zweite Arbeitsmarkt entwickelt?
Das Kapitel zur Entwicklung des zweiten Arbeitsmarktes verfolgt dessen Geschichte vom Ausbau aktiver Arbeitsmarktpolitik Ende der 1960er Jahre bis hin zu den Reformbemühungen im Kontext des SGB III. Es beschreibt den Wandel vom Fokus auf Arbeitsförderung hin zu einer sozialpolitischen Instrumentalisierung, den daraus resultierenden Imageschaden und den dringenden Reformbedarf. Die Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Erweiterung der Instrumente werden angesprochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Zweiter Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktpolitik, Massenarbeitslosigkeit, aktive Arbeitsmarktpolitik, passive Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABS-Gesellschaften, Deutschland, Wirtschaftsflaute, soziale Marktwirtschaft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den zweiten Arbeitsmarkt in Deutschland, seine Entstehung, Entwicklung und seine Rolle in der Arbeitsmarktkrise. Sie analysiert die Wirksamkeit der Maßnahmen und diskutiert die Vor- und Nachteile.
- Quote paper
- Katja Dittrich (Author), 2001, Der zweite Arbeitsmarkt - ein Ausweg aus der Beschäftigungskrise?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11648