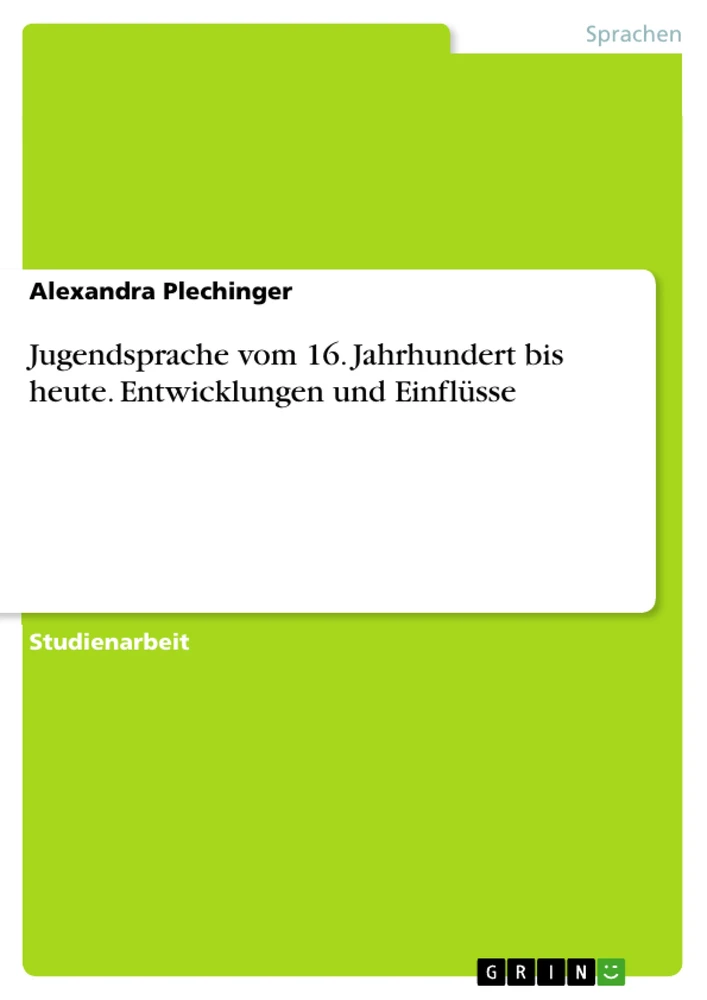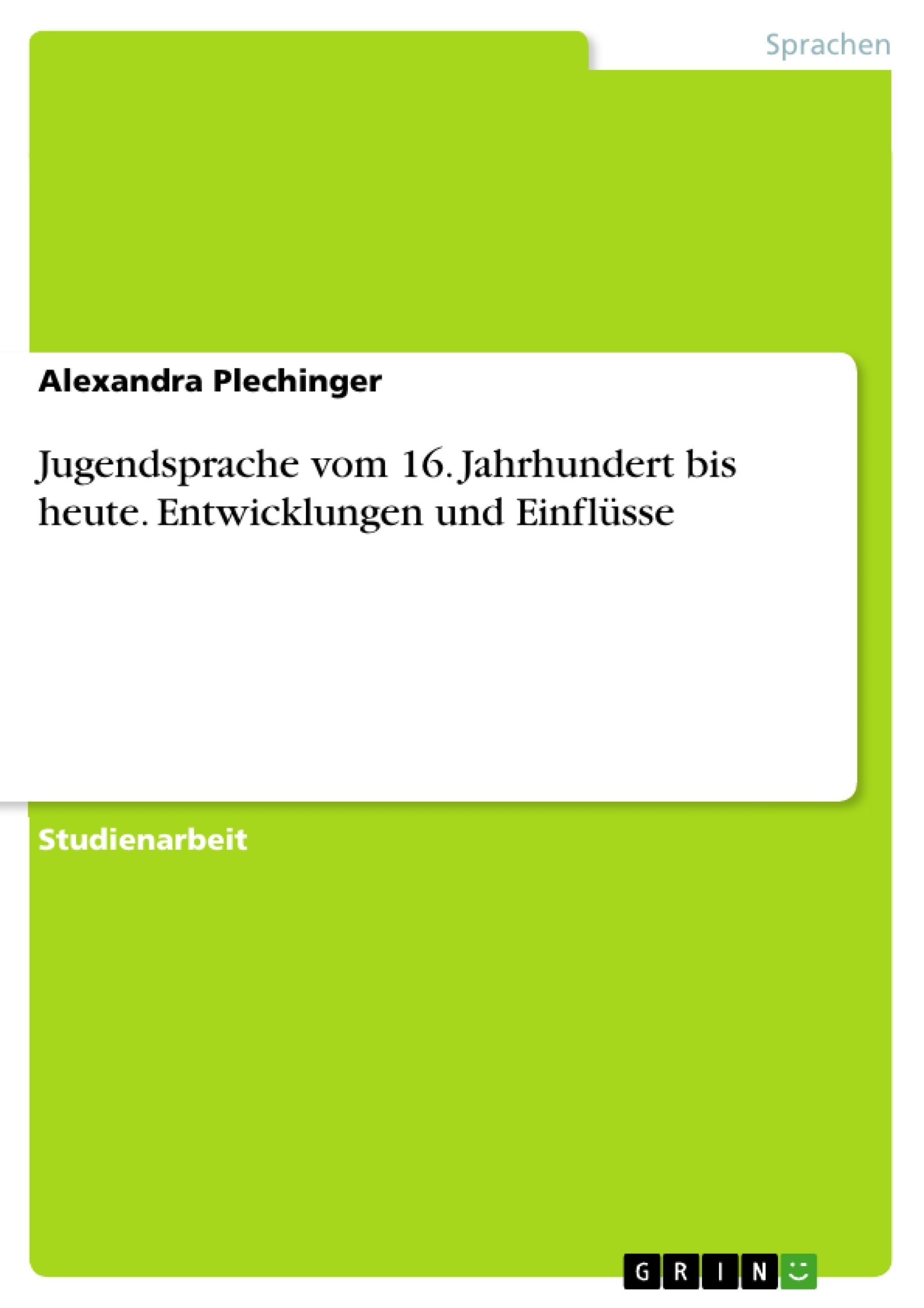Ziel dieser Seminararbeit ist es, den Wandel der fremdsprachlichen Einflüsse auf die Jugendsprache seit dem 16. Jahrhundert bis heute zu analysieren.
Jugendsprache - Wörter wie cool, YOLO oder ultrafett werden damit verbunden und viele Eltern benötigen bei einigen Ausdrücken der Sondersprache ihrer Schützlinge ein jugendsprachliches Lexikon.
Assoziationen zu diesem Begriff kommen nahezu jedem in den Sinn. Doch wie definiert man diesen genau, wenn man berücksichtigen möchte, dass Jugendsprache nicht nur ein Phänomen der heutigen, von Medien geprägten, Gesellschaft ist, sondern ein zeitübergreifendes Kontinuum darstellt?
Inhaltsverzeichnis
- Würden sich zwei von heute und früher unterhalten
- Jugendsprache
- Allgemeine Definition
- Gründe der sprachlichen Abgrenzung Jugendlicher
- Merkmale der Jugendsprache
- Jugendsprache im historischen Kontext
- Der fremdsprachliche Einfluss auf die deutsche Jugendsprache im historischen Kontext
- 16./17. Jahrhundert
- 18./19. Jahrhundert
- 20. Jahrhundert / heute
- Fazit
- Spekulative Fragen für die zukünftige deutsche Jugendsprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert den Wandel fremdsprachlicher Einflüsse auf die deutsche Jugendsprache vom 16. Jahrhundert bis heute. Zunächst werden Aspekte der Jugendsprache definiert und die Gründe für die sprachliche Abgrenzung Jugendlicher erläutert. Die Arbeit beleuchtet die Jugendsprache in ihrem historischen Kontext und untersucht den Einfluss verschiedener Sprachen auf den Jugendjargon in verschiedenen Epochen.
- Definition und Charakterisierung von Jugendsprache
- Gründe für die sprachliche Abgrenzung Jugendlicher von der Standardsprache
- Historischer Wandel der Jugendsprache
- Fremdsprachige Einflüsse auf die Jugendsprache in verschiedenen historischen Perioden
- Spekulative Ausblicke auf zukünftige Entwicklungen der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Würden sich zwei von heute und früher unterhalten: Dieses einleitende Kapitel veranschaulicht den Wandel der Jugendsprache anhand zweier fiktiver Dialoge – einer aus dem Jahr 1868 und einer aus dem Jahr 2016. Der deutliche Unterschied in der Sprache verdeutlicht die Notwendigkeit einer Analyse der historischen Entwicklung und des Einflusses fremdsprachlicher Elemente. Die Beispiele dienen als anschauliche Einleitung und motivieren die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
Jugendsprache: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Jugendsprache, eine Aufgabe, die sich als komplex erweist, da es keine einheitliche, wissenschaftlich akzeptierte Definition gibt. Der Text präsentiert drei unterschiedliche Definitionsansätze, die verschiedene Aspekte der Jugendsprache hervorheben: die Vielseitigkeit und Vergänglichkeit (Ehmann), den soziolinguistischen Aspekt der Identitätsfindung (Henne), und die Jugendsprache als alters- und soziokulturell bedingtes Phänomen (Androutsopoulos). Es werden die Schwierigkeiten einer eindeutigen Einordnung von Jugendsprache in bestehende sprachwissenschaftliche Kategorien herausgestellt, was ihre dynamische und heterogene Natur unterstreicht. Die Kapitelteile 2.2 und 2.3 befassen sich mit den Gründen der sprachlichen Abgrenzung Jugendlicher (Protest, Abgrenzung, Authentizität, Spiel, Emotionen, kommunikative Effizienz) und einigen zeitübergreifenden Merkmalen.
Jugendsprache im historischen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Wandel der Jugendsprache, insbesondere den Wechsel der Sprechergruppen im Laufe der Jahrhunderte. Es wird deutlich, dass die Studenten lange Zeit die Hauptvertreter der Jugendsprache waren, bevor sich im 20. Jahrhundert die jugendsprachliche Gruppe deutlich erweiterte. Dieser historische Überblick dient als Grundlage für die Analyse der fremdsprachlichen Einflüsse in den folgenden Kapiteln.
Der fremdsprachliche Einfluss auf die deutsche Jugendsprache im historischen Kontext: Dieses Kapitel, der Hauptteil der Arbeit, analysiert den Einfluss von Fremdsprachen auf die deutsche Jugendsprache in drei historischen Abschnitten (16./17., 18./19., und 20. Jahrhundert/heute). Für jeden Abschnitt werden die einflussnehmenden Sprachen, die Gründe für den Einfluss und die Auswirkungen auf den Jugendjargon detailliert untersucht. Die Analyse zeigt die stete Veränderung der Einflüsse und die Anpassung der Jugendsprache an gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen. Das Kapitel schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachwandel, Fremdsprachen, historische Linguistik, Soziolinguistik, Identitätsfindung, Abgrenzung, Sprachvariation, Jugendkultur, historischer Kontext, Lexik, Semantik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Fremdsprachige Einflüsse auf die deutsche Jugendsprache"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den Wandel fremdsprachlicher Einflüsse auf die deutsche Jugendsprache vom 16. Jahrhundert bis heute. Sie untersucht, wie verschiedene Sprachen den Jugendjargon in unterschiedlichen Epochen beeinflusst haben und welche Faktoren diesen Einfluss geprägt haben.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakterisierung von Jugendsprache, Gründe für die sprachliche Abgrenzung Jugendlicher von der Standardsprache, historischer Wandel der Jugendsprache, fremdsprachige Einflüsse auf die Jugendsprache in verschiedenen historischen Perioden (16./17. Jahrhundert, 18./19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert/Heute) und spekulative Ausblicke auf zukünftige Entwicklungen der Jugendsprache.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung mit fiktiven Dialogen zur Veranschaulichung des Sprachwandels, ein Kapitel zur Definition und den Merkmalen der Jugendsprache, ein Kapitel zum historischen Wandel der Jugendsprache, ein Hauptkapitel zur Analyse fremdsprachlicher Einflüsse in verschiedenen historischen Perioden und abschließend ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Definitionen von Jugendsprache werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert drei verschiedene Definitionsansätze von Jugendsprache: die Vielseitigkeit und Vergänglichkeit (Ehmann), den soziolinguistischen Aspekt der Identitätsfindung (Henne), und die Jugendsprache als alters- und soziokulturell bedingtes Phänomen (Androutsopoulos). Die Arbeit hebt die Komplexität und die fehlende einheitliche Definition hervor.
Welche Gründe für die sprachliche Abgrenzung Jugendlicher werden diskutiert?
Die Arbeit nennt verschiedene Gründe für die sprachliche Abgrenzung Jugendlicher, darunter Protest, Abgrenzung, Authentizität, Spiel, Emotionen und kommunikative Effizienz.
Wie wird der historische Wandel der Jugendsprache dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Wandel, insbesondere den Wechsel der Sprechergruppen im Laufe der Jahrhunderte. Es wird gezeigt, dass Studenten lange Zeit die Hauptvertreter waren, bevor sich im 20. Jahrhundert die jugendsprachliche Gruppe deutlich erweiterte.
Wie werden fremdsprachige Einflüsse analysiert?
Der Einfluss von Fremdsprachen wird in drei historischen Abschnitten (16./17., 18./19., und 20. Jahrhundert/heute) detailliert untersucht. Für jeden Abschnitt werden die einflussnehmenden Sprachen, die Gründe für den Einfluss und die Auswirkungen auf den Jugendjargon analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Sprachwandel, Fremdsprachen, historische Linguistik, Soziolinguistik, Identitätsfindung, Abgrenzung, Sprachvariation, Jugendkultur, historischer Kontext, Lexik, Semantik.
Gibt es einen Ausblick auf die Zukunft der deutschen Jugendsprache?
Ja, die Arbeit enthält ein Kapitel mit spekulativen Fragen und Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung der deutschen Jugendsprache.
- Quote paper
- Alexandra Plechinger (Author), 2018, Jugendsprache vom 16. Jahrhundert bis heute. Entwicklungen und Einflüsse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1163307