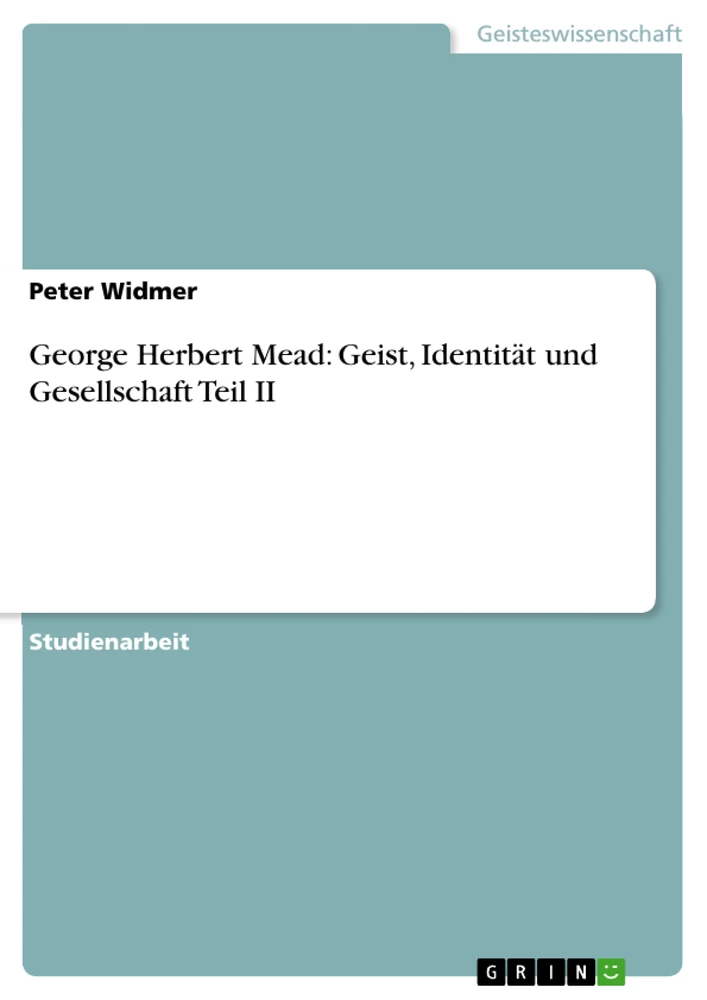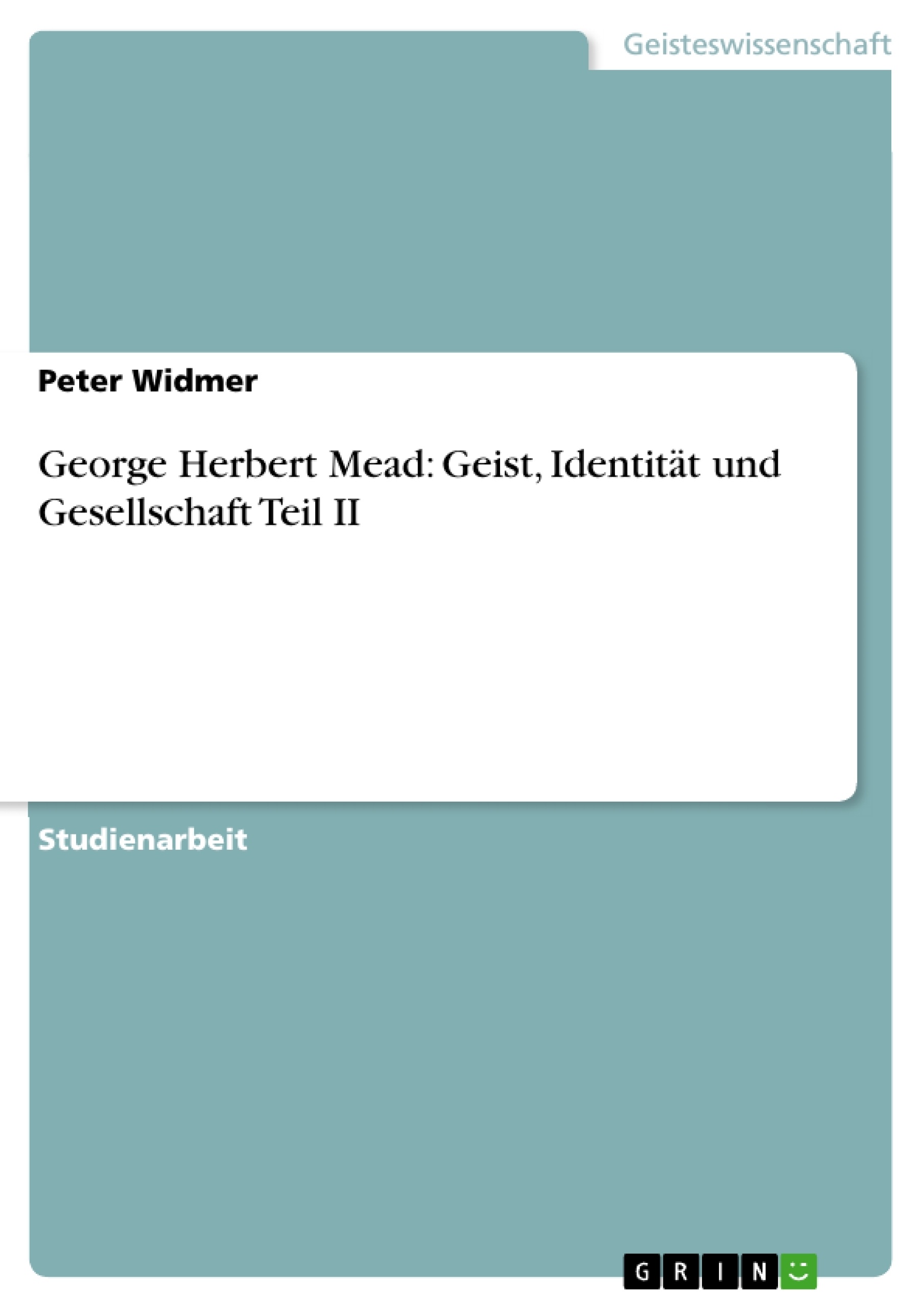Die Sozialpsychologie beschäftigt sich traditionellerweise mit der Untersuchung der gesellschaftlichen Erfahrung aus der Sicht der Individualpsychologie. Das gesellschaftliche Ganze wird dabei von der Psychologie des Individuums aus gedeutet.
Mead fragt nach der Rechtmässigkeit dieses Ansatzes und erkennt, dass die Psychologie des Individuums selbst Produkt gesellschaftlicher Prozesse ist. Sozialpsychologie kann folglich nicht beim Individuum, sondern muss vielmehr von gesellschaftlichen Prozessen ausgehen. Daher sieht Mead die Aufgabe der Sozialpsychologie darin, den Einfluss gesellschaftlicher Erfahrung auf Erfahrung und Verhalten des Einzelnen zu klären. Die konkrete Frage des II. Teiles, den wir im folgenden behandeln, lautet daher, wie psychisches Wissen - d.h. Geist, Bewusstsein, Denken überhaupt - als gesellschaftliche Phänomene begriffen werden kann.
Mead steht in der Tradition der Evolutionstheorie Darwins und untersucht die Entstehung des Psychischen, von Geist, anhand der Entwicklung gesellschaftlichen Verhaltens im Laufe der Evolution. Mead versucht, ein entscheidendes Problem der Evolutionstheorie mit behavioristischen Mitteln zu lösen: er versuch die Kluft zwischen Impuls und Rationalität, zwischen Instinkt und Bewusstsein zu überbrücken und nachzuweisen, wie gewisse Organismen Geist, zweckgebundenes Verhalten und moralisches Engagement entwickeln. Kurz: er versucht zu klären, wie das vernunftbegabte Wesen "Mensch" entstand (vgl. S. 16, Einleitung von Morris).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Behavioristische Sozialpsychologie
- Die Frage
- Die Methode
- Die Geste
- Die Geste als Ausgangspunkt
- Zwei Grundfunktionen der Geste
- Die "Reiz"-Funktion der Geste
- Darwin
- Die "Anpassungsfunktion" der Geste
- Der Ursprung der Sprache
- Wundts psycho-physischer Parallelismus
- Nachahmung
- Lernen ist assoziativ
- Unmöglichkeit eines Nachahmungs-Mechanismus
- Der grundlegende Fehler
- Die vokale Geste
- Die Defizienz der Geste
- Die Bedeutung der vokalen Geste
- Exklamatorische Töne, Zeichen und Schrift
- Anthropologische Grundkategorie: Die "Rolle des Anderen"
- Das signifikante Symbol
- Sinn (meaning)
- Sinn als Produkt einer dreiseitigen Beziehung
- Merkmale
- Objektivität auf der Grundlage einer "natürlichen" Teleologie
- Die gesellschaftliche Handlung als Ursprung des Neuen
- Immanenz
- Universalität
- Die Reaktion ist universal, der Reiz partikular (James)
- Der Ursprung von Begriffen
- Deweys "handelnde" Wahrnehmung
- Begriffe sind gesellschaftlich vermittelt
- Der "verallgemeinerte Andere"
- Eine gemeinsame Welt als Produkt gemeinsamer Erfahrung
- Reflexive Intelligenz/Denken
- Intuitives Verhalten
- Reflexives Verhalten
- Reflexives Verhalten - ein Beispiel
- Merkmale
- Hinweisendes Verhalten
- Willentliche Aufmerksamkeit
- Sprache als "Material des Geistes"
- Wahl, Spontaneität, Grundbedingung und Anpassung
- Eine behavioristische Freiheitstheorie: Reflexive Wahl und Spontaneität
- Der Ursprung der verzögerten Reaktion
- Bester Anpassungsmechanismus?
- Selbstkonditionierung und bedingter Reflex
- Watson: Der bedingte Reflex
- Defizienz
- Bewusste Selbstkonditionierung
- Das Verhältnis von Reaktion, Symbol, Geist und Umwelt
- Reaktion und Umwelt
- Geist, Symbol und Umwelt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der zweite Teil des Buches „Geist, Identität und Gesellschaft“ von G.H. Mead untersucht die Entstehung des Psychischen, von Geist und Bewusstsein, anhand der Entwicklung gesellschaftlichen Verhaltens im Laufe der Evolution. Mead setzt sich mit dem Problem auseinander, wie die Kluft zwischen Impuls und Rationalität, zwischen Instinkt und Bewusstsein, überbrückt werden kann und wie gewisse Organismen Geist, zweckgebundenes Verhalten und moralisches Engagement entwickeln.
- Die Rolle der Geste in der gesellschaftlichen Handlung
- Der Ursprung der Sprache und das signifikante Symbol
- Die Entstehung von Sinn (meaning) als Produkt einer dreiseitigen Beziehung
- Die Bedeutung des "verallgemeinerten Anderen" für die Entwicklung von Begriffen und einer gemeinsamen Welt
- Reflexives Verhalten und die Entstehung von Bewusstsein
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Grundannahmen der behavioristischen Sozialpsychologie dar, die sich nicht vom Individuum aus, sondern von gesellschaftlichen Prozessen herleitet. Die konkrete Frage des zweiten Teils ist, wie psychisches Wissen - Geist, Bewusstsein, Denken - als gesellschaftliche Phänomene begriffen werden kann. Meads Ansatz ist evolutionstheoretisch und versucht, die Entstehung des Psychischen mit behavioristischen Mitteln zu erklären, indem er die Kluft zwischen Impuls und Rationalität überbrückt.
Die Geste
Mead sieht in der Geste die Grundlage jeder gesellschaftlichen Handlung und Kommunikation. Die Geste hat zwei Grundfunktionen: Sie wirkt als Reiz auf andere Wesen und dient als Werkzeug für die Anpassung an ein Objekt von gemeinsamem Interesse. Mead widerlegt Darwins Theorie, dass Gesten primär Gefühle ausdrücken, indem er argumentiert, dass Gesten Bewusstsein voraussetzen.
Der Ursprung der Sprache
Mead kritisiert Wundts Theorie des psycho-physischen Parallelismus, die die Entstehung der Sprache auf eine Assoziation zwischen physischen Reizen und psychischen Bewusstseinsinhalten zurückführt. Ebenso widerlegt er die These, dass Nachahmung der Schlüssel zur Entstehung von Bewusstsein ist. Er argumentiert, dass Sprache aus der vokalen Geste entsteht, die eine Defizienz der nichtsprachlichen Geste überwindet und ein gemeinsames Verständnis zwischen Individuen ermöglicht.
Sinn (meaning)
Sinn entsteht als Produkt einer dreiseitigen Beziehung zwischen dem handelnden Individuum, dem Objekt der Handlung und der Reaktion des anderen Individuums. Mead beschreibt die Merkmale von Sinn als Objektivität, gesellschaftliche Handlung als Ursprung des Neuen und Immanenz.
Universalität
Mead argumentiert, dass die Reaktion auf einen Reiz universal ist, während der Reiz selbst partikular ist. Der Ursprung von Begriffen liegt in der gesellschaftlich vermittelten Erfahrung, wobei der "verallgemeinerte Andere" eine wichtige Rolle spielt.
Reflexive Intelligenz/Denken
Mead unterscheidet zwischen intuitivem und reflexivem Verhalten. Reflexives Verhalten ist durch Hinweisendes Verhalten, willentliche Aufmerksamkeit und die Verwendung von Sprache als "Material des Geistes" gekennzeichnet. Es ermöglicht eine bewusste Wahl und Spontaneität, die als ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Bewusstseins betrachtet wird.
Selbstkonditionierung und bedingter Reflex
Mead diskutiert Watsons Theorie des bedingten Reflexes und zeigt seine Defizienz auf. Er argumentiert, dass bewusste Selbstkonditionierung eine wichtige Rolle in der Entwicklung des menschlichen Verhaltens spielt.
Das Verhältnis von Reaktion, Symbol, Geist und Umwelt
Das Kapitel untersucht das Verhältnis zwischen Reaktion, Symbol, Geist und Umwelt. Mead argumentiert, dass die Umwelt durch die Reaktion des Individuums gestaltet wird und dass Symbole eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Geistes spielen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Buches sind: Verhalten, Geste, Sprache, Sinn, Bewusstsein, Reflexion, Selbstkonditionierung, "verallgemeinerter Anderer", gesellschaftliche Handlung, Interaktion, Kommunikation.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Peter Widmer (Autor:in), 1990, George Herbert Mead: Geist, Identität und Gesellschaft Teil II, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/116230