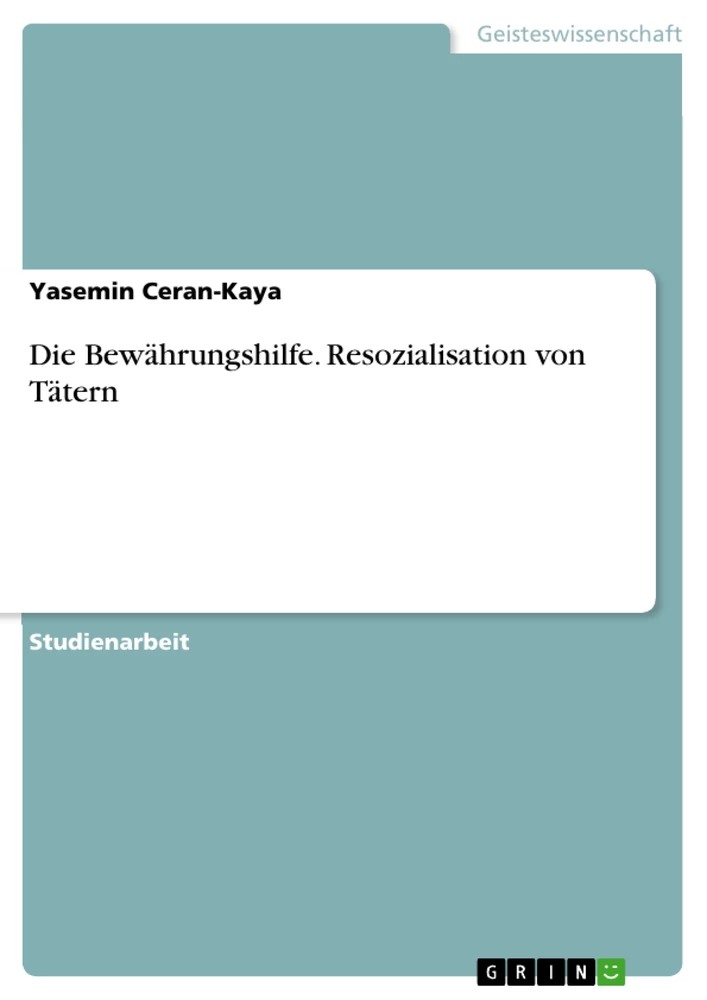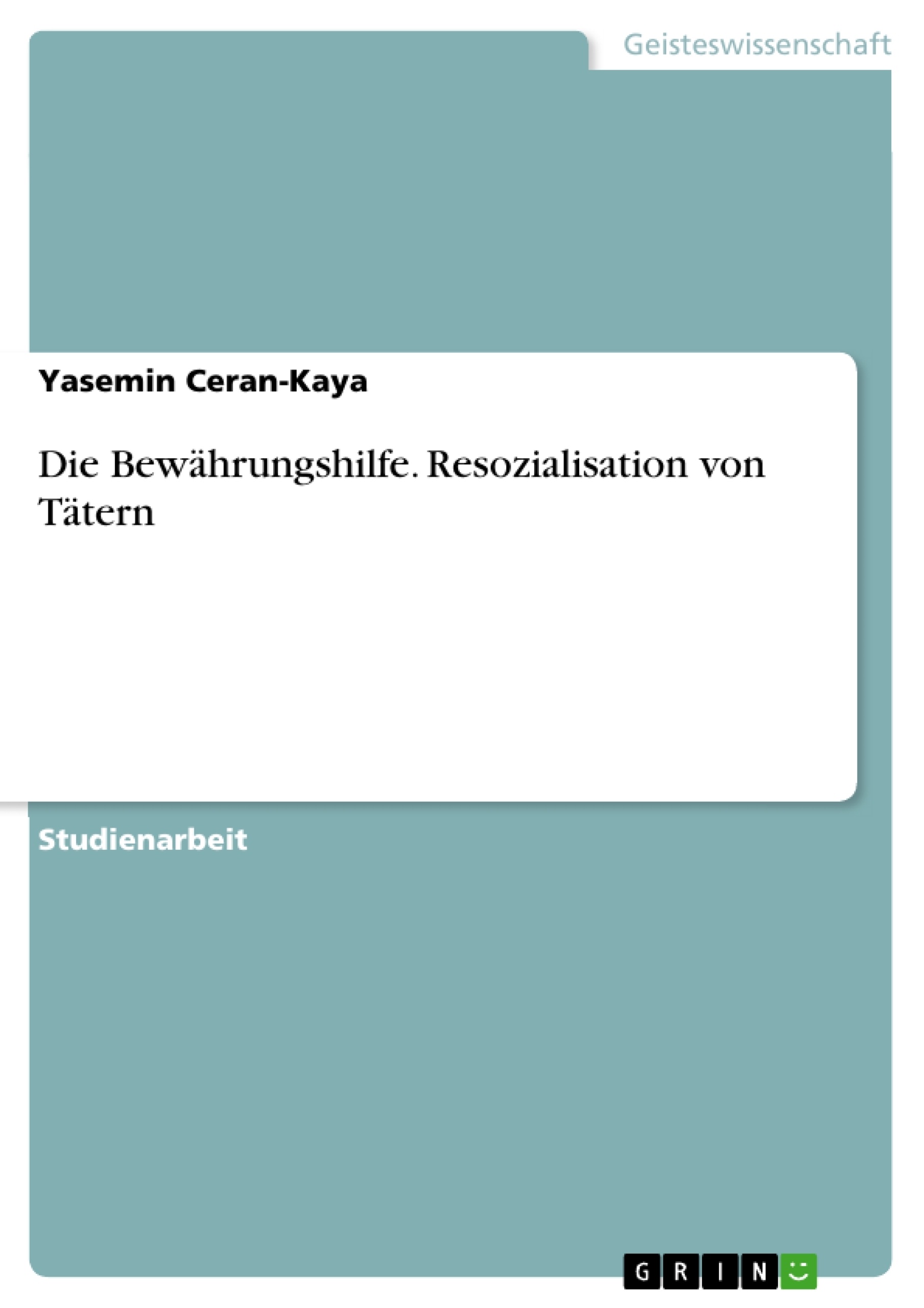Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Handlungsfeld Bewährungshilfe in der Sozialen Arbeit und versucht, diese unter verschiedenen Aspekten besser zu verstehen.
Die Soziale Arbeit ist in den verschiedensten Bereichen zu finden, sodass ihre Handlungsfelder breit gefächert sind. Auch in der Strafrechtspflege hat die Soziale Arbeit ihren Einzug bereits hinter sich und ist im Rahmen der Straffälligenhilfe in verschiedenen Arbeitsbereichen vertreten.
Neben der Gerichtshilfe und den sozialen Diensten im Strafvollzug ist die Bewährungshilfe seit Mitte der 1950er Jahre ein fester Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Die Bewährungshilfe stellt einen Schnittpunkt zwischen der Kriminalpolitik und der Sozialen Arbeit dar.
Auch entsteht der Eindruck einer klaren Arbeitsteilung, die in der Praxis jedoch nicht immer deutlich wird. Sichtbar wird jedoch ein Paradigmenwechsel, in der sich die Kriminalpolitik von der Repression der Täter abgewandt hat und den Fokus auf eine straffreie Zukunft durch Prävention und Aufsicht legt. Wurden Straffällige in früheren Zeiten noch repressiv sanktioniert und weggesperrt, fand im Laufe der Zeit eine Entwicklung statt, in dem Straffälligen neue Perspektiven angeboten wurden.
Erhält ein Angeklagter eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, kann diesem ein Bewährungshelfer zugestellt werden. Ziel hierbei ist insbesondere die Rückfallprävention und Resozialisierung der Täter. Die Bewährungshilfe soll somit einen wichtigen Beitrag für die Resozialisierung von Tätern und ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft ohne weitere Straftaten ermöglichen.
Doch inwieweit ist dieses Ziel mithilfe der Bewährungshilfe realisierbar? Mit welchen Methoden wird dieses Ziel angestrebt? Wo und wie wird die Soziale Arbeit innerhalb der Justiz verortet und welche Möglichkeiten hat sie?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte und Entwicklung der Bewährungshilfe
- 2.1 Strafen als gesellschaftliche Norm
- 2.2 Wandel der Straflegitimationen und sozialpolitische Einflüsse
- 3. Organisation der Bewährungshilfe
- 3.1 Juristischer Rahmen der Bewährung
- 3.2 Gesetzliche Grundlagen der Bewährungshilfe
- 3.3 Trägerstrukturen
- 3.4 Finanzierung
- 4. Methodisches Handeln in der Bewährungshilfe
- 4.1 Fallbelastung und Einzelfallhilfe
- 4.2 Das Doppelmandat zwischen Beratung und Anweisung
- 4.3 Das Problem der Schweigepflicht
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Handlungsfeld der Bewährungshilfe in der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, die Bewährungshilfe aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und ein besseres Verständnis für ihre Funktionsweise zu entwickeln. Die Arbeit analysiert die Geschichte und Entwicklung, die Organisation und die methodischen Vorgehensweisen der Bewährungshilfe.
- Geschichte und Entwicklung der Bewährungshilfe
- Juristischer und organisatorischer Rahmen der Bewährungshilfe
- Methoden des professionellen Handelns in der Bewährungshilfe
- Das Spannungsfeld zwischen Beratung und Kontrolle (Doppelmandat)
- Herausforderungen und Probleme in der Bewährungshilfe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bewährungshilfe als Schnittpunkt zwischen Kriminalpolitik und Sozialer Arbeit ein. Sie hebt den Paradigmenwechsel von repressiven Strafmaßnahmen hin zu präventiven und aufsichtsorientierten Maßnahmen hervor und stellt zentrale Forschungsfragen nach der Realisierbarkeit der Ziele der Bewährungshilfe, den angewandten Methoden und der Verortung Sozialer Arbeit innerhalb der Justiz. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Forschungsstrategie.
2. Geschichte und Entwicklung der Bewährungshilfe: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Bewährungshilfe, beginnend mit frühen Formen der Gefangenenfürsorge bis hin zu ihrer heutigen Ausgestaltung. Es beschreibt den Wandel der Strafformen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, die sich verändernde gesellschaftliche Einstellung gegenüber Straftätern und die damit verbundenen Herausforderungen für die Resozialisierung. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Aufklärung und des Humanismus auf das Strafrecht und die Entstehung der Bewährungshilfe als Reaktion auf die sozialen Folgen der Freiheitsstrafe.
3. Organisation der Bewährungshilfe: Hier wird der rechtliche und organisatorische Rahmen der Bewährungshilfe detailliert beschrieben. Es werden die gesetzlichen Grundlagen, die Trägerstrukturen und die Finanzierung der Bewährungshilfe erläutert, um die institutionellen Gegebenheiten dieses Handlungsfeldes darzustellen und zu analysieren.
4. Methodisches Handeln in der Bewährungshilfe: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Methoden der Sozialen Arbeit innerhalb der Bewährungshilfe. Es untersucht die Aufgaben der Bewährungshelfer, die Methoden zur Erreichung der Ziele und die Herausforderungen des „Doppelmandats“, d.h. des Spagats zwischen Beratung und Anweisung. Der Umgang mit Konflikten zwischen Proband und Bewährungshelfer wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bewährungshilfe, Soziale Arbeit, Kriminalpolitik, Resozialisierung, Rückfallprävention, Doppelmandat, Strafrecht, Prävention, Aufsicht, Methoden der Sozialen Arbeit, Gefangenenfürsorge, Stigmatisierung, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Handbuch der Bewährungshilfe
Was ist der Inhalt dieses Handbuchs?
Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über die Bewährungshilfe. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Geschichte, Organisation und den methodischen Vorgehensweisen der Bewährungshilfe im Kontext der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst das Handbuch?
Das Handbuch gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Geschichte und Entwicklung der Bewährungshilfe, Organisation der Bewährungshilfe, Methodisches Handeln in der Bewährungshilfe und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, von den historischen Wurzeln bis hin zu den aktuellen Herausforderungen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Handbuch?
Das Handbuch zielt darauf ab, die Bewährungshilfe aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und ein besseres Verständnis ihrer Funktionsweise zu ermöglichen. Es analysiert die Geschichte, Organisation und Methoden der Bewährungshilfe und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Kriminalpolitik und Sozialer Arbeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themenschwerpunkte sind die Geschichte und Entwicklung der Bewährungshilfe, der juristische und organisatorische Rahmen, die Methoden des professionellen Handelns, das Spannungsfeld zwischen Beratung und Kontrolle (Doppelmandat) und die Herausforderungen und Probleme in der Bewährungshilfe.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema Bewährungshilfe als Schnittstelle zwischen Kriminalpolitik und Sozialer Arbeit ein. Sie beschreibt den Paradigmenwechsel von repressiven zu präventiven Maßnahmen und stellt zentrale Forschungsfragen.
Worum geht es im Kapitel zur Geschichte und Entwicklung der Bewährungshilfe?
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Bewährungshilfe von den frühen Formen der Gefangenenfürsorge bis zur heutigen Ausgestaltung. Es beschreibt den Wandel der Strafformen und die sich verändernde gesellschaftliche Einstellung gegenüber Straftätern.
Was wird im Kapitel zur Organisation der Bewährungshilfe erläutert?
Hier wird der rechtliche und organisatorische Rahmen detailliert beschrieben, einschließlich der gesetzlichen Grundlagen, Trägerstrukturen und Finanzierung.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zum methodischen Handeln in der Bewährungshilfe?
Dieses Kapitel untersucht die Methoden der Sozialen Arbeit in der Bewährungshilfe, die Aufgaben der Bewährungshelfer, die Methoden zur Zielerreichung und die Herausforderungen des Doppelmandats (Beratung und Anweisung).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Handbuch?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bewährungshilfe, Soziale Arbeit, Kriminalpolitik, Resozialisierung, Rückfallprävention, Doppelmandat, Strafrecht, Prävention, Aufsicht, Methoden der Sozialen Arbeit, Gefangenenfürsorge, Stigmatisierung und Integration.
- Quote paper
- Yasemin Ceran-Kaya (Author), 2018, Die Bewährungshilfe. Resozialisation von Tätern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1151618