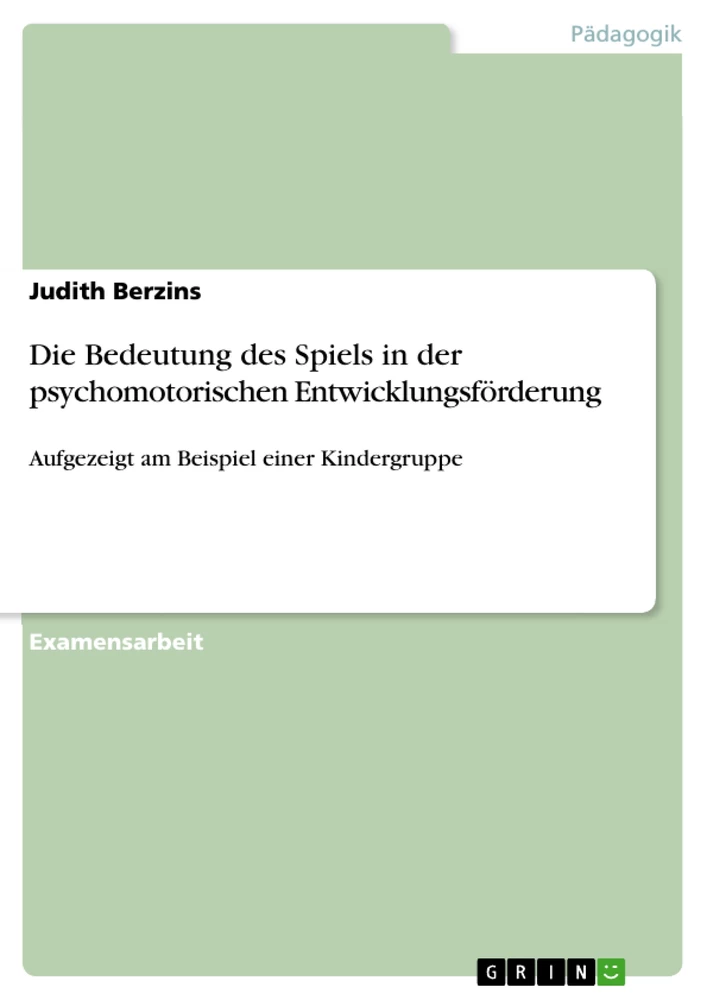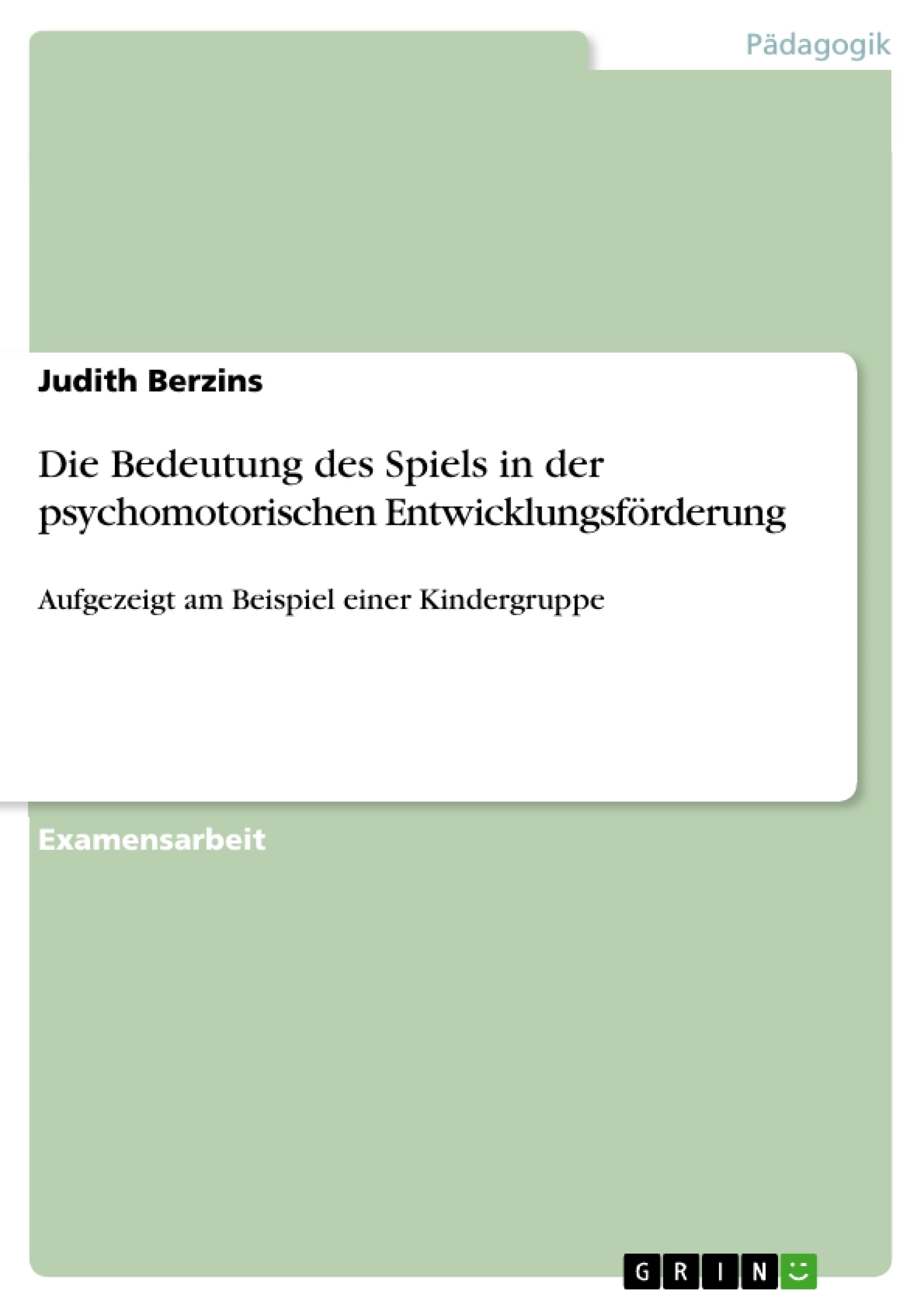Mein Interesse für die Psychomotorik wurde in Seminaren der Hochschule geweckt. Die sehr viel Freude bringende Praxis und die verschiedenen Ansätze der Theorie machten mich aufmerksam. Die Methoden der psychomotorischen Entwicklungsförderung begegnen einem zurzeit häufiger in Kindergärten, Schulen oder Einrichtungen für Kinder. Sei es ein Rollbrett oder ein Abendteuer-Spielplatz für den Kindergarten. Aber ist das schon Psychomotorik? Wieso heißt es nicht einfach Bewegungsförderung oder Spaß an der Bewegung? Durch die Beschreibung verschiedener Ansätze der Psychomotorik sollen die Grundfragen geklärt werden.
Begründet ist die psychomotorische Entwicklungsförderung in der Psychomotorischen Übungsbehandlung von ERNST JONNY KIPHARD. Als erstes gehe ich auf die allgemeinen Prinzipien und Merkmale näher ein, danach auf KIPHARDs Ansatz, wobei ich hier die geschichtliche Entwicklung mit einfließen lasse. Eine weitere Theorie ist der Kindzentrierte Ansatz von RENATE ZIMMER. Als dritter scheint mir der Verstehende Ansatz von JÜRGEN SEEWALD bedeutsam.
Dann die Frage nach dem Spiel. Niemand wird bestreiten, dass spielen für Kinder wichtig ist. Aber gibt es auch eine Theorie dazu? Viele Psychologen und Pädagogen der letzten Jahrhunderte haben sich schon Gedanken über das Spiel gemacht. Es bleibt immer noch aktuell. Das Spiel an sich begegnet jedem von uns in verschiedenen Lebensbereichen. Ich möchte die Meinungen einiger Autoren wie SCHILLER, HUIZINGA und PIAGET reflektieren, die für die Psychomotorik relevante Aspekte nennen. Ein Punkt meiner Ausführung soll dabei der Frage nachgehen, welche Faktoren das Spiel heutzutage behindern und Kinder dabei aufhalten, frei zu spielen.
Nach der Darstellung mehr historischer Gedanken zum Spiel werde ich dann auf das Spiel in der Psychomotorik eingehen. Einige Vorschläge und Anregungen von ZIMMER und BEINS werden diskutiert. Im dritten Teil dieses Kapitels beschreibe ich noch weitere Möglichkeiten des Spiels für die Psychomotorik und wie diese eingesetzt werden können. Allerdings beschränke ich mich hierbei auf Arbeitsfelder mit Kindern im Elementarbereich.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Begründung des Themas
- 2 Psychomotorische Grundsätze und Konzepte
- 2.1 Allgemeine Prinzipien
- 2.1.1 Körper-, Material- und Sozialerfahrung
- 2.1.2 Didaktische Grundsätze in der Psychomotorik
- 2.1.3 Die Persönlichkeit des Psychomotorikers und die Rolle der Erwachsenen
- 2.1.4 Rahmenbedingungen der Förderung
- 2.2 Die Psychomotorische Übungsbehandlung nach KIPHARD und ihre Entwicklung
- 2.3 Der Kindzentrierte Ansatz nach ZIMMER
- 2.4 Der Verstehende Ansatz nach SEEWALD
- 2.1 Allgemeine Prinzipien
- 3 Das Spiel
- 3.1 Allgemeine Merkmale des Spiels
- 3.1.1 HUIZINGA (1872-1945)
- 3.1.2 SCHEUERL (*1919)
- 3.2 Verschiedene Vertreter und ihre Theorien
- 3.2.1 SCHILLER (1759 - 1805)
- 3.2.2 FRÖBEL (1782-1852)
- 3.2.3 PIAGET (1896-1980)
- 3.2.4 KRAPPMANN (*1936)
- 3.3 Was behindert das Spiel heutzutage?
- 3.4 Verschiedene Typen des Spiels
- 3.4.1 Sensomotorische Spiele (Spiele mit etwas)
- 3.4.2 Symbolspiel (Spiel als etwas)
- 3.4.3 Regelspiel (Spielen um etwas)
- 3.4.4 Lernspiel
- 3.1 Allgemeine Merkmale des Spiels
- 4 Das Spiel in der Psychomotorik
- 4.1 ZIMMER
- 4.1.1 Rahmenbedingungen für das Spiel
- 4.1.2 Das Symbolspiel
- 4.1.3 Das sinnvolle Kinderspiel
- 4.2 BEINS
- 4.2.1 Verschiedene Spiele
- 4.2.2 Allgemeine Merkmale
- 4.2.3 Kindergarten
- 4.3 Weitere Möglichkeiten des Spiels in der Psychomotorik
- 4.3.1 Das Spiel als Therapie
- 4.3.2 Spiele im Wasser
- 4.3.3 Tischspiele
- 4.3.4 Spiele an Automaten
- 4.1 ZIMMER
- 5 Die Kindergruppe
- 5.1 Rahmenbedingungen
- 5.1.1 Institutionelle Voraussetzungen
- 5.1.2 Räumlichkeiten und Ausstattung
- 5.1.3 Anthropologische Voraussetzungen
- 5.1.4 Ablauf und Prinzipien der Stunden
- 5.2 Einzelne bedeutungsvolle Situationen
- 5.2.1 Das „Ungeheuer“ Ismet
- 5.2.2 Spiele auf dem Trampolin
- 5.2.3 Spiele mit Wasser
- 5.2.4 Bewegungslandschaft „Dschungel“
- 5.2.5 Bewegungslandschaft „Wiese“
- 5.2.6 Markus und Simon
- 5.3 Einordnung der Stunden in psychomotorische Theorien
- 5.4 Auswirkungen der Förderung auf das Verhalten der Kinder
- 5.1 Rahmenbedingungen
- 6 Reflexion und konstruktive Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Entwicklungsförderung. Ziel ist es, verschiedene theoretische Ansätze der Psychomotorik zu beleuchten und deren Anwendung anhand einer konkreten Kindergruppe zu veranschaulichen. Die Arbeit soll aufzeigen, wie das Spiel in die Praxis der psychomotorischen Förderung integriert werden kann und welche positiven Auswirkungen dies auf die Entwicklung der Kinder hat.
- Theoretische Grundlagen der Psychomotorik
- Verschiedene Spieltheorien und deren Relevanz für die Psychomotorik
- Praktische Umsetzung des Spiels in der psychomotorischen Förderung
- Auswirkungen des Spiels auf die Entwicklung der Kinder
- Reflexion der praktischen Anwendung und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Begründung des Themas: Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Entwicklungsförderung. Ausgehend vom persönlichen Interesse der Autorin an der Psychomotorik, werden grundlegende Fragen zur Abgrenzung von Bewegungsförderung und Psychomotorik geklärt. Es werden die theoretischen Ansätze von Kiphard, Zimmer und Seewald vorgestellt und die Bedeutung des Spiels in diesem Kontext herausgestellt. Die Arbeit analysiert verschiedene Spieltheorien, Faktoren, die das freie Spiel behindern und Möglichkeiten zur Anwendung des Spiels in der Psychomotorik, speziell im Elementarbereich.
2 Psychomotorische Grundsätze und Konzepte: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden allgemeine Prinzipien der Psychomotorik wie Körper-, Material- und Sozialerfahrung sowie didaktische Grundsätze erläutert. Die Rolle des Erwachsenen und die Rahmenbedingungen der Förderung werden ebenso beleuchtet wie die Ansätze von Kiphard, Zimmer und Seewald. Jeder Ansatz wird detailliert beschrieben, seine Prinzipien erklärt und seine Bedeutung für die praktische Arbeit herausgestellt. Die Kapitel veranschaulicht die verschiedenen Perspektiven und Methoden innerhalb der Psychomotorik.
3 Das Spiel: Dieses Kapitel widmet sich umfassend dem Phänomen des Spiels. Es werden die allgemeinen Merkmale des Spiels nach Huizinga und Scheuerl analysiert und verschiedene Spieltheorien von Schiller, Fröbel, Piaget und Krappmann vorgestellt und miteinander verglichen. Die jeweiligen Beiträge werden auf ihre Relevanz für die psychomotorische Entwicklungsförderung hin untersucht. Zusätzlich wird die Frage aufgeworfen, welche Faktoren das freie Spiel von Kindern heutzutage behindern. Verschiedene Spieltypen, wie sensomotorische Spiele, Symbolspiele, Regelspiele und Lernspiele werden differenziert dargestellt.
4 Das Spiel in der Psychomotorik: Dieses Kapitel verbindet die theoretischen Überlegungen zu Spiel und Psychomotorik. Es werden konkrete Vorschläge und Anregungen von Zimmer und Beins zur Integration des Spiels in die psychomotorische Praxis diskutiert. Die verschiedenen Möglichkeiten des Spiels in der Psychomotorik werden im Elementarbereich beschrieben. Der Fokus liegt dabei auf der konkreten Umsetzung und der Bedeutung des Spiels für die Entwicklung der Kinder. Es werden Beispiele aus verschiedenen Arbeitsfeldern gegeben, die die Vielseitigkeit des Spiels in der psychomotorischen Förderung verdeutlichen.
5 Die Kindergruppe: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie, in der die Autorin die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Förderung an einer konkreten Kindergruppe veranschaulicht. Es werden verschiedene Situationen aus der Praxis beschrieben, in denen das Spiel eine zentrale Rolle spielte. Die Autorin analysiert die Rahmenbedingungen der Gruppe, besonders wichtige Situationen und ordnet diese in den Kontext der vorgestellten psychomotorischen Theorien ein. Die Auswirkungen der Förderung auf das Verhalten der Kinder werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Psychomotorik, Spiel, Entwicklungsförderung, Kinder, Körpererfahrung, Sozialerfahrung, Kiphard, Zimmer, Seewald, Spieltheorien, praktische Umsetzung, Fallstudie, Elementarbereich.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Spiel in der Psychomotorik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Entwicklungsförderung von Kindern im Elementarbereich. Sie beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze der Psychomotorik und veranschaulicht deren Anwendung anhand einer konkreten Fallstudie mit einer Kindergruppe.
Welche theoretischen Ansätze der Psychomotorik werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ansätze von Kiphard, Zimmer und Seewald. Allgemeine Prinzipien der Psychomotorik wie Körper-, Material- und Sozialerfahrung sowie didaktische Grundsätze werden erläutert. Die Rolle des Erwachsenen und die Rahmenbedingungen der Förderung werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Spieltheorien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Spieltheorien von Huizinga, Scheuerl, Schiller, Fröbel, Piaget und Krappmann und untersucht deren Relevanz für die psychomotorische Entwicklungsförderung. Verschiedene Spieltypen wie sensomotorische Spiele, Symbolspiele, Regelspiele und Lernspiele werden differenziert dargestellt.
Wie wird das Spiel in die psychomotorische Praxis integriert?
Die Arbeit diskutiert konkrete Vorschläge und Anregungen von Zimmer und Beins zur Integration des Spiels in die psychomotorische Praxis. Es werden Beispiele aus verschiedenen Arbeitsfeldern (z.B. Spiele im Wasser, Tischspiele) gegeben, die die Vielseitigkeit des Spiels in der psychomotorischen Förderung verdeutlichen.
Welche Fallstudie wird präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine Fallstudie, in der die Autorin die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Förderung an einer konkreten Kindergruppe veranschaulicht. Verschiedene Situationen aus der Praxis werden beschrieben, analysiert und in den Kontext der vorgestellten psychomotorischen Theorien eingeordnet. Die Auswirkungen der Förderung auf das Verhalten der Kinder werden beleuchtet.
Welche Faktoren behindern das freie Spiel heutzutage?
Die Arbeit thematisiert Faktoren, die das freie Spiel von Kindern heutzutage behindern, ohne diese explizit aufzulisten. Dies wird im Kontext der Spieltheorien und der praktischen Umsetzung diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychomotorik, Spiel, Entwicklungsförderung, Kinder, Körpererfahrung, Sozialerfahrung, Kiphard, Zimmer, Seewald, Spieltheorien, praktische Umsetzung, Fallstudie, Elementarbereich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Begründung des Themas, 2. Psychomotorische Grundsätze und Konzepte, 3. Das Spiel, 4. Das Spiel in der Psychomotorik, 5. Die Kindergruppe, 6. Reflexion und konstruktive Kritik. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Entwicklungsförderung. Ziel ist es, verschiedene theoretische Ansätze der Psychomotorik zu beleuchten und deren Anwendung anhand einer konkreten Kindergruppe zu veranschaulichen. Es soll aufgezeigt werden, wie das Spiel in die Praxis der psychomotorischen Förderung integriert werden kann und welche positiven Auswirkungen dies auf die Entwicklung der Kinder hat.
- Quote paper
- Judith Berzins (Author), 2006, Die Bedeutung des Spiels in der psychomotorischen Entwicklungsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/114763