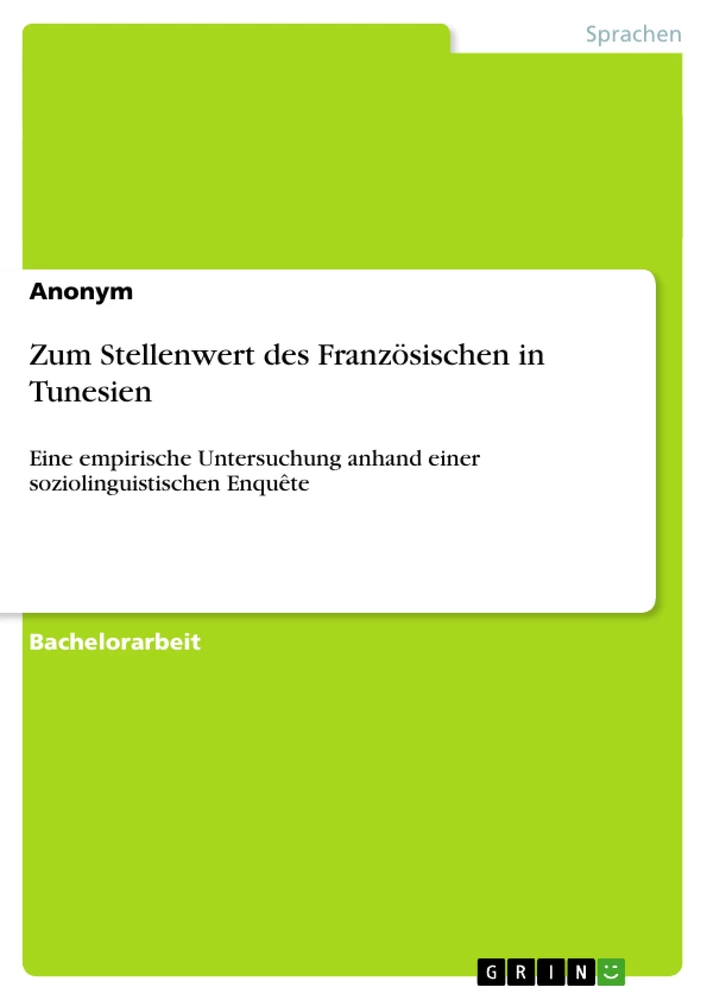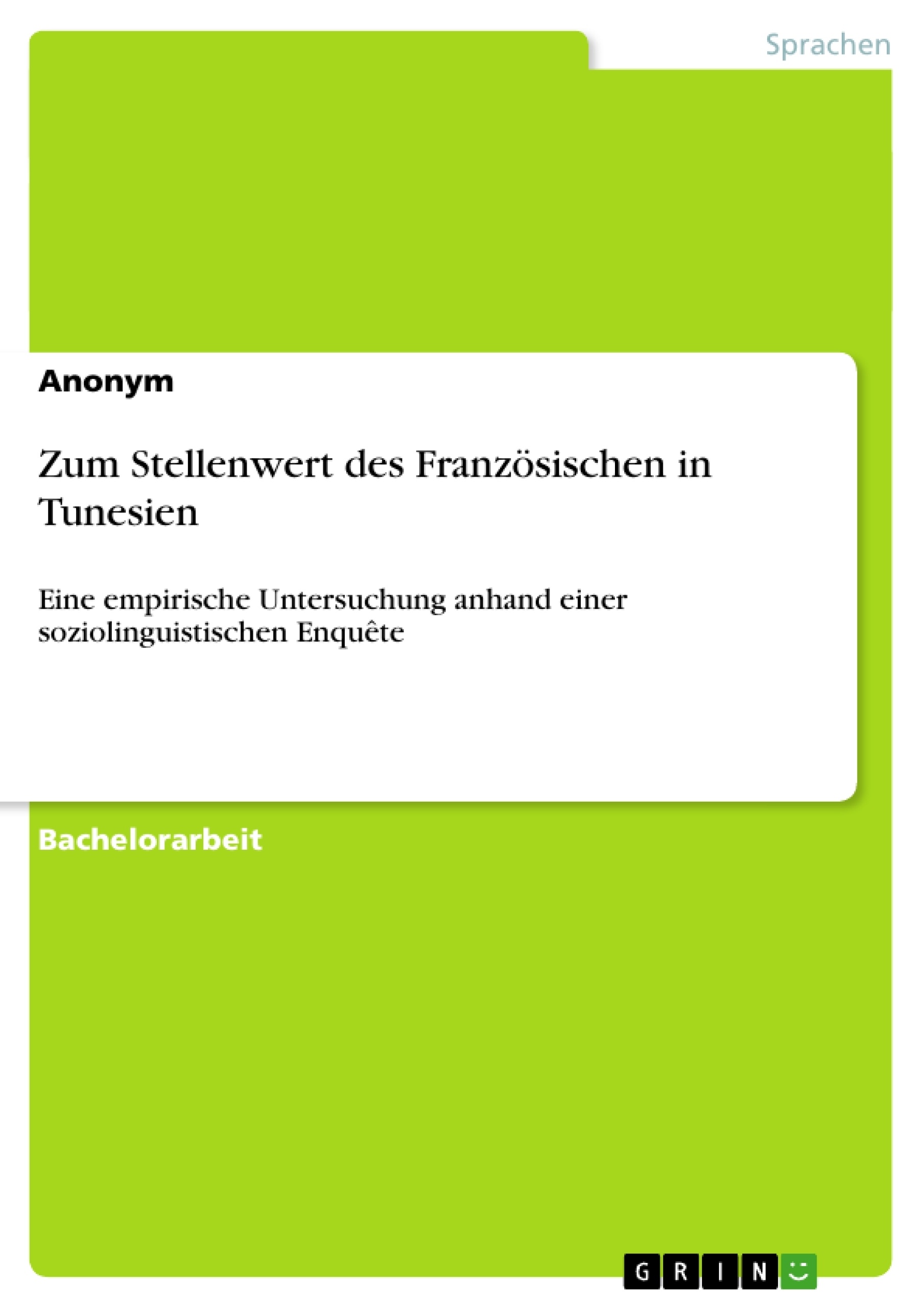Zum 50. Mal jährte sich am 20. März 2006 le jour de l’indépendance Tunesiens von Frankreich. Doch auch nach einem halben Jahrhundert der Unabhängigkeit bleiben die Spuren der Kolonialisierung, oder besser des Protektorats, ein großer Bestandteil der tunesischen Lebensart und Tradition. Neben zahlreichen kulturellen Einflüssen auf Wirtschaft und Schulbildung, hat die Sprache der Kolonie besonders starke Spuren hinterlassen. Die Fragestellung der vorliegenden Bachelorarbeit gilt daher dem Stellenwert des Französischen in Tunesien heute.
Mein Interesse an diesem Thema hängt mit meinem persönlichen Hintergrund zusammen: Als Tochter einer Deutschen und eines Tunesiers lebte ich von meinem vierten bis zu meinem neunzehnten Lebensjahr in Tunesien und wuchs mehrsprachig mit Deutsch, Arabisch und Französisch auf. Nach meinem Abitur kam ich nach Deutschland, um an der Universität Mannheim mein Romanistikstudium aufzunehmen, in dessen Rahmen ich meinen wissenschaftlichen Schwerpunkt auf das Thema Mehrsprachigkeit legte. Die theoretischen Grundlagen zur Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung erwarb ich u.a. in den Seminaren „Familiale und schulische Mehrsprachigkeit in der Migration“ und „Zweit- und Drittspracherwerb“. Einblicke in die Praxis im Bereich der Mehrsprachigkeit und Francophonie im Maghreb, konnte ich während meiner Tätigkeit als Projektassistentin im Rahmen eines Algerien-Projektes gewinnen.
Gegenstand der Bachelorarbeit ist die Auswertung einer eigenen Enquête zu Sprachenrepertoire, Sprachkompetenzen, Sprachgebrauch und Einstellungen zur gelebten Mehrsprachigkeit in Tunesien. Die Durchführung der Befragung erfolgte mittels eines Questionnaires, das per E-Mail an zehn Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis verschickt wurde, die als Multiplikatoren fungierten. Primäre Zielgruppe waren junge Akademiker, in deren Händen maßgeblich die Zukunft des Landes liegt. Ergänzend wurden von den Multiplikatoren vor Ort mündliche Befragungen älterer Personen durchgeführt, so dass sich daraus ein Datenkorpus von insgesamt 30 vollständig ausgefüllten Fragebögen ergibt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Problemstellung und Datenkorpus
- 2 Forschungsstand
- 3 Tunesien
- 3.1 Geographie
- 3.2 Geschichte
- 3.2.1 Vor 1881
- 3.2.2 Nach 1881
- 4 Mehrsprachigkeit und diglossische Sprachenverteilung
- 4.1 Kontaktsprachen
- 4.2 Varietäten des Arabischen und französische Einflüsse
- 4.3 Merkmale des Franco-Tunesisch
- 4.3.1 Code-Switching
- 4.3.2 Entlehnungen
- 4.4 Stellenwert des Französischen in Tunesien
- 4.4.1 Sprachenprestige
- 4.4.2 Sprachenpolitik in Tunesien
- 4.4.3 Sprachdomänen
- 5 Die Enquête: Durchführung und Ergebnisse
- 5.1 Die Informanten
- 5.2 Sprachenverteilung und -kenntnisse
- 5.2.1 Sprachenrepertoire
- 5.2.2 Sprachkompetenzen
- 5.2.3 Code-Switching
- 5.3 Französisch in diversen Sprachdomänen
- 5.3.1 Schulsystem: Französisch als Unterrichtssprache
- 5.3.2 Medien
- 5.3.3 Wirtschaft: Vorteile durch Französischkenntnisse?
- 5.4 Französisch als Prestigesprache?
- 5.5 Tendenzen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Stellenwert des Französischen in Tunesien nach 50 Jahren Unabhängigkeit von Frankreich. Die Arbeit basiert auf einer eigenen soziolinguistischen Enquête mit jungen tunesischen Akademikern. Ziel ist es, den aktuellen Sprachgebrauch, die Sprachkompetenzen und die Einstellungen zum Französisch zu analysieren.
- Der Einfluss der französischen Kolonialzeit auf die tunesische Sprachlandschaft.
- Die Rolle des Französischen im Bildungssystem, den Medien und der Wirtschaft Tunesiens.
- Das Prestige des Französischen und seine Bedeutung als Kontaktsprache.
- Mehrsprachigkeit in Tunesien und die Interaktion zwischen Arabisch und Französisch.
- Zukünftige Entwicklungen des Stellenwertes des Französischen in Tunesien.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Problemstellung und Datenkorpus: Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage nach dem Stellenwert des Französischen im heutigen Tunesien im Kontext des 50. Jahrestages der Unabhängigkeit. Die Autorin begründet ihr Interesse an diesem Thema mit ihrem persönlichen Hintergrund als mehrsprachig aufgewachsene Tochter einer Deutschen und eines Tunesiers. Die Arbeit basiert auf einer eigenen Enquête mit 24 tunesischen Informanten (junge Akademiker), die mittels Fragebögen befragt wurden. Der Fragebogen umfasst soziodemografische Daten und linguistische Fragen zum Sprachenrepertoire, Sprachkompetenzen und Sprachgebrauch. Die Methode der Datenerhebung wird detailliert erläutert, einschließlich der Auswahl der Informanten und der Ausschluss bestimmter Teilnehmer aufgrund von Einflussfaktoren wie Auslandstudium und ethnisch gemischter Hintergrund.
3 Tunesien: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Geographie und Geschichte Tunesiens, mit besonderem Fokus auf die Zeit vor und nach 1881 (Beginn des französischen Protektorats). Es legt den historischen Kontext für die sprachliche Situation im Land dar und bildet die Grundlage für das Verständnis der komplexen mehrsprachigen Realität Tunesiens. Die historische Entwicklung wird als essentieller Faktor für die heutige sprachliche Situation dargestellt, insbesondere der Einfluss des französischen Kolonialismus.
4 Mehrsprachigkeit und diglossische Sprachenverteilung: Dieses Kapitel befasst sich mit der mehrsprachigen Realität Tunesiens und der diglossischen Verteilung von Arabisch und Französisch. Es analysiert die Rolle des Französischen als Kontaktsprache und beleuchtet Merkmale des Franco-Tunesisch wie Code-Switching und Entlehnungen. Es werden Aspekte des Sprachenprestige, der Sprachenpolitik und der Sprachdomänen in Tunesien diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel und der wechselseitigen Beeinflussung der Sprachen. Der Abschnitt analysiert die Bedeutung des Französischen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, um ein umfassendes Bild der sprachlichen Situation zu liefern.
5 Die Enquête: Durchführung und Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Enquête. Es beschreibt die demografischen Daten der Befragten, ihre Sprachenkenntnisse und -kompetenzen, sowie den Gebrauch von Code-Switching in verschiedenen Kontexten. Die Analyse konzentriert sich auf den Gebrauch des Französischen im Schulsystem, in den Medien und in der Wirtschaft. Es wird untersucht, ob Französischkenntnisse wirtschaftliche Vorteile bieten und ob Französisch als Prestigesprache wahrgenommen wird. Der Abschnitt untersucht die Trends und Entwicklungen in Bezug auf die Verwendung des Französischen in Tunesien. Es werden Daten präsentiert, um die Rolle des Französischen im täglichen Leben und seine langfristige Relevanz zu evaluieren.
Schlüsselwörter
Französisch, Tunesien, Mehrsprachigkeit, Diglossie, Code-Switching, Sprachenpolitik, Sprachdomänen, Kolonialismus, Enquête, Soziolinguistik, Sprachprestige, Franco-Tunesisch.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Der Stellenwert des Französischen im heutigen Tunesien
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Stellenwert des Französischen in Tunesien 50 Jahre nach der Unabhängigkeit von Frankreich. Sie analysiert den aktuellen Sprachgebrauch, die Sprachkompetenzen und die Einstellungen junger tunesischer Akademiker zum Französisch.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer eigenen soziolinguistischen Enquête mit 24 jungen tunesischen Akademikern. Die Datenerhebung erfolgte mittels Fragebögen, die soziodemografische Daten und linguistische Fragen zum Sprachenrepertoire, Sprachkompetenzen und Sprachgebrauch enthielten. Die Auswahl der Informanten und der Ausschluss bestimmter Teilnehmer aufgrund von Einflussfaktoren wie Auslandstudium und ethnisch gemischter Hintergrund wurden detailliert erläutert.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss der französischen Kolonialzeit auf die tunesische Sprachlandschaft, die Rolle des Französischen im Bildungssystem, den Medien und der Wirtschaft Tunesiens, das Prestige des Französischen als Kontaktsprache, die Mehrsprachigkeit in Tunesien und die Interaktion zwischen Arabisch und Französisch, sowie zukünftige Entwicklungen des Stellenwerts des Französischen in Tunesien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung mit Problemstellung und Datenkorpus, Forschungsstand, Überblick über Tunesien (Geografie und Geschichte), Mehrsprachigkeit und diglossische Sprachenverteilung (inkl. Franco-Tunesisch, Code-Switching und Entlehnungen), Darstellung der Enquête (Durchführung und Ergebnisse mit Fokus auf Sprachverteilung, -kenntnisse und -gebrauch in verschiedenen Domänen), und Fazit.
Welche Ergebnisse liefert die Enquête?
Die Enquête liefert Daten zur Sprachenverteilung und -kenntnissen der befragten tunesischen Akademiker, zum Code-Switching in verschiedenen Kontexten, zum Gebrauch des Französischen im Schulsystem, in den Medien und in der Wirtschaft, zur Wahrnehmung des Französischen als Prestigesprache und zu zukünftigen Entwicklungstendenzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Französisch, Tunesien, Mehrsprachigkeit, Diglossie, Code-Switching, Sprachenpolitik, Sprachdomänen, Kolonialismus, Enquête, Soziolinguistik, Sprachprestige, Franco-Tunesisch.
Wer ist die Zielgruppe der Arbeit?
Die Zielgruppe der Arbeit sind Personen, die sich für Soziolinguistik, Sprachpolitik, die Sprachsituation in Tunesien und den Einfluss des Französischen im postkolonialen Kontext interessieren. Die Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht.
Wo finde ich den vollständigen Text der Arbeit?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Auszug dient lediglich als Übersicht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2006, Zum Stellenwert des Französischen in Tunesien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/114454