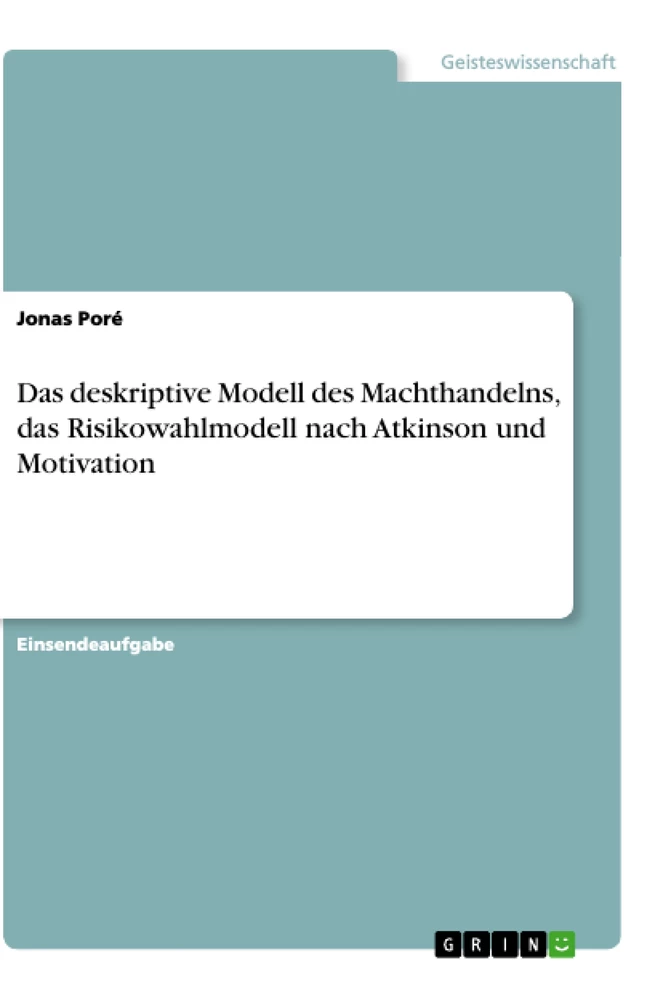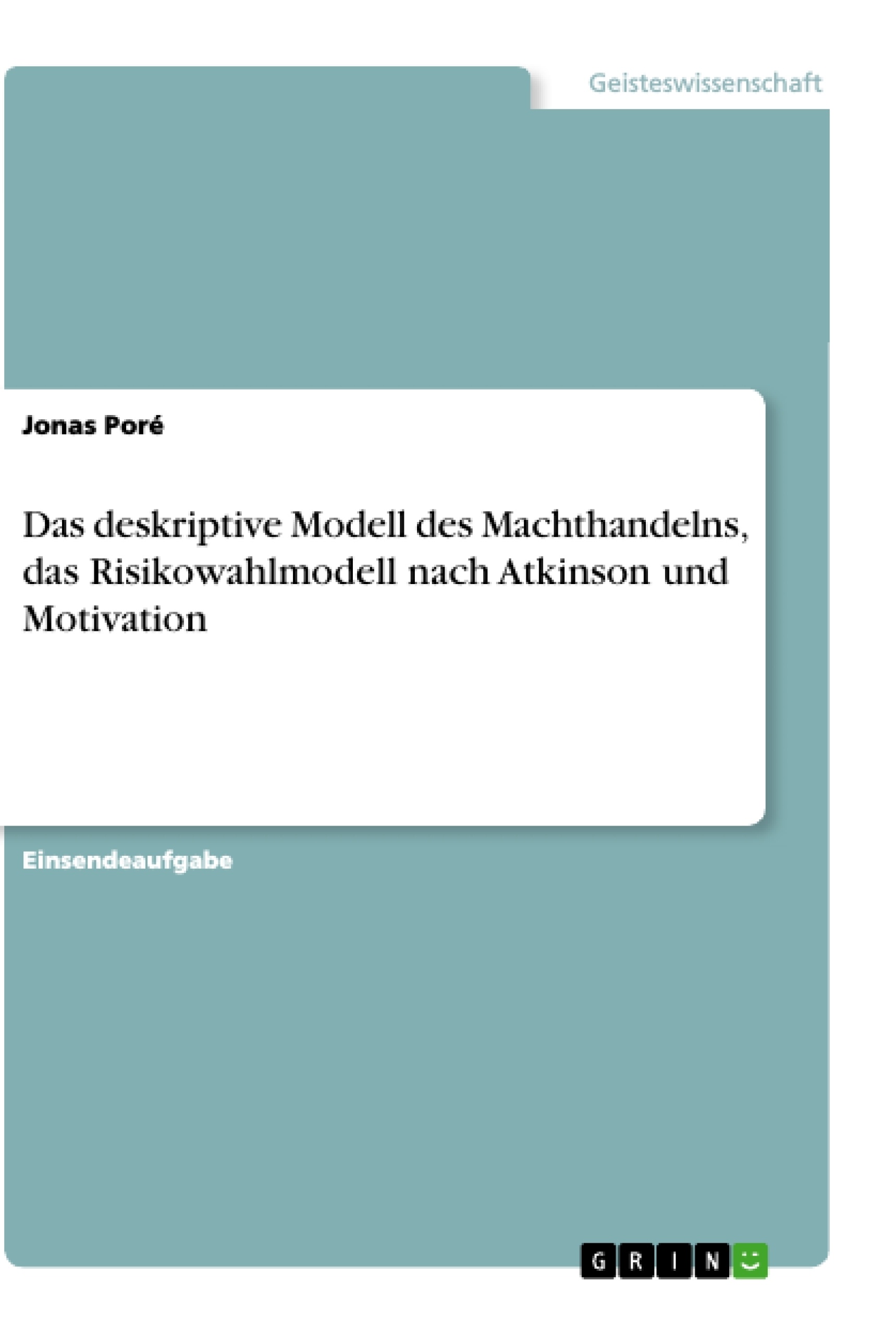Aufgabe 1: Das deskriptive Modell des Machthandelns.
Macht kann je nach Disziplin unterschiedlich definiert werden. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine Person oder Organisation in der Lage ist, jemanden zu einer Handlung zu bewegen, die man sonst nicht ausführen würde.
Aufgabe 2: Das Risikowahlmodell nach Atkinson.
Das Risikowahlmodell von Atkinson (1957) versucht systematisch bei einer Wahlentscheidung unter Unsicherheit zu helfen. Das Modell will die Frage beantworten, welche Aufgabe eine Person wählen sollte, wenn verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zur Auswahl stehen.
Aufgabe 3: Motivation.
"Motivation", aus dem Lateinischen stammend, bedeutet sich oder etwas bewegen. Doch woher kommt die Motivation, sich selbst oder andere zu Handlungen zu bewegen? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die unter den Begriffen intrinsische und extrinsische Motiva-tion bekannt sind. Im Text soll intrinsische und extrinsische Motivation vorgestellt und voneinander unterschieden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1
- Das deskriptive Modell des Machthandelns
- Ausgeprägtes Machtmotiv bei Führungskräften
- Auswirkung auf die Führungskräfteentwicklung
- Auswirkung auf Mitarbeitende
- Aufgabe 2
- Das Risikowahlmodell nach Atkinson
- Das Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungsmodell nach Vroom
- Abgrenzung zwischen dem Risiko-Wahl-Modell und dem VIE-Modell
- Anwendung des Risiko-Wahl-Modells am Beispiel der Einsendeaufgabe
- Aufgabe 3
- Intrinsische Motivation
- Extrinsische Motivation
- Organismische Integration
- Verdrängungs- und Preiseffekt
- Sinnhaftigkeit variabler Vergütungssysteme
- Fehlende intrinsische Motivation bei Mitarbeitende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Einsendeaufgabe befasst sich mit dem Thema Macht und Motivation im Kontext von Führung und Arbeitsverhalten. Sie analysiert verschiedene Modelle und Theorien, die das Ausüben von Macht sowie die Motivation von Mitarbeitern erklären.
- Deskriptives Modell des Machthandelns und die verschiedenen Phasen der Machtausübung
- Zusammenhang zwischen Machtmotivation und Führungsverhalten
- Modelle der Motivation, wie das Risikowahlmodell und das VIE-Modell
- Intrinsische und extrinsische Motivation im Arbeitskontext
- Bedeutung von Selbstbestimmung und organismischer Integration für die Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabe 1
Dieses Kapitel behandelt das deskriptive Modell des Machthandelns. Es erläutert die verschiedenen Machtquellen, die ein Machtausübender nutzen kann, und die Schritte, die bei der Beeinflussung einer anderen Person durchlaufen werden. Das Kapitel beleuchtet auch die Auswirkungen von Machtausübung auf die Selbstachtung des Machtausübenden und die Wahrnehmung der beeinflussten Person.
Aufgabe 2
Dieses Kapitel stellt das Risikowahlmodell nach Atkinson und das Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungsmodell (VIE-Modell) nach Vroom vor. Es erläutert die Unterschiede zwischen den Modellen und zeigt, wie das Risikowahlmodell im Kontext der Einsendeaufgabe angewendet werden kann.
Aufgabe 3
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Motivation, darunter intrinsische und extrinsische Motivation. Es beschreibt das Konzept der organismischen Integration und die Auswirkungen von Verdrängungs- und Preiseffekten. Das Kapitel beleuchtet auch die Sinnhaftigkeit variabler Vergütungssysteme und die Gründe für fehlende intrinsische Motivation bei Mitarbeitern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Einsendeaufgabe sind Macht, Motivation, Führungsverhalten, Risikowahlmodell, VIE-Modell, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, organismische Integration, Verdrängungs- und Preiseffekt, und variable Vergütungssysteme.
- Quote paper
- Jonas Poré (Author), 2021, Das deskriptive Modell des Machthandelns, das Risikowahlmodell nach Atkinson und Motivation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1140922