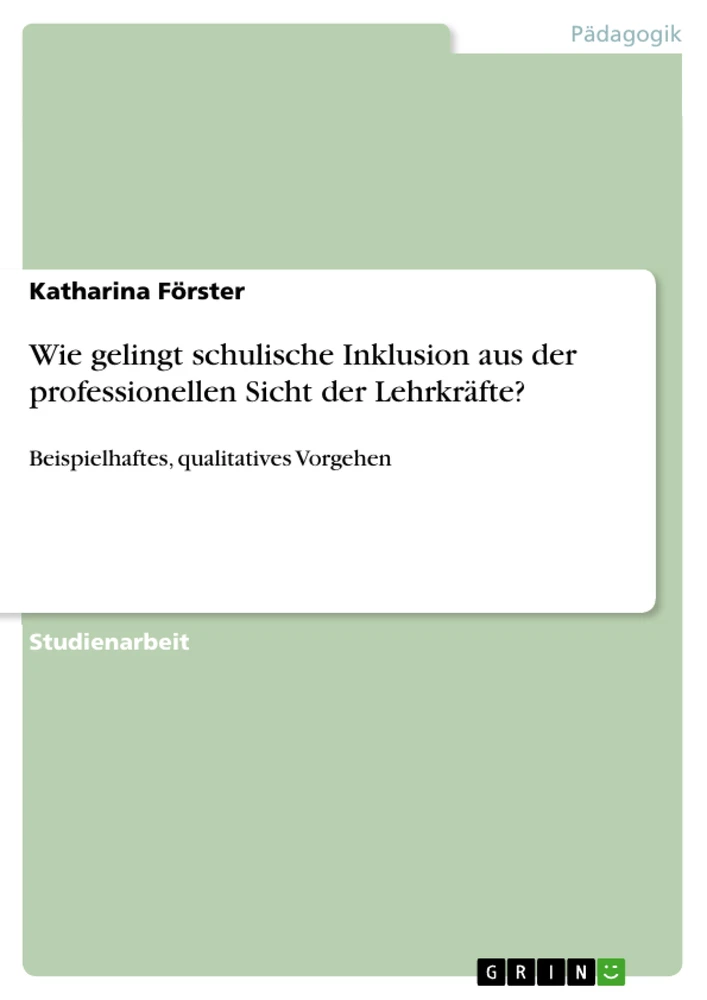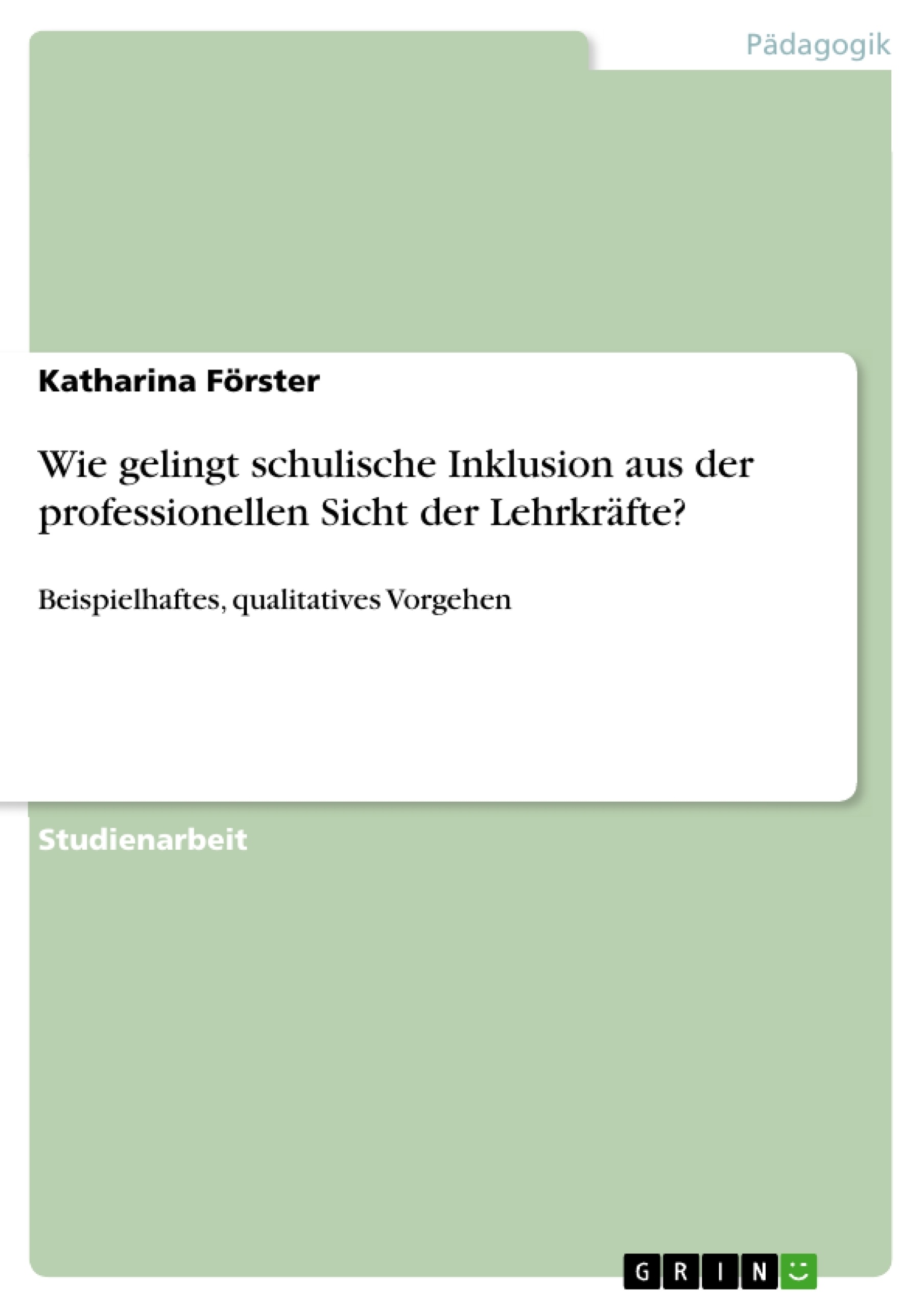Diese Fallstudie soll sich mit der Frage auseinandersetzen, wie schulische Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte einer Stadt, in Bezug auf die im Studium erlernten Lehrmethoden und Konzepte, gelingt.
Das Thema der gemeinsamen Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung beschäftigt die Gesellschaft schon seit vielen Jahren. Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2008 und ihres Inkrafttretens in Deutschland 2009, ist es aber auch bildungspolitisch zum Thema geworden. Seither dürfen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung nicht mehr vom Regelschulsystem ausgeschlossen werden. Deutschland verpflichtete sich somit dazu, Inklusion im Bildungssystem, aber auch in vielen weiteren Lebensbereichen umzusetzen. Damit einhergehend kommt auch die Verpflichtung, Strukturen und Prozesse im Bildungssystem weiterzuentwickeln, sowie Barrieren offenzulegen und diese aktiv zu beseitigen. Der Unterricht an Schulen muss sich daher so verändern, dass alle Kinder positive Lernverläufe erleben können.
Dadurch entsteht auf der Ebene des Unterrichts die Notwendigkeit, auf die heterogenen Lernvoraussetzungen zu reagieren und auf dieser Basis differenzierte und individualisierte Unterrichtskonzepte zu entwickeln. Diese müssen den Kindern individuelle Lernmöglichkeiten in Bezug auf Unterrichtsinhalte, der Schwierigkeit der Aufgaben oder auch den Lerntempos ermöglichen können. Auch die Stadt mit ihren ca. 500.000 Einwohner*innen hat sich auf diesen Weg begeben. Stetig erhöht sich die Anzahl an Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf an den rund 75 Grundschulen. Die Anzahl an Schüler*innen, die an Förderschulen unterrichtet werden, konnte so deutlich gesenkt werden. In diesem Zusammenhang berichten viele Lehrkräfte, dass die Kinder mit Behinderung eine beträchtliche Leistungsentwicklung aufweisen. Andere Lehrkräfte dagegen weisen auf die erhöhte Belastung in ihrem Berufsalltag hin, auf welche sie im Rahmen ihres Studiums nicht ausreichend vorbereitet worden waren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriffsbestimmung: Inklusion
- 1.2 Inklusion im Bildungssystem
- 1.3 Aktueller Forschungsstand
- 2. Beschreibung des Forschungsdesigns
- 2.1 Methodologische Positionierung
- 2.2 Bestimmung des Forschungsfeldes
- 2.3 Wahl des Erhebungsverfahrens
- 2.4 Wahl des Auswahlverfahrens
- 2.5 Bestimmung des Samplings
- 3. Erstellung des Erhebungsinstruments
- 3.1 Mögliches Leitfadeninterview
- 4. Fazit
- 5. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie befasst sich mit der Frage, wie schulische Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte der Stadt Beispielhausen gelingt, insbesondere im Hinblick auf die im Studium erlernten Lehrmethoden und Konzepte. Die Studie untersucht, ob Lehrkräfte ausreichend auf die Herausforderungen des inklusiven Unterrichts vorbereitet sind und wie sie die Umsetzung von Inklusion im Schulalltag erleben.
- Bedeutung und Definition von Inklusion im Bildungssystem
- Herausforderungen der Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte
- Relevanz von Lehrmethoden und Konzepten für die Umsetzung von Inklusion
- Bewertung der Lehrer*innenausbildung in Bezug auf die Vorbereitung auf Inklusion
- Empirische Befunde zur Umsetzung von Inklusion in der Stadt Beispielhausen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff der Inklusion im Bildungssystem vor, beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und definiert die Forschungsfrage der Studie. Kapitel 2 beschreibt das Forschungsdesign, einschließlich der methodologischen Positionierung, der Wahl des Erhebungsverfahrens und der Festlegung der Stichprobe. Kapitel 3 präsentiert ein mögliches Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument. Das Kapitel 4 enthält ein Fazit der Studie, während Kapitel 5 eine Reflexion der Ergebnisse bietet.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind: schulische Inklusion, Lehrkräfte, Lehrmethoden, Konzepte, Lehrer*innenausbildung, inklusive Unterrichtsgestaltung, heterogene Lerngruppen, empirische Forschung, Fallstudie, Stadt Beispielhausen.
- Quote paper
- Katharina Förster (Author), 2021, Wie gelingt schulische Inklusion aus der professionellen Sicht der Lehrkräfte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1138285