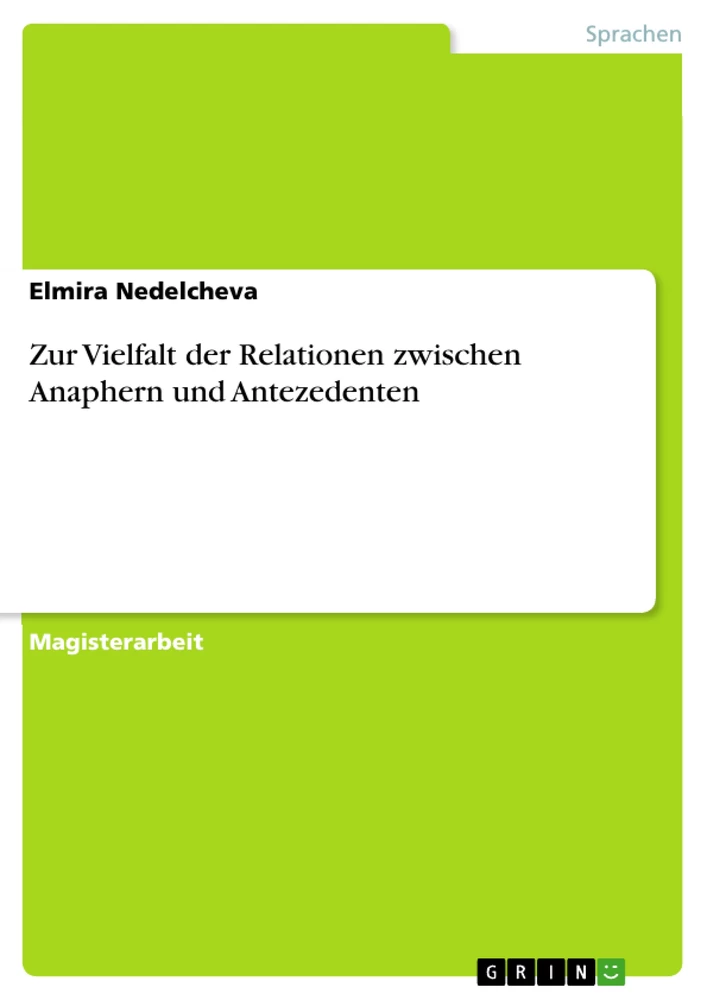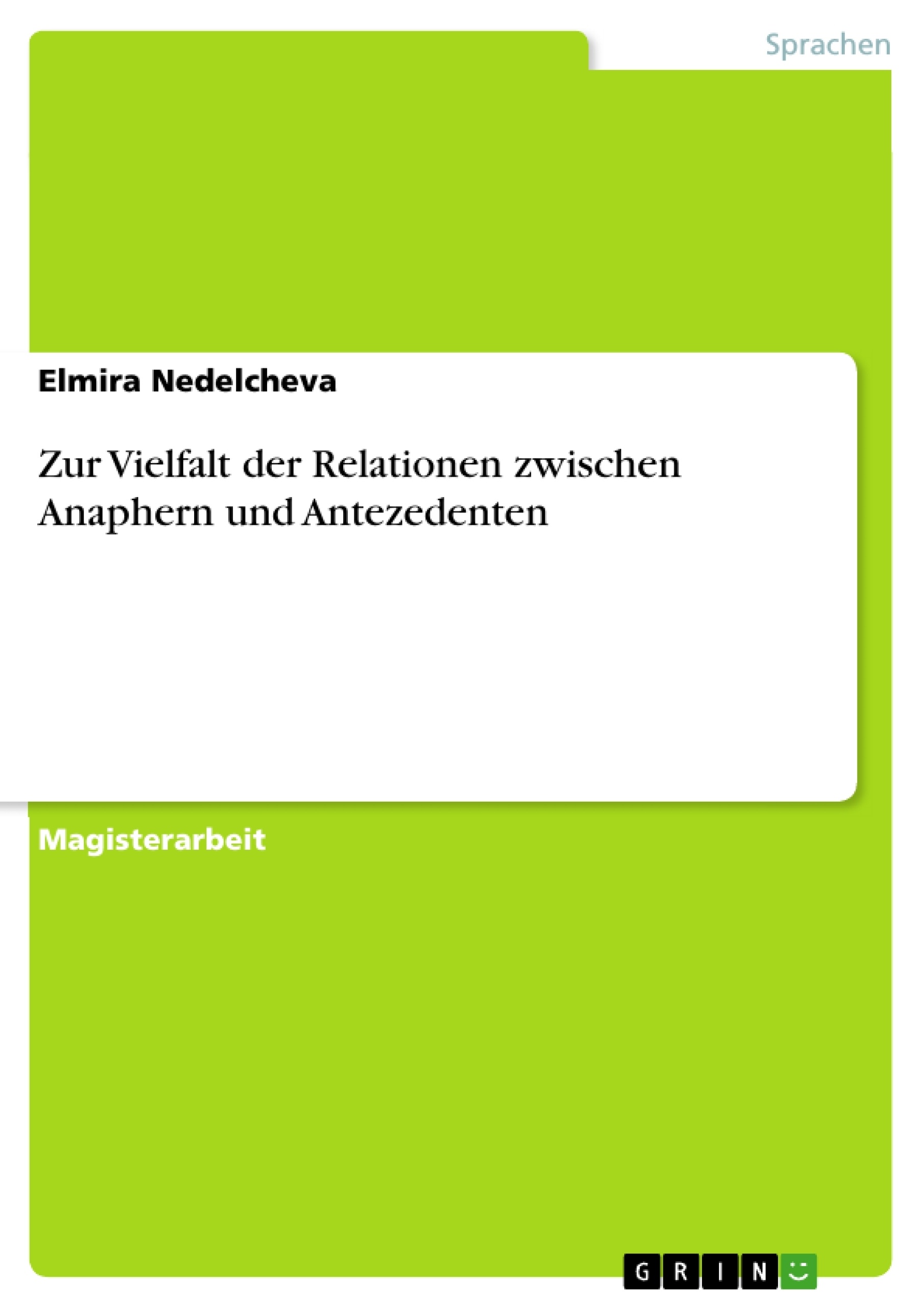Die vorliegende Arbeit versucht einen Einblick in die Vielfalt der Relationen, die zwischen Anaphern und Antezedenten bestehen können, zu vermitteln und beschäftigt sich mit der Frage, welche Regularitäten bewirken, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten der anaphorischen Beziehungen gibt. Hierzu soll zunächst ein allgemeiner Überblick über anaphorische Ausdrücke in natürlicher Sprache anhand von zahlreichen Beispielen gegeben werden. Diese Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf den Problemkreis der verschiedenen satzübergreifenden Anaphorik, nämlich auf die sogenannten Diskursanaphern, die in Form von Personalpronomina oder Nominalphrasen vorkommen könnten. Auf die satzinternen Anaphern wird hier nicht weiter eingegangen, da es sich zweifellos um andere theoretische Besonderheiten handelt.
Welcher Art die Zusammenhänge zwischen Anapher und Antezedent in einer Satzfolge sein können, ist eine Fragestellung, die in dieser Arbeit zum Tragen kommt.
Der erste Teil befasst sich zunächst mit der Klärung des theoretischen Hintergrundes für die Anaphern. Es wird mit einer allgemeinen Definition der Anaphern und der Antezedenten und mit ihrer Beschreibung als referentielles Phänomen begonnen. Daher wird ausführlich auf die Frage eingegangen, wann ein sprachlicher Ausdruck im Normalfall als Anapher betrachtet werden kann. Dabei werde ich einen kurzen Überblick über die üblichen anaphorischen Wiederaufnahmen geben. Dazu werden verschiedene wesentliche Eigenschaften der Anaphern beschrieben. Es folgt dann die Präsentation von solchen Fällen, die von den Standardannahmen zu Anaphern deutlich abweichen. Im Einzelnen geht es um mangelnde Koreferenz, die in der Textlinguistik als das typische Merkmal der Anaphorik bezeichnet wurde. Dieser ausführliche Überblick soll einen Eindruck davon vermitteln, dass die anaphorischen Verweise oft vielschichtiger und komplexer sind, als es in der meisten Forschungsliteratur angenommen wurde. Geklärt werden soll auch, inwiefern diese Problembereiche der typischen Charakteristika der Anaphern widersprechen. Die zahlreichen Beispieltexten stammen aus verschiedenen Textsorten wie Zeitungsartikeln, literarische Texten oder sie wurden auch aus der linguistischen Forschungsliteratur übernommen. Vereinzelt werden auch einige konstruierte Beispiele angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Theoretischer Rahmen
- 1.1. Definition - Referenz
- 1.2. Definition - Kohäsion und Kohärenz
- 1.3. Zum Anaphernbegriff
- 1.4. Definition - Antezedent
- 1.5. Koreferenz und Anaphernverstehen
- 2. Standardannahmen zum Anaphernverstehen
- 2.1. Zur Interpretation pluraler Anaphern/Plurale Diskursanapher
- 3. Abweichungen von Standardannahmen zu Anaphern
- 3.1. Genus- und Numeruskongruenz zwischen Antezedent und Anapher
- 3.2. Ambiguitäten bei Anaphern
- 3.3. Komplexanaphern
- 3.4. Veränderung der Referenten
- 3.5. Indirekte Anaphern
- 3.6. Faulheitspronomen
- 4. Zur Vielfalt der Relationen zwischen der Anapher und dem Antezedenten am Beispiel eines Textes
- 5. Zusammenfassung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die vielfältigen Beziehungen zwischen Anaphern und Antezedenten in der deutschen Sprache. Ziel ist es, die Regularitäten und Abweichungen von Standardannahmen im Anaphernverstehen zu beleuchten und die Komplexität anaphorischer Verweise aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die sätzeübergreifende Diskursanaphorik.
- Definition und Abgrenzung von Anaphern und Antezedenten
- Analyse von Standardannahmen zum Anaphernverstehen
- Untersuchung von Abweichungen von diesen Standardannahmen (z.B. Genus- und Numeruskongruenz, Ambiguitäten)
- Behandlung komplexer Anaphertypen (z.B. Komplexanaphern, indirekte Anaphern)
- Analyse der Vielfalt der Relationen zwischen Anapher und Antezedent anhand von Beispieltexten
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, nämlich die Untersuchung der vielfältigen Relationen zwischen Anaphern und Antezedenten und die Erklärung unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten anaphorischer Beziehungen. Es wird der Fokus auf sätzeübergreifende Diskursanaphern in Form von Personalpronomina oder Nominalphrasen gelegt, während satzinterne Anaphern ausgeschlossen werden.
1. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein für die Arbeit. Es definiert zentrale Begriffe wie Referenz, Kohäsion, Kohärenz, Anapher und Antezedent, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Analyse zu schaffen. Die Definition der Referenz als Vorgang des Beziehens auf außersprachliche Gegenstände wird ausführlich erläutert, ebenso die Kriterien zur Bestimmung eines sprachlichen Ausdrucks als Anapher.
2. Standardannahmen zum Anaphernverstehen: Kapitel 2 beschreibt die gängigen Annahmen zum Verständnis von Anaphern. Es beleuchtet insbesondere die Interpretation pluraler Anaphern und legt damit die Basis für den Vergleich mit den im Folgenden beschriebenen Abweichungen.
3. Abweichungen von Standardannahmen zu Anaphern: Dieser zentrale Abschnitt analysiert verschiedene Fälle, die von den Standardannahmen abweichen. Es werden Phänomene wie fehlende Genus- und Numeruskongruenz, Ambiguitäten, Komplexanaphern, Veränderungen der Referenten, indirekte Anaphern und Faulheitspronomen detailliert untersucht und anhand von Beispielen illustriert. Die Kapitel zeigen die Komplexität und Vielschichtigkeit anaphorischer Verweise auf.
4. Zur Vielfalt der Relationen zwischen der Anapher und dem Antezedenten am Beispiel eines Textes: Dieses Kapitel wendet die theoretischen Erkenntnisse auf konkrete Textbeispiele an, um die verschiedenen Relationen zwischen Anapher und Antezedent zu veranschaulichen und zu analysieren.
Schlüsselwörter
Anapher, Antezedent, Koreferenz, Diskursanapher, Referenz, Kohäsion, Kohärenz, Genus-Kongruenz, Numerus-Kongruenz, Ambiguität, Komplexanapher, Indirekte Anapher, Faulheitspronomen, Textlinguistik.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Anapher und Antezedent
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die vielfältigen Beziehungen zwischen Anaphern und Antezedenten in der deutschen Sprache, insbesondere die sätzeübergreifende Diskursanaphorik. Der Fokus liegt auf der Analyse von Regularitäten und Abweichungen von Standardannahmen im Anaphernverstehen und der Aufdeckung der Komplexität anaphorischer Verweise.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Anaphern und Antezedenten; Analyse von Standardannahmen zum Anaphernverstehen; Untersuchung von Abweichungen von diesen Standardannahmen (z.B. Genus- und Numeruskongruenz, Ambiguitäten); Behandlung komplexer Anaphertypen (z.B. Komplexanaphern, indirekte Anaphern); und die Analyse der Vielfalt der Relationen zwischen Anapher und Antezedent anhand von Beispieltexten. Satzinterne Anaphern werden hingegen ausgeschlossen.
Welche Begriffe werden definiert?
Zentrale Begriffe wie Referenz, Kohäsion, Kohärenz, Anapher und Antezedent werden definiert und abgegrenzt, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Analyse zu schaffen. Die Definition der Referenz als Vorgang des Beziehens auf außersprachliche Gegenstände wird ausführlich erläutert, ebenso die Kriterien zur Bestimmung eines sprachlichen Ausdrucks als Anapher.
Wie werden Standardannahmen zum Anaphernverstehen behandelt?
Die Arbeit beschreibt die gängigen Annahmen zum Verständnis von Anaphern, insbesondere die Interpretation pluraler Anaphern. Dies bildet die Grundlage für den Vergleich mit den im Folgenden beschriebenen Abweichungen von diesen Standardannahmen.
Welche Abweichungen von Standardannahmen werden untersucht?
Es werden verschiedene Fälle analysiert, die von den Standardannahmen abweichen. Dazu gehören Phänomene wie fehlende Genus- und Numeruskongruenz, Ambiguitäten, Komplexanaphern, Veränderungen der Referenten, indirekte Anaphern und Faulheitspronomen. Diese Phänomene werden detailliert untersucht und anhand von Beispielen illustriert, um die Komplexität und Vielschichtigkeit anaphorischer Verweise aufzuzeigen.
Wie werden die theoretischen Erkenntnisse angewendet?
Die theoretischen Erkenntnisse werden auf konkrete Textbeispiele angewendet, um die verschiedenen Relationen zwischen Anapher und Antezedent zu veranschaulichen und zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Anapher, Antezedent, Koreferenz, Diskursanapher, Referenz, Kohäsion, Kohärenz, Genus-Kongruenz, Numerus-Kongruenz, Ambiguität, Komplexanapher, Indirekte Anapher, Faulheitspronomen, Textlinguistik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Rahmen, ein Kapitel zu Standardannahmen zum Anaphernverstehen, ein Kapitel zu Abweichungen von diesen Standardannahmen, ein Kapitel zur Anwendung der Theorie auf konkrete Textbeispiele und ein abschließendes Kapitel mit Zusammenfassung und Literaturverzeichnis.
- Arbeit zitieren
- Elmira Nedelcheva (Autor:in), 2008, Zur Vielfalt der Relationen zwischen Anaphern und Antezedenten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113710