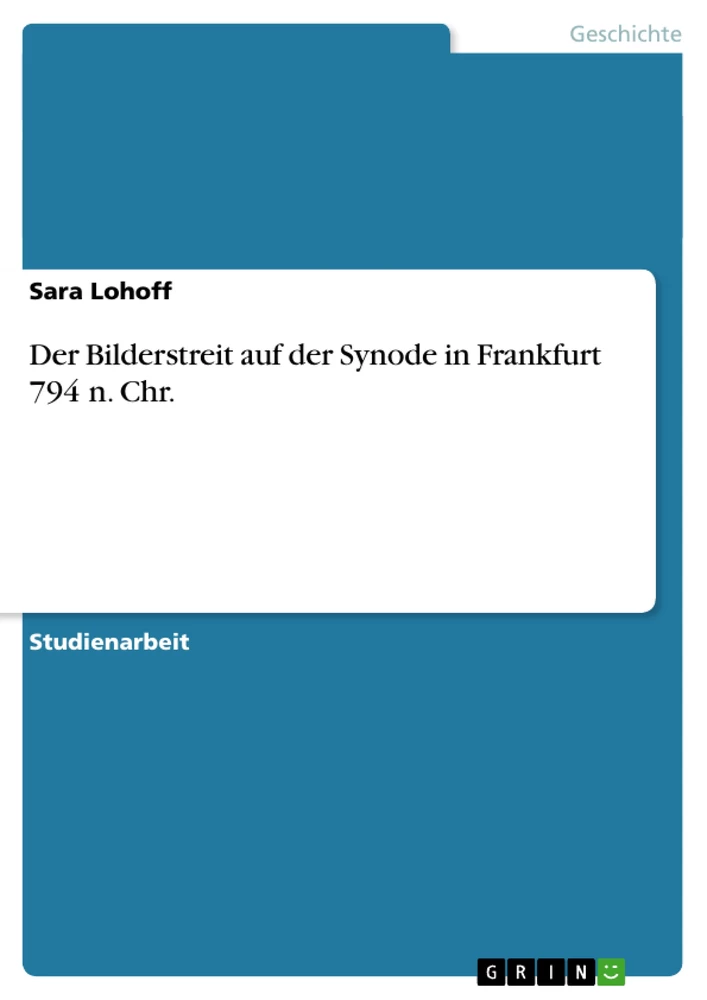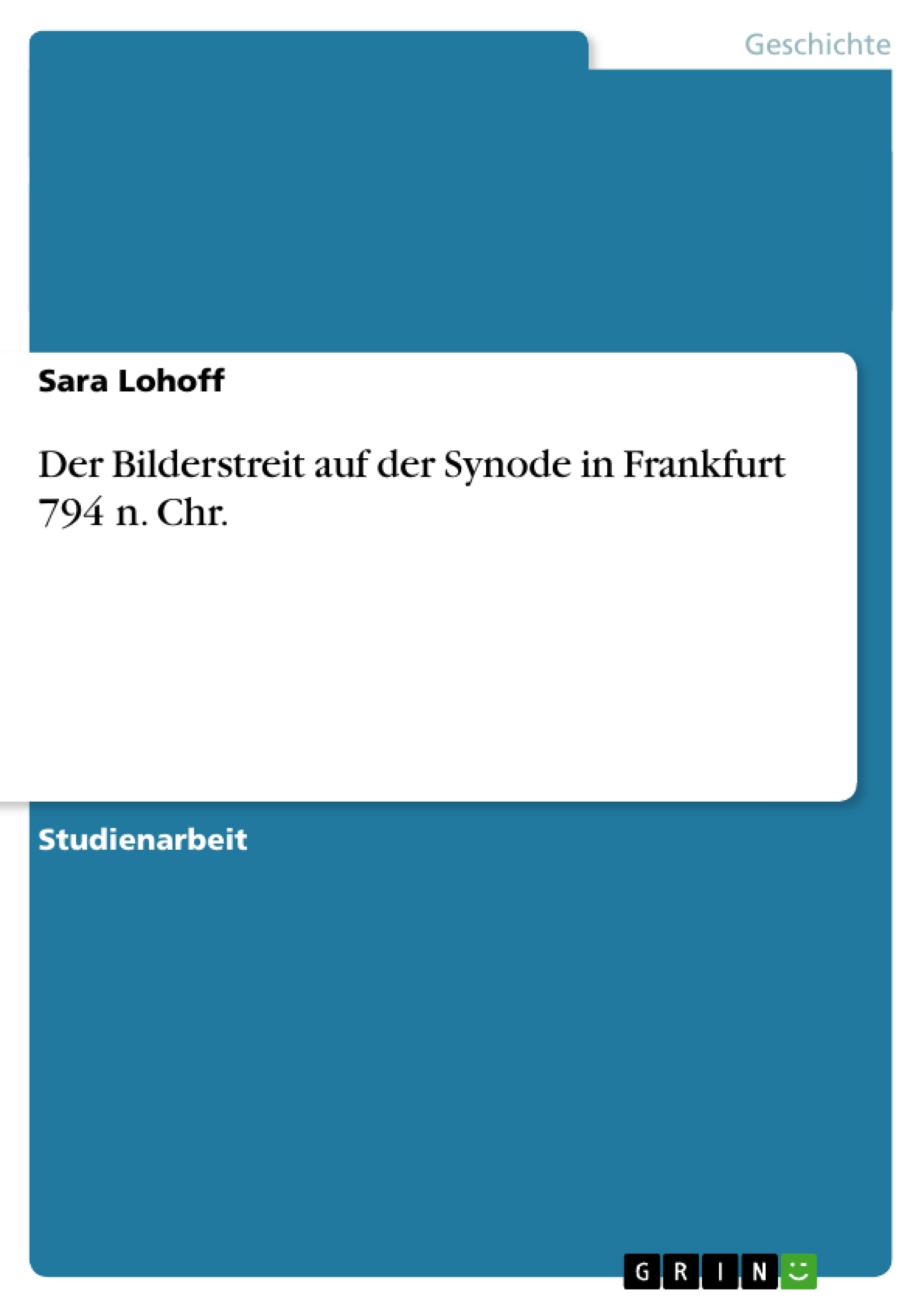Im achten und neunten Jahrhundert erschütterte der sogenannte „Bilderstreit“ das byzantinische Reich. Ikonodulen, die Bilderverehrer, und Ikonoklasten, die Bilderzerschmetterer, rangen fast eineinhalb Jahrhunderte um die Frage ob man Heilige, Jesus oder seine Mutter auf Bildern darstellen und ihnen Verehrung entgegenbringen dürfe. Dies führte zu blutigen Auseinandersetzungen im byzantinischen Reich. Doch der Bilderstreit führte auch über die Grenzen Byzanz hinweg zu Konflikten. Zum einen belastete er die Beziehungen zu Rom, zum anderen spielte er eine bedeutende Rolle im Verhältnis zwischen dem byzantinischen und dem fränkischen Reich. Denn durch die Auseinandersetzungen zwischen den bilderfeindlichen Herrschern von Byzanz und dem Papst wurde dieser förmlich aus dem Reich gedrängt und wandte sich auf der Suche nach neuen Protegisten den fränkischen Herrschern zu.
Bedeutend für das Frankenreich wurde die Auseinandersetzung erst nach 787, als, nach mehreren Jahren ikonoklastischer Herrschaft in Byzanz, eine Synode in Nicäa unter der bilderfreundlichen Kaiserin Irene stattfand, welche die Verehrung der Bilder im byzantinistischen Reich wieder einführte. Auf diese Synode reagierten Karl der Große und seine Gelehrten auf verschiedene Weise. Zum einen verfaßten sie die Libri Carolini, eine Abhandlung über ihre Stellung zum Bild und mit einer klaren Positionierung gegen die Bilderverehrung und zum anderen auf einer fränkischen Synode in Frankfurt im Jahre 794. Dort wurde die Bilderverehrung thematisiert und im Kapitular, dem Schlußdokument, sowohl die Synode von Nicäa als auch die wieder eingeführte Bilderverehrung verurteilt.
In dieser Arbeit sollen, nach einer kurzen Einführung zu dem byzantinischen Bilderstreit, die Fragen behandelt werden, welche Bedeutung der Bilderstreit eigentlich für die Karolinger hatte und warum er zu einem Thema auf der Synode von Frankfurt wurde, bzw. welche Absichten Karl der Große im puncto Bilderstreit verfolgte.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Der byzantinische Bilderstreit
2.1. Der Ikonoklasmus unter Leon III und Konstantin V
2.2. Die Wiederherstellung der Bilder unter Irene
3. Die Reaktionen der Karolinger auf die Synode von Nicäa
3.1. Die Synode von Frankfurt im Jahre 794
4. Schlußbemerkung
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1. Quellen
5.2. Literatur
1. Einleitung
Im achten und neunten Jahrhundert erschütterte der sogenannte „Bilderstreit“ das byzantinische Reich. Ikonodulen, die Bilderverehrer, und Ikonoklasten, die Bilderzerschmetterer, rangen fast eineinhalb Jahrhunderte um die Frage ob man Heilige, Jesus oder seine Mutter auf Bildern darstellen und ihnen Verehrung entgegenbringen dürfe. Dies führte zu blutigen Auseinandersetzungen im byzantinischen Reich.[1] Doch der Bilderstreit führte auch über die Grenzen Byzanz hinweg zu Konflikten. Zum einen belastete er die Beziehungen zu Rom, zum anderen spielte er eine bedeutende Rolle im Verhältnis zwischen dem byzantinischen und dem fränkischen Reich. Denn durch die Auseinandersetzungen zwischen den bilderfeindlichen Herrschern von Byzanz und dem Papst wurde dieser förmlich aus dem Reich gedrängt und wandte sich auf der Suche nach neuen Protegisten den fränkischen Herrschern zu.[2]
Bedeutend für das Frankenreich wurde die Auseinandersetzung erst nach 787, als, nach mehreren Jahren ikonoklastischer Herrschaft in Byzanz, eine Synode in Nicäa unter der bilderfreundlichen Kaiserin Irene stattfand, welche die Verehrung der Bilder im byzantinistischen Reich wieder einführte. Auf diese Synode reagierten Karl der Große und seine Gelehrten auf verschiedene Weise. Zum einen verfaßten sie die Libri Carolini, eine Abhandlung über ihre Stellung zum Bild und mit einer klaren Positionierung gegen die Bilderverehrung und zum anderen auf einer fränkischen Synode in Frankfurt im Jahre 794. Dort wurde die Bilderverehrung thematisiert und im Kapitular, dem Schlußdokument, sowohl die Synode von Nicäa als auch die wieder eingeführte Bilderverehrung verurteilt.
In dieser Arbeit sollen, nach einer kurzen Einführung zu dem byzantinischen Bilderstreit, die Fragen behandelt werden, welche Bedeutung der Bilderstreit eigentlich für die Karolinger hatte und warum er zu einem Thema auf der Synode von Frankfurt wurde, bzw. welche Absichten Karl der Große im puncto Bilderstreit verfolgte.
Über die Synode in Frankfurt sind nur wenige unmittelbare Zeugnisse erhalten. Zum einen die Königsurkunde vom 22. Februar 794, das Kapitular in Abschriften des 9. und des 10./11. Jahrhunderts, das Lorscher Annalenfragment und einige ergänzende „Aktenstücke“ zum Adoptianismus und zum Bilderstreit.[3] Erhaltene ergänzende Aktenstücke zum Bilderstreit sind auch die Libri Carolini und ein Brief von Papst Hadrian I. Aus diesem Brief läßt sich ein Schreiben Karls rekonstruieren, in welchem er dem Papst die fränkische Position zur Frage der Bilderverehrung zukommen ließ. Beide Dokumente liegen zeitlich vor der Frankfurter Synode 794. Für diese Arbeit dienen als Quellen vor allem die Libri Carolini und das Kapitular der Frankfurter Synode.
2. Der byzantinische Bilderstreit
2.1. Der Ikonoklasmus unter Leon III und Konstantin V
Seit dem 6. Jahrhundert hatte die Ikone in Byzanz einen Stellenwert erlangt, wie sie ihn im Westen nie besaß. Christus und die Heiligen sollten den Menschen näher gebracht werden, aber man sah in ihnen nicht nur eine „psychologische Anregung zur Frömmigkeit“,[4] sondern auch die Gegenwart des Dargestellten. Jedoch hatte es in Byzanz immer auch eine bilderfeindliche Richtung gegeben. Die zentrale Frage zwischen Ikonodulen und Ikonoklasten war, ob die Bilder Gott wohlgefällig waren oder nicht. Die Ikonoklasten gaben zu bedenken, daß Gott in den zehn Geboten ausdrücklich die Verehrung von Bildern verboten habe. Man befürchtete seinen Zorn hervorzurufen. Der Beginn des Bilderstreits lag im Jahre 726, als Kaiser Leon III ein Christusbild vom Portal des Kaiserpalastes entfernen ließ. Unter ihm kam es erstmals zur Beseitigung von Christus- und Heiligenbildern. Dies führte zu Unruhen in verschiedenen Teilen des Reiches und zu blutigen Auseinandersetzungen in Konstantinopel.[5] Da es Leon III. nicht gelang den Patriarchen Germanos von Konstantinopel zu überzeugen, setzte er diesen ab. Auch bei dem Papst erlangte er keine Zustimmung. Nach Thiel scheint es so zu sein, daß Rom sogar versuchte, den Streit anzufachen, um so die politische Stellung des Kaisers zu schwächen und mehr Einfluß auf das von Byzanz beherrschte Süditalien zu bekommen.[6] Dies führte dazu, daß zwischen dem byzantinischem Kaiser und dem Papst auf dogmatischem Gebiet eine tiefe Uneinigkeit herrschte. Politisch wurde diese dadurch vertieft, daß der Kaiser alle Kircheneinkünfte als Steuern einziehen wollte, was Rom allerdings verweigerte, und daß Byzanz 732 eine gescheiterte Flottenexpedition gegen Italien unternahm.[7] Zwar waren die Folgen in Byzanz selber zunächst noch nicht gravierend, da sich die Gegner bewußt waren, daß sie sich einen theologischen Streit, der alle Kräfte binden und das Reich spalten könnte, nicht leisten konnten,[8] dafür hatte der Bilderstreit schon recht früh zu einem Zerwürfnis mit Rom geführt. Eine Folge war, daß der Papst nicht mehr mit der Hilfe von Byzanz z. B. gegen die Langobarden rechnen konnte und sich daher nach neuen „Bundesgenossen“ umsah. Damit trug der Bilderstreit von Byzanz zu einer Annäherung zwischen dem Frankenreich und Rom bei.
Unter Leons Nachfolger Konstantin V. kam es zu einer Verschärfung der Situation.[9] Auf einer Synode in Hiereia im Jahr 754 wurde die Unzulässigkeit der Bilderverehrung theologisch begründet und danach vehement verfolgt. Jeglicher Bilderdienst wurde verurteilt und die Vernichtung der Kultbilder angeordnet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Kaiser bereits die höchsten kirchlichen Ämter mit Personen seines Vertrauens besetzt und soweit seine und deren Macht reichte, wurden die Beschlüsse umgesetzt. Dabei kam es auch zu härteren Maßnahmen als unter Leon III. Auch wenn es noch Widerstand im Reich gegen die ikonoklastische Politik gab, verschafftem dem Kaiser seine außenpolitischen Erfolge Rückhalt in der Bevölkerung. Denn den Menschen schien sich zu zeigen, daß Siege auch ohne den Rückhalt von Ikonen erlangt werden konnten.[10]
2.2. Die Wiederherstellung der Bilder unter Irene
Nach dem Tod von Konstantin V. endete die Verfolgung der Bilderverehrung. Unter Leon IV. kam es zwar nicht zu einem Kurswechsel in der grundsätzlichen Ablehnung der Bilder, allerdings ahndete er die Bilderverehrung nicht. Das mag an dem Einfluß seiner Frau Irene gelegen haben, die aus Athen stammte und aus einer bilderfreundlichen Umgebung kam. Nach seinem Tod übernahm sie die Regentschaft für den zehnjährigen Sohn Konstantin VI. Sie strebte ein Ende der Bilderfeindschaft an.[11] Dazu setzte sie 784 Tarasios, einen bilderfreundlichen Patriarchen, in Konstantinopel ein. Sie lud für 786 zu einer Synode nach Konstantinopel ein, jedoch wurde diese durch eine Palastgarde gesprengt, die immer noch den Edikten von Konstantin V. die Treue hielt. Es drohten gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppierungen und Irene gab nach. Das zeigt, wie stark noch der bilderfeindliche Widerstand in Byzanz war. Ein Jahr später, nachdem Irene die illoyalen Truppen auf einen Feldzug geschickt hatte, berief sie erneut die Synode ein. Diesmal fand sie in Nicäa statt, nur die feierliche Schlußsitzung hielt man in Konstantinopel ab. Die Synode tagte einen Monat, die Zahl der Teilnehmer schwankte zwischen 252 und 365. Zwar als ökumenische Synode abgehalten, war die Zusammensetzung dennoch eine fast rein byzantinisch-konstantinopolitanische.[12] Aus Rom kamen immerhin zwei päpstliche Gesandte. Die fränkische Kirche hatte Irene nicht eingeladen. Sie verkannte nicht die politische Macht des Frankenreiches, aber sie sah in deren Kirche nur einen Bestandteil des römischen Patriarchats. Dem Papst war dies nur recht, da er eine Einmischung Karls des Großen in die orientalischen Verhältnisse vermeiden wollte.[13]
Auf der Synode 787 in Nicäa war beschlossen worden, daß man den Bildern „proskynesis“ (Verehrung) schulde. Die „latreia“ (Anbetung) hingegen sei alleine Gott vorbehalten. Der Ikonoklasmus der vorherigen Jahrzehnte wurde verurteilt und die Synode von Hiereia als ungültig erklärt, da sie ohne Mitwirkung des Papstes stattfand.
[...]
[1] Anderer Ansicht sind unter anderem Peter Brown und Hans Georg Thümmel. Peter Brown geht von gelegentlichen Gewaltakten aus, um die von ikonodulen Autoren „viel Aufhebens gemacht wurde“. Vgl. Peter Brown: Die Entstehung des christlichen Europa, München 1996, S. 278. (im folgenden zitiert als: Die Entstehung). Nach Hans Georg Thümmel war der Bilderstreit weniger bedeutsam als es die Geschichtsschreibung wahr haben möchte. Vgl. Hans Georg Thümmel: Der byzantinische Bilderstreit, in: Theologische Rundschau 61 (1996), S. 356 f (im folgenden zitiert als: Hans Georg Thümmel: Bilderstreit). Da von dem Schrifttum der Ikonoklasten wenig erhalten ist und das Meiste der „Polemik“ der Ikonodulen entstammt, ist eine kritische Perspektive durchaus angebracht. Vgl. auch Hans Georg Thümmel: Bilderlehre und Bilderstreit, Würzburg 1991, S. 40. (im folgenden zitiert als: Bilderlehre)
[2] Vgl. Peter Classen: Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums, 2 Auflage, Sigmaringen 1988, S. 3 (im folgenden zitiert als: Peter Classen: Karl, Papstum, Byzanz) ; Gert Haendler: Epochen der karolingischen Theologie, Berlin 1958, S. 17ff. 278 (im folgenden zitiert als: Gert Haendler: Epochen)
[3] Vgl. Hubert Mordek: Zur Kirchenrechtsreform am Beispiel des Frankfurter Kapitulars, in: Fried, Johannes (Hrsg.): 794 - Karl der Große in Frankfurt am Main. Ein König bei der Arbeit, Sigmaringen 1994, S. 46.
[4] Klaus Schatz: Allgemeine Konzilien. Brennpunkte der Kirchengeschichte, Paderborn, München, Wien, Zürich 1997, S. 88. (im folgenden zitiert als: Klaus Schatz: Brennpunkte)
[5] Vgl. Herbert Schade: Die Libri Carolini und ihre Stellung zum Bild, in: Zeitschrift für katholische Theologie 79 (1957), S. 69; Andreas Thiel: Der Bilderstreit in Byzanz, in: Fried, Johannes (Hrsg.): 794 - Karl der Große in Frankfurt am Main – ein König bei der Arbeit, Sigmaringen 1994, S.64 f. (im folgenden zitiert als: Andreas Thiel: Bilderstreit)
[6] Vgl. Andreas Thiel: Bilderstreit, S. 64.
[7] Vgl. Helmut Nagel: Karl der Große und die theologischen Herausforderungen seiner Zeit. Zur Wechselwirkung zwischen Theologie und Politik im Zeitalter des großen Frankenherrschers, Frankfurt am Main u. a. 1998, S. 145. (im folgenden zitiert als: Helmut Nagel: Karl der Große)
[8] Vgl. Peter Brown: Die Entstehung, S. 278.
[9] Ludwig Mödl sieht einen Anlaß in dem Aufstand des Schwagers von Konstantin V. Dieser hatte sich zum Gegenkaiser ausrufen lassen und sich dazu mit den Bilderfreunden verbündet. Nach deren Niederlage, habe sich Konstantin blutig an seinen Gegnern gerächt, so auch an den Bilderfreunden. Vgl. Ludwig Mödl: Die Spiritualität des Schauens. Bilderverehrung und adoratio in der christlichen Frömmigkeitspraxis, Regensburg 1995, S. 7.
[10] Vgl. Peter Brown: Die Entstehung, S. 279.
[11] Hauck sieht darin vor allem ein politisches Interesse, da Irenes Stellung als Frau nicht sonderlich gefestigt war und sie sich damit sowohl der bilderfreundlichen Opposition wie auch Rom annähern wollete. Vgl. Albert Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands 2. Teil, 5. Auflage, Leipzig 1935, S. 324. (im folgenden zitiert als: Albert Hauck: Kirchengeschichte)
[12] Vgl. Klaus Schatz: Brennpunkt, S. 90.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text über den byzantinischen Bilderstreit und die Synode von Frankfurt?
Der Text behandelt den byzantinischen Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts, insbesondere die Auseinandersetzung zwischen Ikonodulen (Bilderverehrern) und Ikonoklasten (Bilderzerstörern). Er untersucht, wie dieser Streit das Verhältnis zwischen Byzanz, Rom und dem Frankenreich beeinflusste, insbesondere im Hinblick auf die Synode von Nicäa (787) und die darauf folgende Reaktion Karls des Großen und seiner Gelehrten, die in den Libri Carolini und der Synode von Frankfurt (794) ihren Ausdruck fand.
Was war der byzantinische Bilderstreit?
<Der byzantinische Bilderstreit war eine religiöse und politische Kontroverse im byzantinischen Reich über die Zulässigkeit der Verehrung von Ikonen (Heiligenbilder). Ikonoklasten lehnten die Bilderverehrung ab und zerstörten Ikonen, während Ikonodulen die Verehrung verteidigten.
Welche Rolle spielte Kaiser Leon III. im byzantinischen Bilderstreit?
Kaiser Leon III. gilt als Auslöser des Bilderstreits. Im Jahr 726 ließ er ein Christusbild vom Portal des Kaiserpalastes entfernen, was zu Unruhen und Auseinandersetzungen führte. Er setzte auch den Patriarchen Germanos von Konstantinopel ab, der sich gegen seine Politik aussprach.
Wie reagierte das Papsttum auf den byzantinischen Bilderstreit?
Das Papsttum lehnte die ikonoklastische Politik der byzantinischen Kaiser ab. Dies führte zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Byzanz und Rom. Der Papst suchte daraufhin Unterstützung bei den fränkischen Herrschern.
Was geschah auf der Synode von Nicäa im Jahr 787?
Die Synode von Nicäa, einberufen von Kaiserin Irene, stellte die Bilderverehrung im byzantinischen Reich wieder her. Sie verurteilte den Ikonoklasmus und erklärte die Synode von Hiereia (754), die die Bilderverehrung verboten hatte, für ungültig.
Wie reagierte Karl der Große auf die Synode von Nicäa?
Karl der Große und seine Gelehrten reagierten kritisch auf die Synode von Nicäa. Sie verfassten die Libri Carolini, in denen sie die Bilderverehrung ablehnten, und thematisierten das Problem auf der Synode von Frankfurt im Jahr 794, wo die Bilderverehrung ebenfalls verurteilt wurde.
Was sind die Libri Carolini?
Die Libri Carolini sind eine Abhandlung, die im Auftrag Karls des Großen verfasst wurde und die fränkische Position zur Bilderverehrung darlegt. Sie lehnen die Bilderverehrung ab und stellen eine theologische Auseinandersetzung mit den Beschlüssen der Synode von Nicäa dar.
Was geschah auf der Synode von Frankfurt im Jahr 794?
Auf der Synode von Frankfurt im Jahr 794 wurde die Bilderverehrung thematisiert und im Kapitular, dem Schlußdokument, sowohl die Synode von Nicäa als auch die wieder eingeführte Bilderverehrung verurteilt.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Libri Carolini, das Kapitular der Frankfurter Synode, die Königsurkunde vom 22. Februar 794, das Lorscher Annalenfragment und ein Brief von Papst Hadrian I.
Welche Bedeutung hatte der Bilderstreit für das Verhältnis zwischen dem Frankenreich und dem Papsttum?
Der byzantinische Bilderstreit trug zur Annäherung zwischen dem Frankenreich und dem Papsttum bei. Da der Papst aufgrund des Bilderstreits nicht mehr mit der Unterstützung von Byzanz rechnen konnte, suchte er neue Verbündete und fand diese in den fränkischen Herrschern.
- Quote paper
- Sara Lohoff (Author), 2004, Der Bilderstreit auf der Synode in Frankfurt 794 n. Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113616