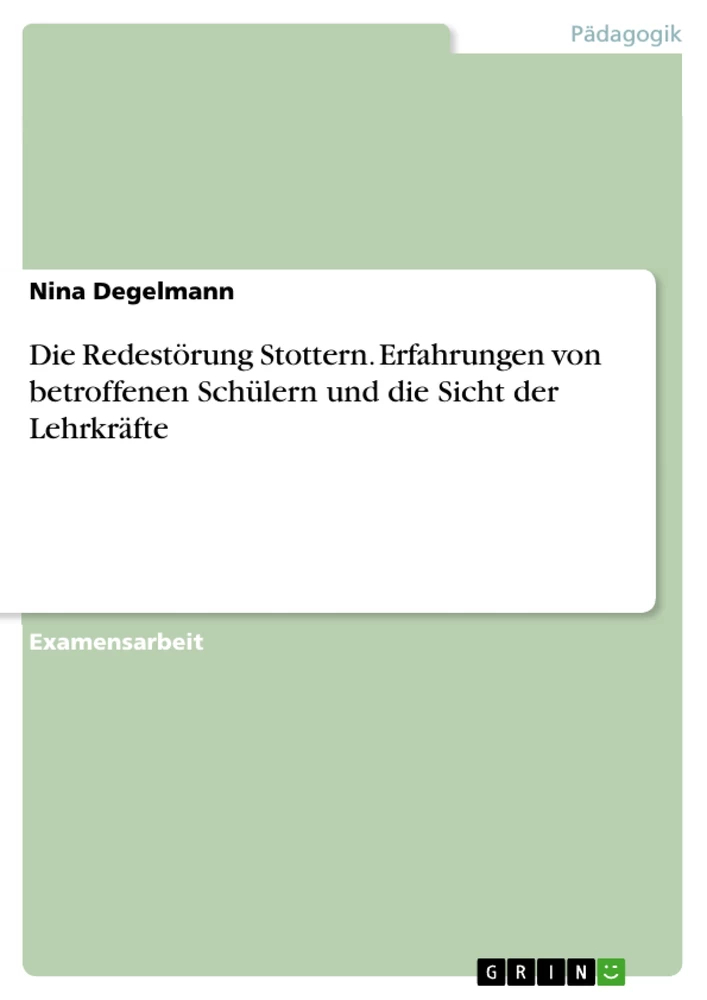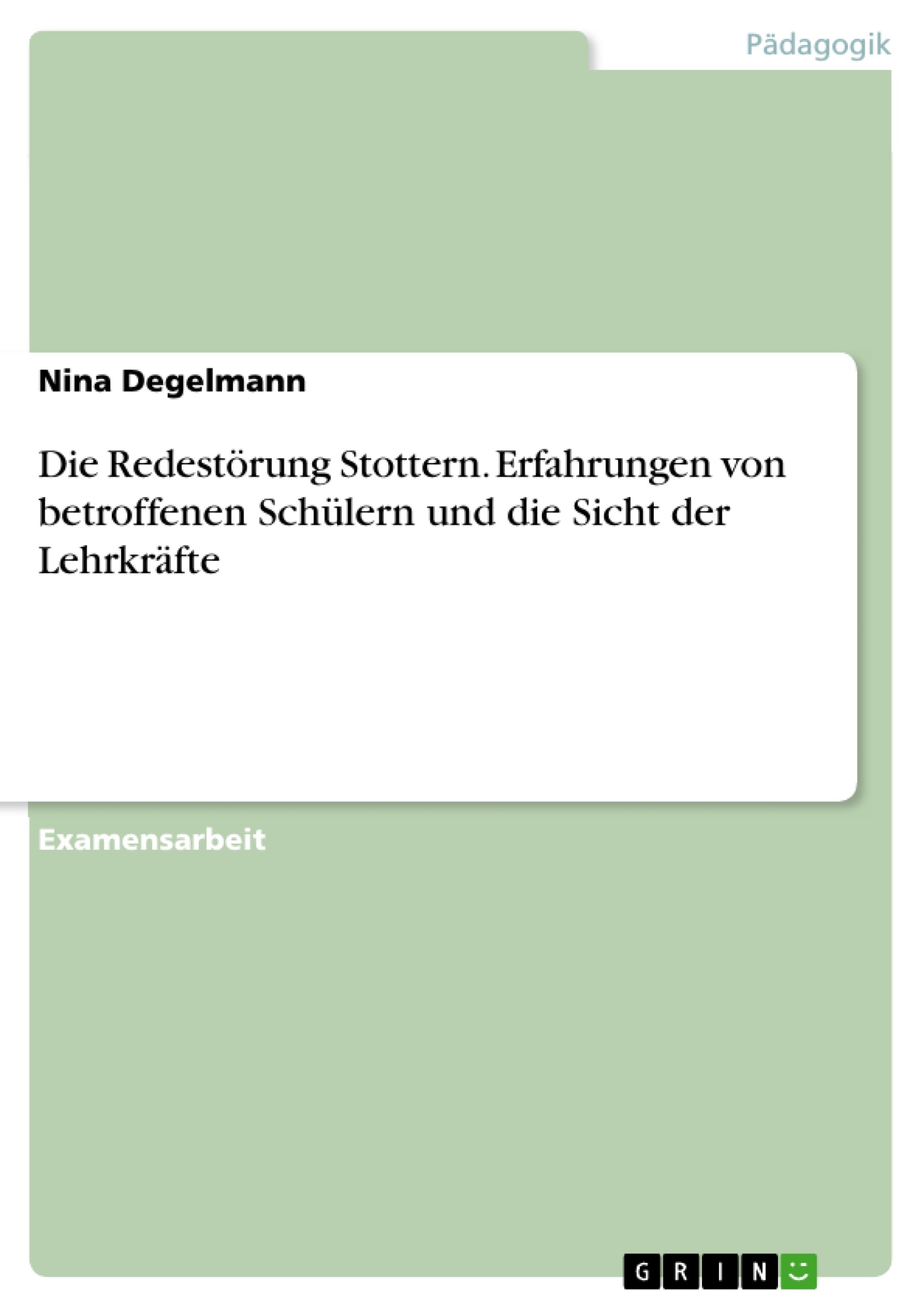„Angst, Scham, Unsicherheit, Minderwertigkeitsgefühle, Unruhe,
Konzentrationsprobleme beim Sprechen, Gefühlschaos, Angst vor dem
Entdecktwerden, Tabuthema“
Diese Stichworte spiegeln die Erfahrungen und Assoziationen eines ehemaligen,
stotternden Schülers im Hinblick auf das Thema „Schule“ wider. So wie dieser
Teilnehmer der Stotterer-Selbsthilfegruppe in Stuttgart oder so ähnlich reflektieren viele Stotternde ihre Schulzeit.
„Manchmal fühle ich mich mit ihm schon überfordert…irgendwie ist man eben hilflos, wenn man nicht weiß, wie man mit ihm umgehen soll. Er redet ja auch nie über sein Problem und seine Eltern auch nicht…mir ist es auch erst nach Wochen aufgefallen.“
Dieses Zitat stammt von einer Lehrerin der ersten Klasse an einer Stuttgarter
Grundschule. Es macht deutlich, dass nicht nur stotternde Schüler über Probleme in ihrer Schulzeit klagen, sondern auch ihre Lehrer oft überlastet sind.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Erfahrungen stotternde
Schüler und ihre unterrichtenden Lehrer miteinander bzw. mit der Schule machen. Ist Schule für Stotternde wirklich ein Spießrutenlauf? Warum wird von ihnen häufig der Begriff „Angst“ im Zusammenhang mit Schule verwendet? Und welche
Herausforderung stellt ein stotternder Schüler an einen Lehrer? Benötigt er eine
Sonderbehandlung? Was wissen Lehrer überhaupt zum Thema „Stottern“? Diese
und viele weitere Fragen sollen im Verlauf der Arbeit geklärt werden. Um einen
Einblick in die Ansichten beider Personengruppen zu erhalten, werden ehemalige
Schüler und Lehrer auf verschiedene Art und Weise befragt und infolgedessen
untersucht. Eventuell auftretende Schwierigkeiten werden daraufhin analysiert und mögliche Alternativen oder eventuelle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Bevor der Begriff „Stottern“ jedoch in den Zusammenhang mit Schule gebracht
werden kann, wird im ersten Teil der vorliegenden Arbeit erörtert, um welche Art von Störung es sich dabei überhaupt handelt. Um „Stottern“ zu verstehen bzw. es
kennen zulernen, sind die Erläuterungen wichtiger theoretischer Fakten unerlässlich. Der Zusammenhang mit der Institution Schule ist jedoch auch an dieser Stelle gegeben. Es ist immerhin nicht unerheblich für Lehrer zu wissen, welche Symptome Stotternde zeigen und welche Therapiemöglichkeiten es für Schüler gibt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Theoretischer Teil
- 1 Einleitung
- 2 Stottern und Sprache
- 2.1 Versuch einer Definition von „Stottern“
- 2.2 Klassifikation (ICD-10)
- 2.3 Einordnung und Beschreibung des Stotterns
- 2.4 Abgrenzung der Redeflussstörung Stottern von Störungen der Sprache und der Aussprache
- 2.5 Die Sprachentwicklung bei Kindern
- 2.5.1 Unterschiede in der Sprachentwicklung (Produktion) zwischen nicht-stotternden und stotternden Kindern
- 3 Idiopathisches Stottern - Entstehung, Entwicklung und Erscheinung
- 3.1 Entstehung kindlichen Stotterns
- 3.2 Abgrenzung des idiopathischen Stotterns von anderen Störungen der Rede
- 3.2.1 Normale, entwicklungsbedingte Sprechunflüssigkeiten
- 3.2.2 Poltern
- 3.2.3 Neurogenes/ psychogenes, erworbenes Stottern
- 3.2.4 Totaler/ elektiver Mutismus
- 3.2.5 Spasmodische Dysphonie
- 3.3 Epidemiologie
- 3.3.1 Beginn
- 3.3.2 Geschlechterverteilung
- 3.3.3 Inzidenz & Prävalenz
- 3.3.4 Remission
- 3.4 Symptomatik
- 3.4.1 Sprechsymptome (→ Kernsymptome) und Begleitsymptome
- 3.4.2 Coping-Strategien
- 3.4.3 Innere Symptome
- 4 Idiopatisches Stottern - Verursachende Bedingungen
- 4.1 Hypothesen zur Verursachung
- 4.2 Disponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren kindlichen Stotterns
- 4.2.1 Disponierende Faktoren
- 4.2.2 Auslösende Faktoren
- 4.2.3 Aufrechterhaltende Faktoren
- 4.2.4 Multifaktorielle Verursachung
- 5 Idiopatisches Stottern - Ein Einblick in Diagnostik und Therapie
- 5.1 Grundsätze der Diagnostik bei Stottern im Kindesalter
- 5.2 Bereiche der Diagnostik
- 5.3 Differentialdiagnose
- 5.4 Auswertung und Prognose
- 5.5 Therapiemöglichkeiten für Kinder
- 5.5.1 Ziele der Stottertherapie
- 5.5.2 Indirekte Therapien
- 5.5.3 Direkte Therapien
- 5.5.4 Mischformen
- 5.5.5 Effektivität der Therapien
- 5.5.6 Sonstige Behandlungsformen
- 5.5.7 Therapieansätze für Schüler
- 5.5.7.1 Schul-KIDS
- II. Schulischer Teil
- 6 Verschiedene Perspektiven des Stotterns
- 6.1 Schülersicht
- 6.2 Lehrersicht
- 6.3 Mitschülersicht
- 6.4 Elternsicht
- 6.5 Offenheit als Grundprinzip
- 7 Stottern und Schule
- 7.1 Beschulungsformen für betroffene Kinder
- 7.1.1 Regelschule
- 7.1.2 Sprachheilschule
- 7.2 Fördermöglichkeiten und Hilfestellungen für stotternde Kinder an Regelschulen
- 7.2.1 Gesprächsverhalten
- 7.2.2 Unterricht/Unterrichtsgestaltung
- 7.2.3 Vorlesen als besondere Herausforderung
- 7.2.4 Förderung eines sozialen Miteinanders
- 7.2.5 Schonen oder fordern?
- 7.3 Kooperationen
- 7.3.1 Zusammenarbeit mit Therapeuten und Beratungsstellen
- 7.3.2 Zusammenarbeit mit den Eltern
- 7.4 Stottern als Behinderung
- 7.4.1 Rechtlicher Standpunkt
- 7.4.2 Nachteilsausgleich
- 7.4.3 Behandlung im Unterricht
- 7.5 Mobbing und Hänseleien – Möglichkeiten der Verringerung
- 7.5.1 Aufklärung der Schüler
- 7.5.2 ,,Stärkung" des Stotternden
- III. Empirischer / Praktischer Teil
- 8 Persönliche Motivation zur Auswahl des Thema
- 9 Methodisches Vorgehen
- 9.1 Beschreibung der Methoden - Qualitativer und quantitativer Ansatz
- 9.2 Durchführung der Methoden
- 9.3 Begründung der Methoden
- 10 Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe für Stotternde in Stuttgart
- 10.1 Kontaktaufnahme, Informationsbeschaffung und Vermittlung von Interviewpartnern
- 10.2 Erfahrungen bei den Treffen der Selbsthilfegruppe
- 10.3 Mitgestaltung einer Radiosendung des „Stotterfunk“
- 10.4 Funktion einer Selbsthilfegruppe – Möglichkeiten für Schüler
- 11 Auswertung der empirischen Untersuchungen
- 11.1 Auswertung der Interviews mit ehemals stotternden Schülern
- 11.1.1 Fragestellung und Intentionen
- 11.1.2 Ergebnisse des Interviews mit Rückbezug auf die Theorie
- 11.1.3 Bewertung des Interviews
- 11.2 Auswertung des Fragebogens mit praktizierenden Lehrerinnen und Lehrern
- 11.2.1 Fragestellung, Intentionen und Hypothesen
- 11.2.2 Ergebnisse der Auswertung mit Überprüfung der Hypothesen und in Bezug auf das Interview
- 11.2.3 Bewertung des Fragebogens
- 12 Resümee
- 12.1 Didaktische Überlegungen - Bezug zum Bildungsplan
- 12.2 Die Situation für stotternde Kinder an deutschen Regelschulen
- 12.3 ,,Stotterfreundliche(r)" Schule / Unterricht?
- 12.4 Fazit
- 13 Literaturverzeichnis
- Anhang
- Definition und Klassifikation des Stotterns
- Entstehung, Entwicklung und Erscheinungsformen des idiopathischen Stotterns
- Verursachende Bedingungen und Einflussfaktoren
- Diagnostik und Therapie des Stotterns
- Schwierigkeiten und Herausforderungen für stotternde Schüler im schulischen Kontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Redestörung Stottern und untersucht die Erfahrungen von betroffenen Schülern sowie die Sichtweise von Lehrkräften. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse von stotternden Schülern im schulischen Kontext zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte zu formulieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil der Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Redestörung Stottern. Es werden verschiedene Definitionen und Klassifikationen des Stotterns vorgestellt, die Entstehung und Entwicklung des idiopathischen Stotterns erläutert und die Verursachenden Bedingungen sowie Einflussfaktoren beleuchtet. Des Weiteren werden Diagnostik und Therapie des Stotterns im Kindesalter behandelt.
Der schulische Teil der Arbeit widmet sich den verschiedenen Perspektiven auf das Stottern, insbesondere aus der Sicht von Schülern, Lehrkräften, Mitschülern und Eltern. Es werden die Beschulungsformen für stotternde Kinder, die Fördermöglichkeiten und Hilfestellungen an Regelschulen sowie die rechtlichen Aspekte des Stotterns als Behinderung beleuchtet. Darüber hinaus werden Mobbing und Hänseleien als besondere Herausforderungen für stotternde Schüler thematisiert.
Der empirische Teil der Arbeit basiert auf qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden. Es werden Interviews mit ehemals stotternden Schülern und Fragebögen mit praktizierenden Lehrkräften ausgewertet, um die Erfahrungen und Perspektiven der jeweiligen Gruppen zu beleuchten. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen werden mit den theoretischen Erkenntnissen aus dem ersten Teil der Arbeit in Beziehung gesetzt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Redestörung Stottern, die Erfahrungen von betroffenen Schülern, die Sichtweise von Lehrkräften, die Herausforderungen und Bedürfnisse von stotternden Schülern im schulischen Kontext, die Entstehung, Entwicklung und Erscheinungsformen des idiopathischen Stotterns, die Verursachenden Bedingungen und Einflussfaktoren, Diagnostik und Therapie des Stotterns, die Beschulungsformen für stotternde Kinder, die Fördermöglichkeiten und Hilfestellungen an Regelschulen, die rechtlichen Aspekte des Stotterns als Behinderung, Mobbing und Hänseleien, qualitative und quantitative Forschungsmethoden, Interviews mit ehemals stotternden Schülern, Fragebögen mit praktizierenden Lehrkräften.
- Arbeit zitieren
- Nina Degelmann (Autor:in), 2008, Die Redestörung Stottern. Erfahrungen von betroffenen Schülern und die Sicht der Lehrkräfte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113578