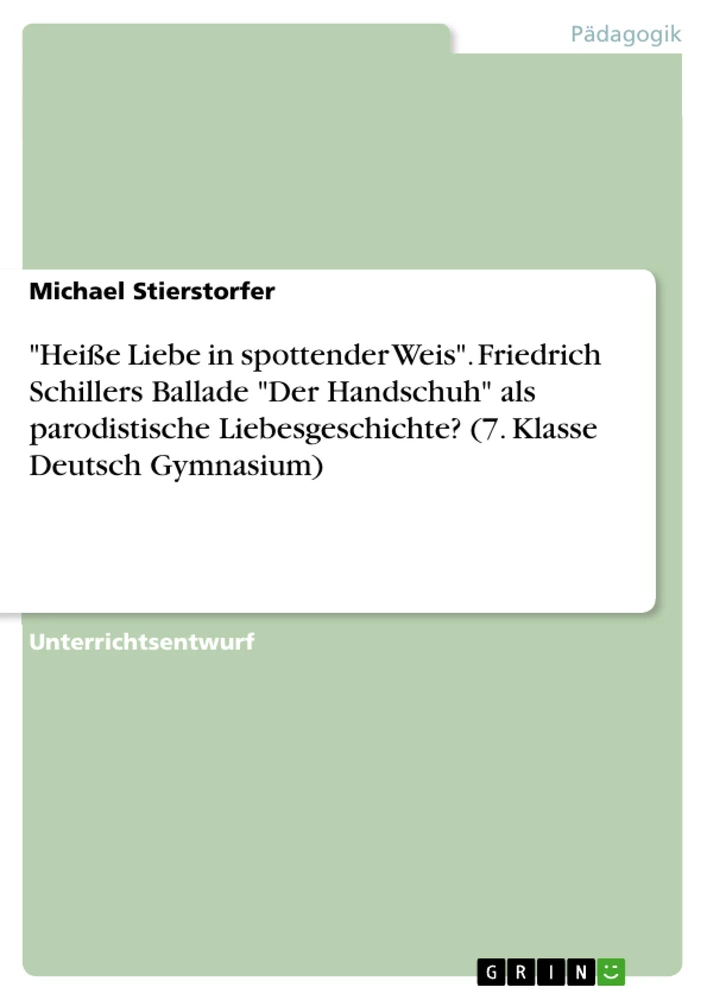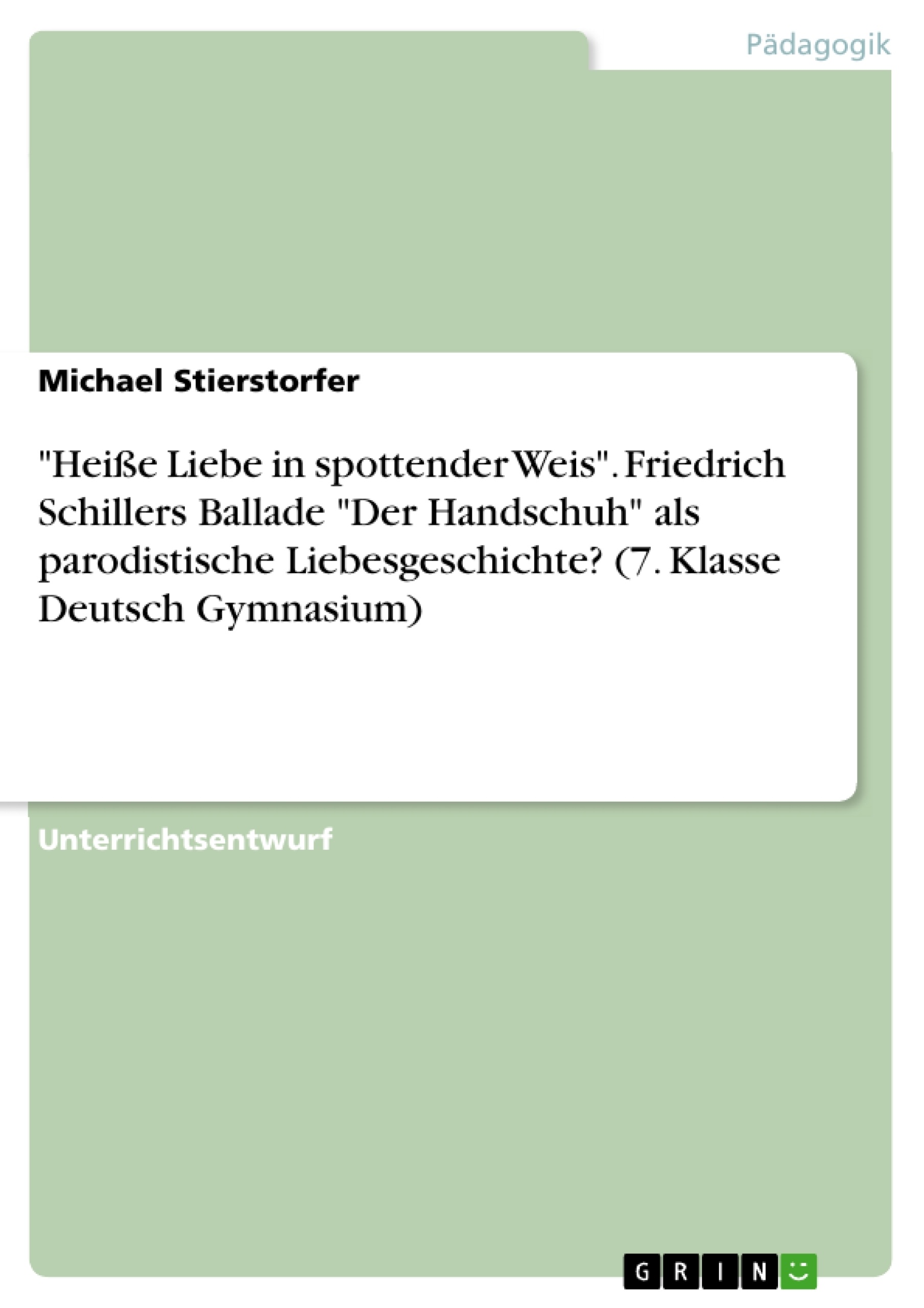In diesem Unterrichtskonzept bzw. Lehrprobenkonzept für eine siebte Klasse (Gymnasium) findet sich eine kompetenzorientierte Umsetzungsmöglichkeit zur Thematisierung der Ballade "Der Handschuh" von Friedrich Schiller im Deutschunterricht. Als innovatives Element wird anhand von Figuren- und Handlungsanalysen wird der These Rechnung getragen, dass es sich bei der Ballade um eine Parodie des mittelalterlichen Minnedienstes handelt. Als Hilfsmittel bekommen die Schüler:innen Bildimpulse an die Hand. Die Heranwachsenden erarbeiten die intendierten Kompetenzen arbeitsteilig und präsentieren sodann ihre Ergebnisse. Das Konzept enthält als Highlight konkrete und praxiserprobte Kopiervorlagen zum sofortigen Einsatz im Unterricht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Friedrich Schillers Ballade „Der Handschuh“ im Deutschunterricht
- 1.1 „Der Handschuh“ als Liebesgeschichte?
- 1.2 Einbettung der Lehrprobenstunde in die aktuelle Unterrichtssequenz
- 1.3 Zum Lehrplanbezug der Lehrprobenstunde
- 1.4 Geplanter Stundenverlauf unter Einbezug der angestrebten Kompetenzen
- 2. Literaturverzeichnis
- 2.1 Primärmedien
- 3. Anhang mit Materialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtskonzeption ist die Analyse von Schillers Ballade „Der Handschuh“ im Deutschunterricht der 7. Klasse. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Ballade als Liebesgeschichte und der Auseinandersetzung mit den darin enthaltenen Konzepten von Minne und höfischer Liebe im Vergleich zu modernen Verständnisweisen. Die Schüler sollen ihre literarischen Kompetenzen im Umgang mit poetischen Texten schulen.
- Interpretation von Schillers „Der Handschuh“ als Liebesgeschichte
- Vergleich mittelalterlicher und moderner Liebeskonzepte
- Analyse der Figuren Delorges und Kunigunde
- Erörterung der Rolle des Handschuhs als Symbol
- Einbettung der Ballade in den Kontext des mittelalterlichen höfischen Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Friedrich Schillers Ballade „Der Handschuh“ im Deutschunterricht: Dieses Kapitel begründet die Wahl von Schillers Ballade „Der Handschuh“ als Unterrichtsgegenstand für eine 45-minütige Stunde in der 7. Klasse. Es wird die Eignung des Textes hinsichtlich Länge und Thematik hervorgehoben, wobei die zentrale Frage nach der Interpretation als Liebesgeschichte im Vordergrund steht. Die Analyse der ambivalenten Rolle des Handschuhs und die Gegenüberstellung des Verhaltens von Delorges und Kunigunde mit den Idealen der höfischen Minne werden als zentrale Aspekte der Unterrichtsstunde genannt. Die unterschiedlichen Schlussfassungen der Ballade werden kurz angesprochen, wobei die Verwendung der ersten Fassung für den Unterricht aufgrund ihrer didaktischen Eignung favorisiert wird. Die parodistische Natur der Ballade wird als anspruchsvoller Aspekt für eine Hausaufgabe vorgeschlagen.
1.1 „Der Handschuh“ als Liebesgeschichte?: Dieser Abschnitt analysiert die Ballade eingehender. Er befasst sich mit der Frage, ob die Handlung als Liebesgeschichte zu interpretieren ist und diskutiert die Rolle des Handschuhs als Liebespfand und gleichzeitig als Instrument der Demütigung. Der Hochmut Kunigundes und die Reaktion Delorges werden kritisch betrachtet und im Kontext der höfischen Minne und des mittelalterlichen Wertesystems eingeordnet. Der Vergleich mit anderen literarischen Werken wie dem "Parzival" verdeutlicht die Abweichung von traditionellen Minne-Idealen. Das Kapitel betont die ironische Ebene der Ballade und die Möglichkeit der Interpretation als Parodie höfischer Liebeskonventionen.
1.2 Einbettung der Lehrprobenstunde in die aktuelle Unterrichtssequenz: Hier wird die Ballade in den Kontext einer bereits laufenden Unterrichtseinheit zum Thema Mittelalter eingeordnet. Der Bezug zum Nibelungenlied und zu den dort behandelten Themen wie Brautwerbung, gesellschaftliche Konventionen und Konflikte wird hergestellt. Die Einordnung in den Lehrplan und die angestrebten Kompetenzen, insbesondere im Bereich der literarischen Analyse, werden detailliert erläutert. Die vorherigen Unterrichtsaktivitäten der Schüler, wie die Erstellung von Plakaten zu mittelalterlichen Gattungen, werden erwähnt, um den Zusammenhang zum aktuellen Thema zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Der Handschuh, Ballade, Liebesgeschichte, höfische Minne, Mittelalter, Ritter, Dame, Symbolanalyse, Parodie, Ironie, Lehrplan, Deutschunterricht, Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen zu: Friedrich Schillers Ballade „Der Handschuh“ im Deutschunterricht
Was ist der Inhalt dieser Unterrichtskonzeption?
Diese Arbeit präsentiert eine detaillierte Unterrichtskonzeption für eine 45-minütige Stunde in der 7. Klasse zum Thema Friedrich Schillers Ballade „Der Handschuh“. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Ballade als Liebesgeschichte und der Auseinandersetzung mit den darin enthaltenen Konzepten von Minne und höfischer Liebe im Vergleich zu modernen Verständnisweisen. Die Schüler sollen ihre literarischen Kompetenzen schulen.
Welche Themen werden in der Unterrichtsstunde behandelt?
Die zentralen Themen sind die Interpretation von Schillers „Der Handschuh“ als Liebesgeschichte, der Vergleich mittelalterlicher und moderner Liebeskonzepte, die Analyse der Figuren Delorges und Kunigunde, die Erörterung der Rolle des Handschuhs als Symbol und die Einbettung der Ballade in den Kontext des mittelalterlichen höfischen Lebens. Die ambivalente Rolle des Handschuhs und der Vergleich des Verhaltens der Figuren mit den Idealen der höfischen Minne spielen eine wichtige Rolle.
Wie wird die Ballade im Unterricht interpretiert?
Die Unterrichtsstunde analysiert die Ballade in Bezug auf ihre mögliche Interpretation als Liebesgeschichte. Dabei werden die Rolle des Handschuhs als Liebespfand und Demütigungssymbol, der Hochmut Kunigundes und die Reaktion Delorges kritisch beleuchtet und im Kontext der höfischen Minne und des mittelalterlichen Wertesystems eingeordnet. Die ironische und parodistische Ebene der Ballade wird ebenfalls thematisiert. Der Vergleich mit anderen Werken, wie dem "Parzival", wird herangezogen.
Wie ist die Stunde in die Unterrichtssequenz eingebunden?
Die Stunde wird in den Kontext einer bestehenden Unterrichtseinheit zum Thema Mittelalter eingeordnet. Der Bezug zum Nibelungenlied und zu den dort behandelten Themen wie Brautwerbung, gesellschaftliche Konventionen und Konflikte wird hergestellt. Die Einordnung in den Lehrplan und die angestrebten Kompetenzen, insbesondere im Bereich der literarischen Analyse, werden detailliert erläutert. Die vorherigen Schüleraktivitäten, wie die Erstellung von Plakaten zu mittelalterlichen Gattungen, werden berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Der Handschuh, Ballade, Liebesgeschichte, höfische Minne, Mittelalter, Ritter, Dame, Symbolanalyse, Parodie, Ironie, Lehrplan, Deutschunterricht, Kompetenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die die Ballade „Der Handschuh“ im Kontext des Deutschunterrichts der 7. Klasse behandeln. Es gibt ein Kapitel zur Begründung der Textauswahl, ein Kapitel zur detaillierten Analyse der Ballade als Liebesgeschichte, ein Kapitel zur Einbettung in den Unterricht und ein Literaturverzeichnis sowie einen Anhang.
Welche Fassung der Ballade wird verwendet?
Die Unterrichtsstunde verwendet die erste Fassung der Ballade „Der Handschuh“ aufgrund ihrer didaktischen Eignung für den Unterricht in der 7. Klasse.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler durch die Stunde erwerben?
Die Schüler sollen ihre literarischen Kompetenzen im Umgang mit poetischen Texten schulen, insbesondere die Fähigkeit zur Interpretation und Analyse literarischer Texte im Kontext ihres historischen und kulturellen Hintergrunds. Sie sollen lernen, Figuren zu analysieren, Symbole zu deuten und verschiedene Interpretationsebenen zu erkennen.
- Quote paper
- Michael Stierstorfer (Author), 2016, "Heiße Liebe in spottender Weis". Friedrich Schillers Ballade "Der Handschuh" als parodistische Liebesgeschichte? (7. Klasse Deutsch Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1132871