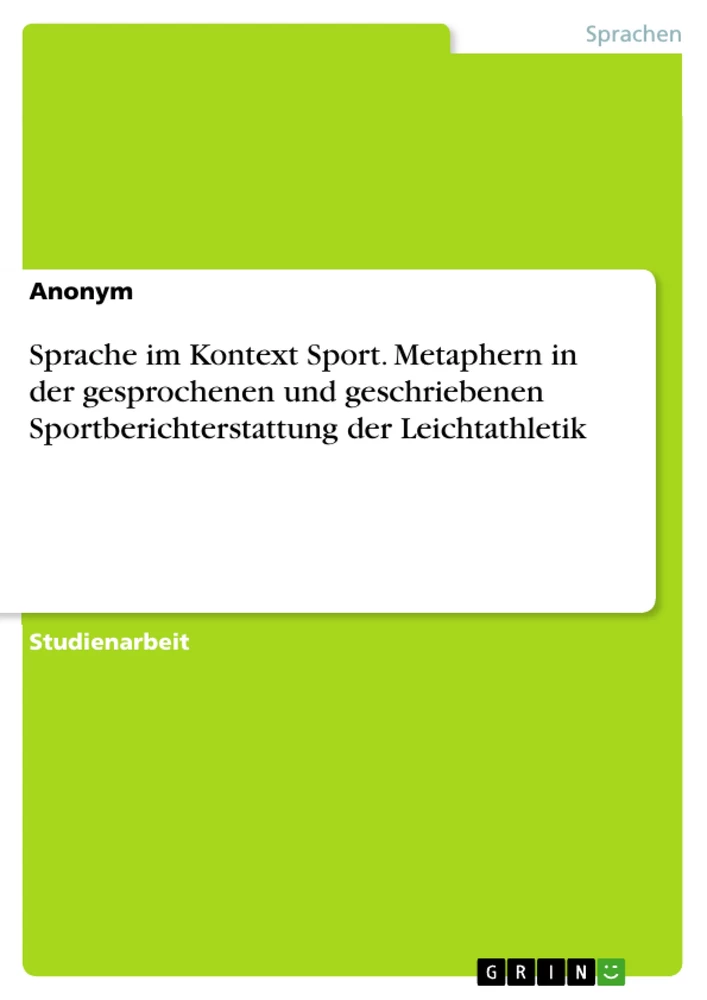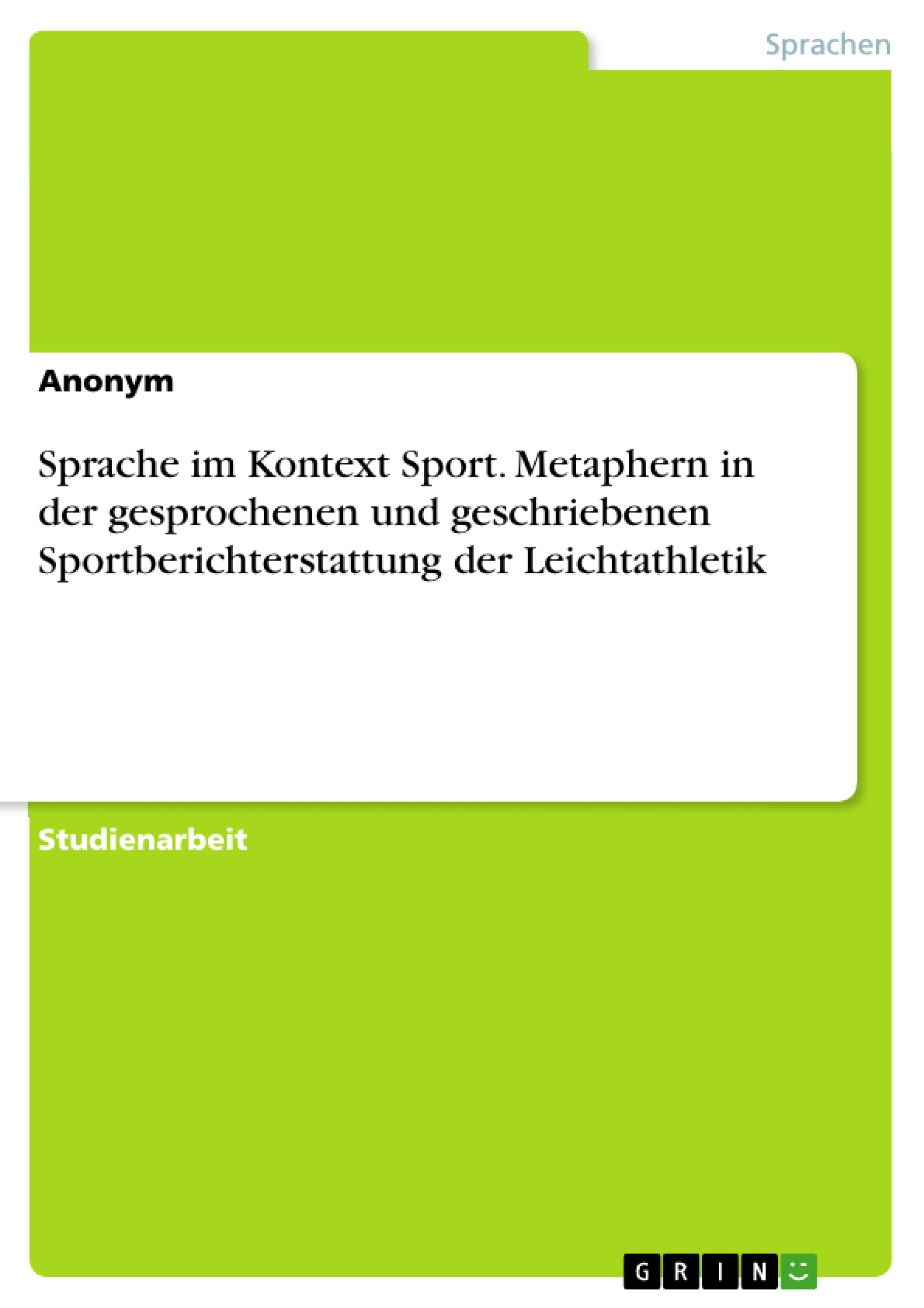Die folgende Abfassung wird sich auf die Sportberichterstattung in Fernsehen und Zeitschriften/ Zeitung beschränken, da es gilt die gesprochene und geschriebene Sprache zu unterscheiden. Das Fernsehen als Repräsentant der gesprochenen Sprache und die Zeitung als Repräsentant der geschriebenen Sprache.
Der Sportberichterstattung wird in den Medien ein immer größerer Stellenwert beigemessen. Immer mehr Sendezeit für den Sport, immer mehr und immer ausführlichere Live-Übertragungen, immer mehr Sportsendungen in immer mehr Sendern. Mit der Ausgestaltung der privaten Rundfunkanstalten ist zugleich ein vielfältiges Sportangebot in Aussicht gestellt worden. Neue Techniken der Bildgestaltung versprechen zudem eine noch qualitativ hochwertigere Darstellung sportlicher Ereignisse. Dem gegenüberzustellen ist die Sportberichterstattung in geschriebener Form. Printmedien, vorwiegend Zeitungen, berichten sowohl über noch anstehende als auch über noch ausstehende Sportveranstaltungen in Textform. Die technische Entwicklung der fortgeschrittenen, modernen Zeit ermöglicht der Sportberichterstattung differenzierter und nahbarer zu berichten. Oben genannte Möglichkeiten gilt es zu unterscheiden und zu differenzieren. Mit dem Wandel der Medien geht der Wandel der Sportberichterstattung einher. Mittlerweile besteht die Möglichkeit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Sportergebnisse und Sportereignisse im Fernsehen zu verfolgen. Doch dies war nicht immer so. Nicht nur die Medien rund um den Sport haben sich verändert, auch der Sport als Sache selbst hat sich in seiner grundlegenden Funktion verändert und dient heute mehr der Unterhaltung als dem Betreiben des Sportes an sich.
Parallel ist der Wandel der Gesellschaft zu beobachten. Neue Möglichkeiten schaffen neue Interessen. Während der Sport zunächst eine in der Gesellschaft untergeordnete Rolle einnimmt und als Beschäftigung des Proletariats gilt, nehmen die Medien bereits im 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle ein. Erste Zeitungen richteten Sportteile ein. Seit Verbreitung des Fernsehens, in den 40er Jahren, besteht die Möglichkeit in bewegten Bildern von Sportereignissen zu berichten.
Heute, im Jahre 2020, besteht die Möglichkeit, der Sportberichterstattung, sowohl in Fernsehen, Radio und Zeitung, Aufmerksamkeit zu schenken. Es gilt die Unterschiede sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Metaphern
- 2.1 Traditionelle Auffassung von Metaphern: Substitutionstheorie
- 2.2 Lackoff und Johnsons kognitiv-konzeptuelle Metapherntheorie
- 3. Definition von Sportsprache
- 3.1 Fachsprache
- 3.2 Jargon
- 4. Sport als mediales Massenphänomen
- 5. Metaphern in der Sprache der Sportberichterstattung
- 6. Analyse: Funktion und Klassifikation der Metaphern in der Sportberichterstattung
- 7. Vergleich: gesprochene und geschriebene Berichterstattung
- 8. Analyse einer Sportberichterstattung in Videoform
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwendung von Metaphern in der Sportberichterstattung, sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Form. Sie analysiert die Funktionen von Metaphern und wie diese in verschiedenen Medien eingesetzt werden.
- Die Bedeutung von Metaphern in der Sportberichterstattung
- Die kognitiv-konzeptuelle Metapherntheorie von Lackoff und Johnson
- Der Vergleich zwischen gesprochener und geschriebener Sprache in der Sportberichterstattung
- Die Rolle der Metaphern in der Fachsprache des Sports
- Die Analyse der Verwendung von Metaphern in verschiedenen Medienformaten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Sportberichterstattung ein und beleuchtet den Wandel der Medienlandschaft sowie die wachsende Bedeutung des Sports in der Gesellschaft. Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der Metapher und unterschiedlichen Theorien, die ihre Funktionsweise erklären. In Kapitel 3 wird die Sprache des Sports definiert und unterschieden in Fachsprache und Jargon. Kapitel 4 beleuchtet den Sport als mediales Massenphänomen und die Rolle der Medien in der Verbreitung von Sportereignissen. Kapitel 5 untersucht die Verwendung von Metaphern in der Sprache der Sportberichterstattung. Kapitel 6 analysiert die Funktion und Klassifikation von Metaphern in der Sportberichterstattung. Kapitel 7 vergleicht die Verwendung von Metaphern in der gesprochenen und geschriebenen Sportberichterstattung.
Schlüsselwörter
Metaphern, Sportberichterstattung, Sprache, Fachsprache, Jargon, Medien, Fernsehen, Zeitung, Analyse, Funktion, Klassifikation, Vergleich, gesprochene Sprache, geschriebene Sprache.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Sprache im Kontext Sport. Metaphern in der gesprochenen und geschriebenen Sportberichterstattung der Leichtathletik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1132651