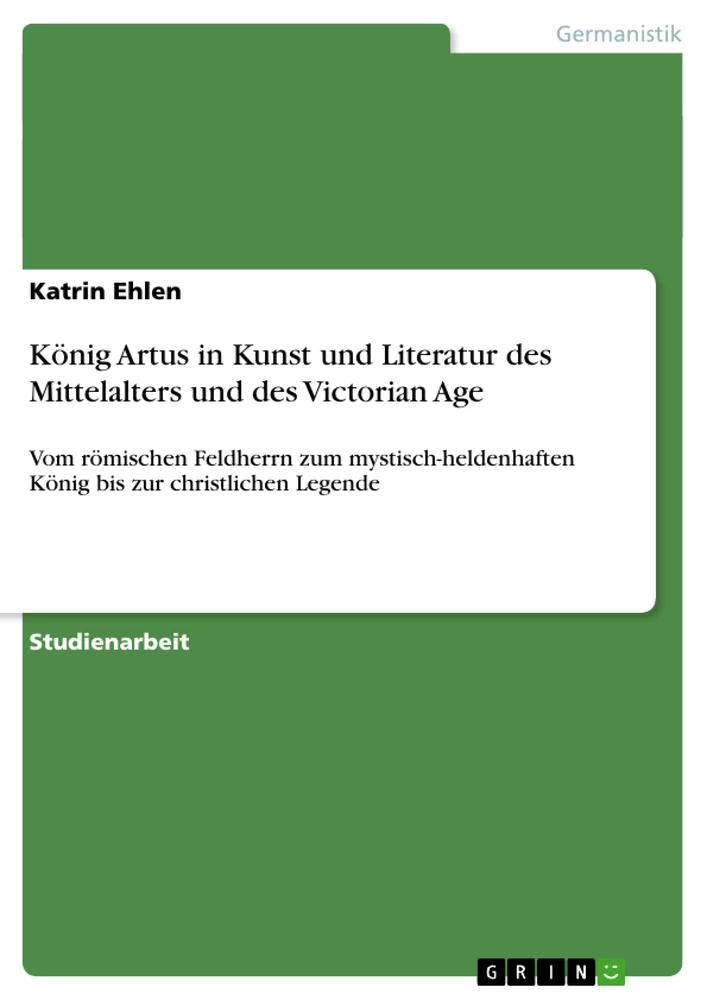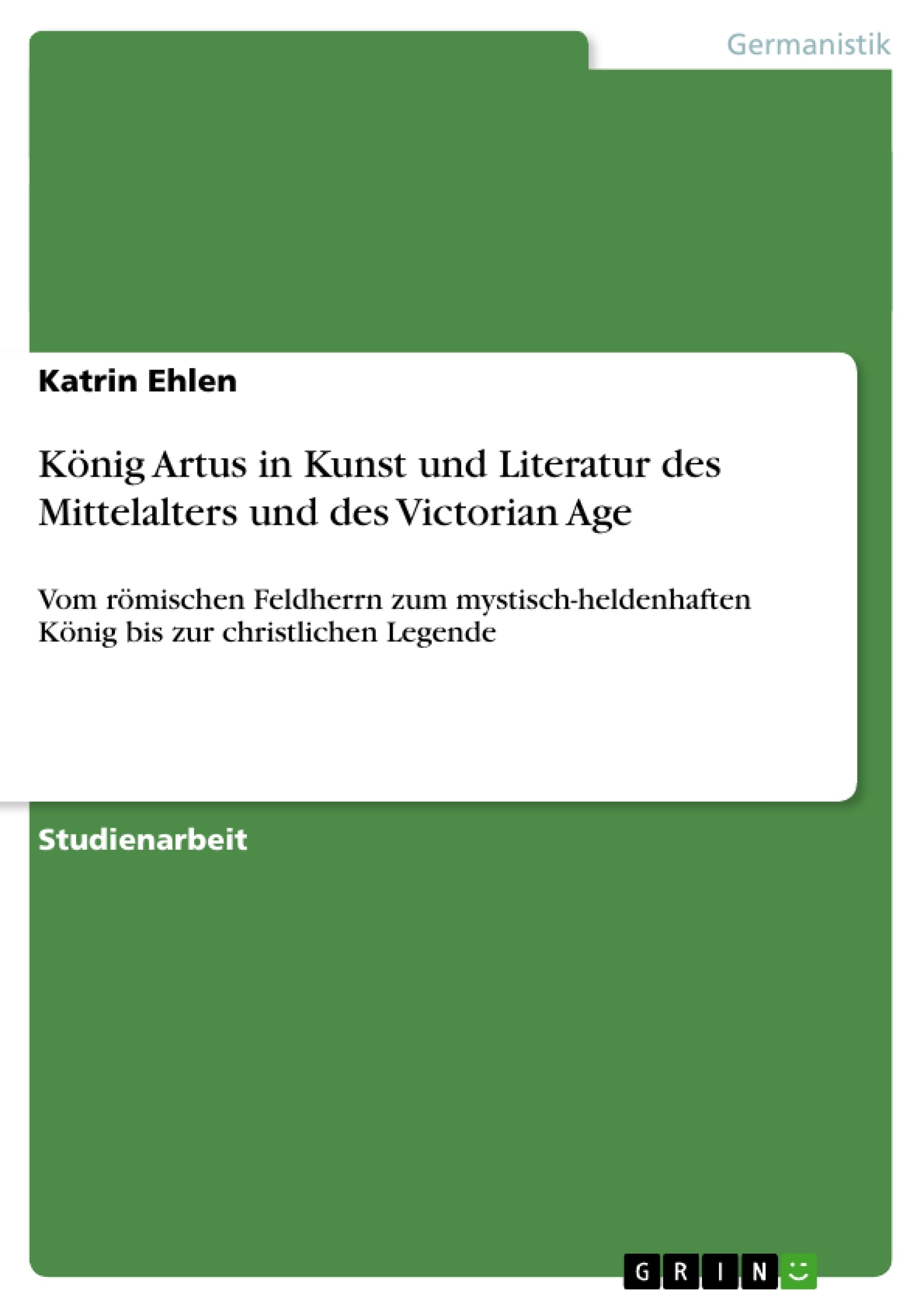Denken wir heute an König Artus, so haben wir zahlreiche Filme und Bilder vor Augen, in denen Artus den prototypischen christlichen Herrscher voller Gerechtigkeit, Gnade und Großzügigkeit verkörpert. Das Schwert im Stein und die Tafelrunde, Monumente seines christlichen Handelns, sind weit geläufige Motive, die auch immer wieder in Artusunabhängigen Kontexten auftauchen. Die mittelalterliche Literatur bietet unzählige Möglichkeiten in die Heldentaten der Artusritter einzublicken, die in ihrem (zumindest größtenteils) tugendhaften und unerschrockenen Handeln eine wichtige Vorbildfunktion erfüllen.
Die Figur des Artus entstammt allerdings eigentlich der keltisch-walisischen Mythologie.
Zum ersten Mal findet sie Erwähnung in den Erzählungen des „Mabinogion“, einer
Sammlung von walisischen Prosa-Erzählungen aus dem Mittelalter. König Artus ist also ursprünglich in einer heidnischen Kultur anzusiedeln.
In den letzen Jahren wurden jedoch wiederum Stimmen laut, die behaupteten, dass der sagenhafte König Artus auf die historische Figur des römischen Feldherrn Lucius Artorius Castus zurückgehe, seine Wurzeln also im Soldatentum lagen.
Anhand von Beispielen aus der Literatur und Kunst des Mittelalters und des „Victorian Age“, in dem es zum „Arthurian Revival“ kam, möchte ich zeigen, auf welche Weise diese drei verschiedenen Ursprungskontexte Einfluss auf die Rezeption der Sagengestalt genommen haben und wie sie sich gegenseitig bedingen, um die Artusgestalt in all ihren Facetten darstellen zu können. Für Britische Legenden ist es nicht ungewöhnlich, dass sie zwar auf den Taten einer
historischen Persönlichkeit beruhen, im Laufe der Zeit aber auch andere folkloristische Personen in den Sagenkreis eingewoben werden und dadurch eine neue Form der Legende kreiert wird.
Die Legende von König Artus geht vermutlich auf mehrere historische Personen zurück. Allerdings dürfte die Hauptvorlage für die Entstehung des Artusmythos der römische Feldherr Lucius Artorius Castus gewesen sein. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er den Kampf gegen das Volk der Sarmaten für Rom entschied. Die Römer kämpften im ersten und zweiten Jahrhundert gegen die Sarmaten, und konnten dabei zwar einige Erfolge verzeichnen, allerdings gelang es ihnen nie, das Barbarenvolk ganz zu besiegen. Der Grund dafür war, dass die Sarmaten eine ausgezeichnete Kriegskunst zu Pferde entwickelt hatten und dadurch für die
römischen Infanteristen nahezu unerreichbar waren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Mythologisierung der historischen Artusfigur
- III. Artusliteratur im Mittelalter
- III. 1) Das Mabinogion
- III. 2) Robert de Boron: Merlin (Ende des 12. Jahrhunderts)
- III. 3) Malory: Morte D`Arthur (1485)
- IV. Artusdarstellungen im Mittelalter
- IV. 1) Der Vulgate Zyklus
- IV. 2) Die "Nine Worthies"
- IV. 3) Die Kathedralen von Modena und Otranto
- V. Artusdarstellungen im Victorian Age
- V. 1) Die Präraffaeliten
- V. 2) Beardsley
- V. 2) Die Dyce-Fresken
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Artusfigur von ihren möglichen historischen Wurzeln bis hin zu ihrer Darstellung in der mittelalterlichen Literatur und Kunst sowie im Victorian Age. Ziel ist es, den Einfluss verschiedener Ursprungskontexte – keltisch-walisische Mythologie, die historische Figur Lucius Artorius Castus und die christliche Legende – auf die Rezeption der Artusgestalt aufzuzeigen und deren wechselseitige Bedingtheit zu beleuchten.
- Die Mythologisierung der historischen Artusfigur und die Verschmelzung verschiedener Legenden.
- Die Darstellung des Artus in verschiedenen mittelalterlichen literarischen Werken.
- Die ikonografischen und skriptografischen Aspekte der Artusdarstellungen im Mittelalter.
- Der Einfluss des „Arthurian Revival“ im Victorian Age auf die Artusrezeption.
- Die verschiedenen Facetten der Artusgestalt und ihre kulturelle Bedeutung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die vielschichtigen Rezeptionen der Artusfigur, von der modernen Vorstellung des christlichen Herrschers bis zu den ursprünglichen keltischen Wurzeln. Sie stellt die These auf, dass drei Hauptkontexte – die keltisch-walisische Mythologie, die mögliche historische Figur Lucius Artorius Castus und die christliche Legende – die Artusgestalt geprägt haben und ineinander greifen. Die Arbeit verspricht, diese Kontexte anhand von literarischen und künstlerischen Beispielen aus dem Mittelalter und dem Victorian Age zu untersuchen.
II. Mythologisierung der historischen Artusfigur: Dieses Kapitel untersucht die These, dass die Artuslegende auf verschiedenen historischen Figuren und folkloristischen Elementen basiert, insbesondere auf dem römischen Feldherrn Lucius Artorius Castus. Es beleuchtet Castus' militärische Erfolge gegen die Sarmaten und dessen mögliche Rolle als Inspirationsquelle für das Artusbild, insbesondere bezüglich des Drachenwappens und der Schwertverehrung bei den Alanen. Das Kapitel diskutiert die Verschmelzung der Legende um Castus mit keltischen Sagen und dem aufkommenden Christentum in Britannien, um die komplexe Entwicklung der Artusfigur zu erklären, wobei die Schwierigkeit einer eindeutigen Rückführung auf eine einzige historische Persönlichkeit hervorgehoben wird.
III. Artusliteratur im Mittelalter: Dieses Kapitel analysiert die literarische Darstellung des Artus im Mittelalter. Es beginnt mit dem "Mabinogion", einer Sammlung walisischer Mythen, in denen Artus als Randfigur auftritt. Es werden weitere wichtige mittelalterliche Texte erwähnt, wie Robert de Borons "Merlin" und Malorys "Morte D'Arthur", um zu zeigen, wie die Artuslegende in der mittelalterlichen Literatur verarbeitet und weiterentwickelt wurde. Es wird der Fokus auf die Entwicklung des Artusbildes und die verschiedenen Interpretationen seiner Rolle und Bedeutung in diesen Werken liegen.
Schlüsselwörter
König Artus, Artuslegende, Lucius Artorius Castus, Mabinogion, Mittelalter, Victorian Age, Arthurian Revival, keltische Mythologie, christliche Legende, Literatur, Kunst, Ikonografie, Skriptografie, historische Figur, Mythologisierung.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Entwicklung der Artusfigur"
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Entwicklung der Artusfigur von ihren möglichen historischen Wurzeln bis hin zu ihrer Darstellung in mittelalterlicher Literatur und Kunst sowie im Viktorianischen Zeitalter. Er beleuchtet den Einfluss keltisch-walisischer Mythologie, der historischen Figur Lucius Artorius Castus und der christlichen Legende auf die Rezeption der Artusgestalt.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Mythologisierung der historischen Artusfigur, die Darstellung des Artus in verschiedenen mittelalterlichen literarischen Werken (Mabinogion, Robert de Boron, Malory), ikonografische und skriptografische Aspekte der Artusdarstellungen im Mittelalter, den Einfluss des „Arthurian Revival“ im Viktorianischen Zeitalter, und die kulturelle Bedeutung der Artusgestalt.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einleitung, II. Mythologisierung der historischen Artusfigur, III. Artusliteratur im Mittelalter (mit Unterkapiteln zum Mabinogion, Robert de Boron und Malory), IV. Artusdarstellungen im Mittelalter (mit Unterkapiteln zum Vulgate-Zyklus, den "Nine Worthies" und den Kathedralen von Modena und Otranto), V. Artusdarstellungen im Victorian Age (mit Unterkapiteln zu den Präraffaeliten, Beardsley und den Dyce-Fresken), und VI. Fazit.
Wie wird die Beziehung zwischen historischen Figuren und der Artuslegende dargestellt?
Der Text untersucht die These, dass die Artuslegende auf verschiedenen historischen Figuren und folkloristischen Elementen basiert, insbesondere auf dem römischen Feldherrn Lucius Artorius Castus. Er analysiert, wie die Legende um Castus mit keltischen Sagen und dem aufkommenden Christentum verschmolz, um die komplexe Entwicklung der Artusfigur zu erklären.
Welche mittelalterlichen literarischen Werke werden analysiert?
Der Text analysiert das Mabinogion, Robert de Borons "Merlin" und Malorys "Morte D'Arthur", um die Verarbeitung und Weiterentwicklung der Artuslegende in der mittelalterlichen Literatur aufzuzeigen.
Wie wird die Artusrezeption im Viktorianischen Zeitalter behandelt?
Der Text untersucht den Einfluss des „Arthurian Revival“ im Viktorianischen Zeitalter auf die Artusrezeption, indem er die Artusdarstellungen der Präraffaeliten, Beardsleys und die Dyce-Fresken analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind für den Text relevant?
Schlüsselwörter sind: König Artus, Artuslegende, Lucius Artorius Castus, Mabinogion, Mittelalter, Viktorianisches Zeitalter, Arthurian Revival, keltische Mythologie, christliche Legende, Literatur, Kunst, Ikonografie, Skriptografie, historische Figur, Mythologisierung.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, den Einfluss verschiedener Ursprungskontexte (keltisch-walisische Mythologie, Lucius Artorius Castus, christliche Legende) auf die Rezeption der Artusgestalt aufzuzeigen und deren wechselseitige Bedingtheit zu beleuchten.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Der Text bietet für jedes Kapitel eine kurze Zusammenfassung, die die wichtigsten Punkte und die Argumentationslinie des jeweiligen Kapitels hervorhebt.
- Quote paper
- Katrin Ehlen (Author), 2008, König Artus in Kunst und Literatur des Mittelalters und des Victorian Age, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/113055