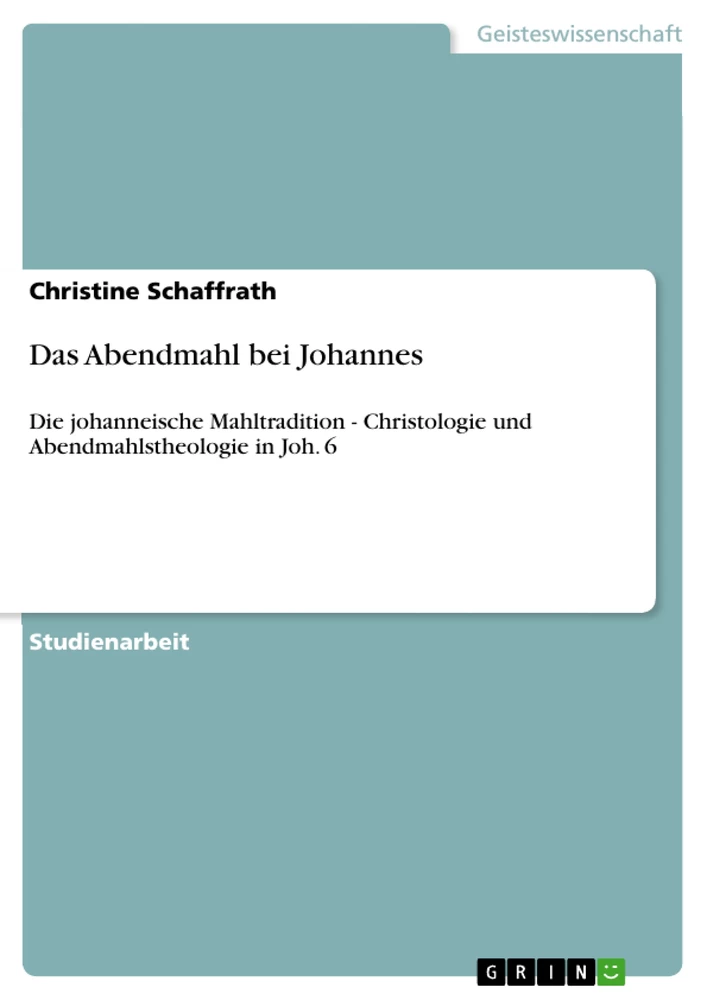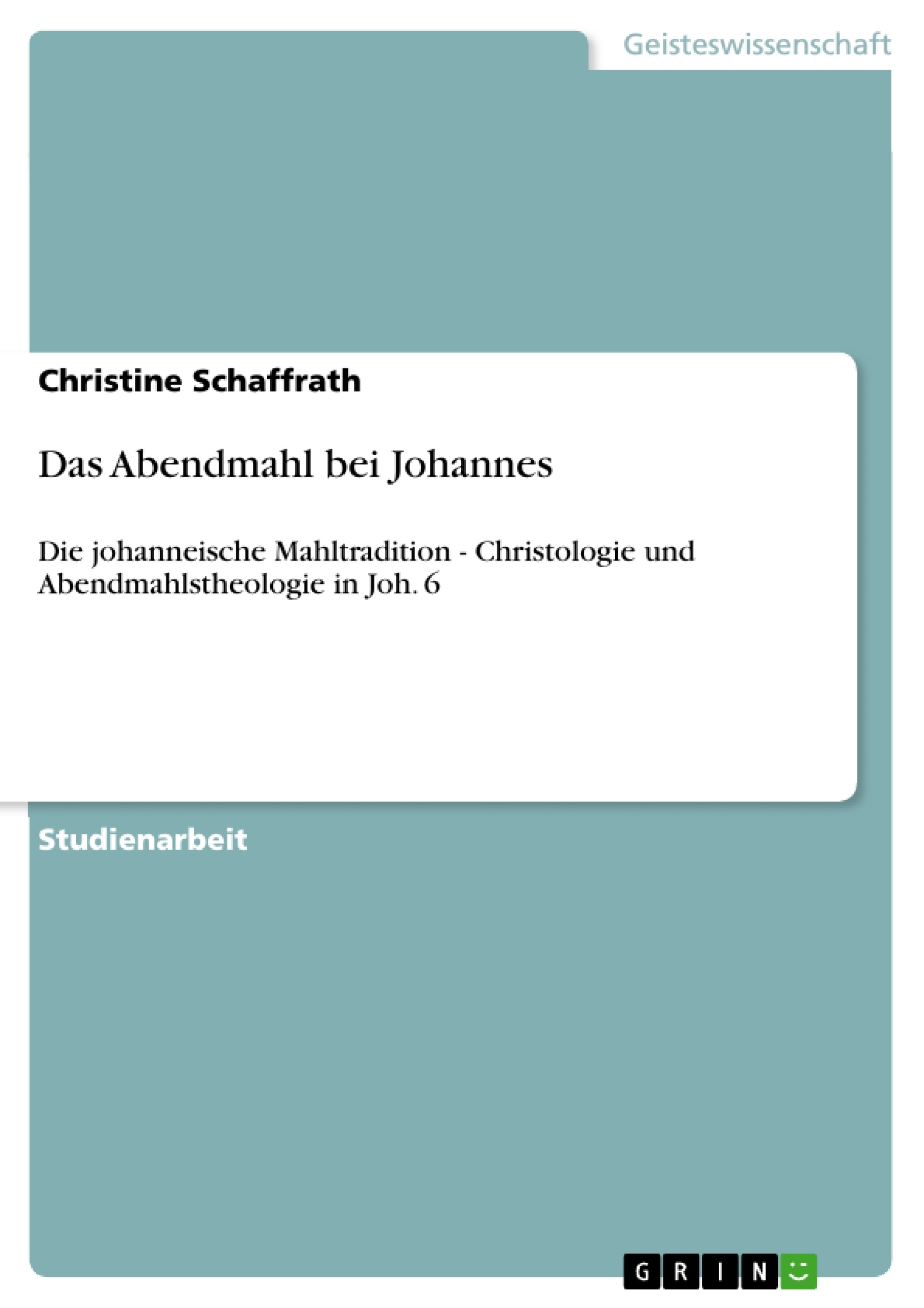Im Rahmen des Hauptseminars Die neutestamentliche Abendmahlsüberlieferung werde ich in dieser Seminararbeit das Thema Die johanneische Mahltradition. Christologie und Abendmahlstheologie in Joh 6 bearbeiten. Ziel ist es dabei Joh 6 zu analysieren und eine Verbindung mit der Fußwaschung aus Joh 13,1-20 herzustellen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf Punkt 2. 3. 2. Die Rede Jesu über sein Fleisch und Blut (Joh 6,51b-59), da in diesem Abschnitt des Evangeliums der Verfasser das Thema der Eucharistie behandelt. Ich werde bei meiner Analyse Vers für Vers schrittweise vorgehen um den Text so genau wie möglich zu untersuchen. Während des Lesens meiner Hausarbeit ist es unbedingt notwendig eine griechische Ausgabe des Neuen Testaments zu benutzen um sich zu orientieren und die einzelnen Arbeitsschritte besser nachvollziehen zu können. Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung zu Joh 6. Dann folgt die Textanalyse, die sich themenspezifisch in drei große Abschnitte untergliedert (siehe Punkt 2. 1.). Zum Schluss gehe ich auf die Fußwaschung (Joh 13,1-20) ein um ihren Zusammenhang mit Joh 6 zu verdeutlichen. Dieses Kapitel 2. 5. ist bewusst kurz gehalten um den Rahmen der Hausarbeit nicht zu sprengen. Im Johannesevangelium finden wir keinen klassischen Einsetzungsbericht wie bei den Syoptikern (Mk 14,22-24; Mt 26,26-29; Lk 22,17-20) oder wie bei Paulus (1 Kor 11,23-25). Stattdessen schildert Johannes die Fußwaschung (Joh 13,1-20), worauf ich in Punkt 2. 5. noch näher eingehen werde. Worte über die Eucharistie finden wir bei Joh in Kapitel 6, speziell in Joh 6,51b-58. Da die einzelnen Teile des 6. Kapitels aufeinander aufbauen und mit der Eucharistie zusammenhängen, werde ich in dem folgenden Teil meiner Hausarbeit abschnittweise das gesamte 6. Kapitel des JohEv untersuchen.
Joh 6 hat drei Abschnitte:
1. Das Speisungswunder (V.1-15) und der Gang Jesu über den See (V.16-25)
2. Die Rede Jesu über das Lebensbrot und die eucharistischen Worte (V.26-59)
3. Der Abfall vieler Jünger und das Bekenntnis des Petrus (V.60-71)
Dabei bilden der erste und der dritte Abschnitt einen Rahmen um den Hauptteil. Das komplette Kapitel ist gekennzeichnet durch die Interaktion zwischen Jesus und den Menschen (Volk/ Juden/ Jünger). Außerdem zieht sich das Thema Brot wie ein roter Faden durch die Erzählung. Laut Klaus Scholtissek ist Joh 6 „ein Evangelium im Evangelium, da es alle wesentlichen Aussagen joh Theologie enthält“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Johannes 6
- Speisungswunder und Seewandel
- Das Speisungswunder (Joh 6,1-15)
- Der Gang Jesu über den See (Joh 6,16-25)
- Die Lebensbrotrede
- Die Rede Jesu über das Lebensbrot (Joh 6,26-51a)
- Die Rede Jesu über sein Fleisch und Blut (Joh 6,51b-59)
- Jüngerabfall und Petrusbekenntnis
- Der Jüngerabfall (Joh 6,60-65)
- Das Petrusbekenntnis (Joh 6,66-71)
- Die Fußwaschung (Joh 13,1-20)
- Speisungswunder und Seewandel
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Johannes 6 und stellt eine Verbindung zur Fußwaschung aus Johannes 13,1-20 her. Der Fokus liegt auf der Rede Jesu über sein Fleisch und Blut (Johannes 6,51b-59), da dieser Abschnitt die Eucharistie behandelt. Die Arbeit untersucht den Text Vers für Vers und beleuchtet die Verbindung zwischen dem Speisungswunder, der Lebensbrotrede und der Fußwaschung.
- Die johanneische Mahltradition
- Christologie und Abendmahlstheologie in Johannes 6
- Die Bedeutung des Brotes als Symbol
- Die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern
- Die Rolle der Eucharistie in der johanneischen Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert die Zielsetzung. Sie hebt die Bedeutung von Johannes 6 für die johanneische Abendmahlstheologie hervor und betont die Notwendigkeit, den Text Vers für Vers zu analysieren.
Kapitel 2.1. Johannes 6 führt in das sechste Kapitel des Johannesevangeliums ein und stellt die drei Abschnitte des Kapitels vor: das Speisungswunder, die Lebensbrotrede und den Jüngerabfall. Es wird auf die Besonderheiten des johanneischen Abendmahlsberichts im Vergleich zu den synoptischen Evangelien und dem Ersten Korintherbrief eingegangen.
Kapitel 2.2. Speisungswunder und Seewandel analysiert die Verse 1-15, die das Speisungswunder der fünftausend Menschen am See Genezareth schildern. Es wird auf die Orts- und Zeitangaben, die beteiligten Personen und die Bedeutung des Berges als Ort der Offenbarung eingegangen. Die Verse 16-25, die den Gang Jesu über den See beschreiben, werden ebenfalls untersucht. Es wird die Funktion der Wundererzählungen als Legitimation Jesu und die Bedeutung des Brotes als Symbol für die göttliche Versorgung hervorgehoben.
Kapitel 2.3. Die Lebensbrotrede analysiert die Verse 26-59, die die Rede Jesu über das Lebensbrot und die eucharistischen Worte beinhalten. Es wird auf die Bedeutung des Brotes als Symbol für das ewige Leben und die Verbindung zwischen dem Speisungswunder und der Eucharistie eingegangen. Die Rede Jesu über sein Fleisch und Blut wird im Detail untersucht, um die christologische Bedeutung der Eucharistie zu beleuchten.
Kapitel 2.4. Jüngerabfall und Petrusbekenntnis analysiert die Verse 60-71, die den Abfall vieler Jünger und das Bekenntnis des Petrus schildern. Es wird auf die Reaktion der Jünger auf die Rede Jesu über sein Fleisch und Blut und die Bedeutung des Petrusbekenntnisses für die johanneische Christologie eingegangen.
Kapitel 2.5. Die Fußwaschung (Joh 13,1-20) untersucht den Zusammenhang zwischen der Fußwaschung und Johannes 6. Es wird auf die Bedeutung der Fußwaschung als Symbol für die Demut und die Liebe Jesu und die Verbindung zwischen der Eucharistie und der Fußwaschung eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die johanneische Mahltradition, die Christologie und Abendmahlstheologie in Johannes 6, das Speisungswunder, die Lebensbrotrede, die Eucharistie, das Brot als Symbol, die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern, der Jüngerabfall, das Petrusbekenntnis und die Fußwaschung.
- Quote paper
- Christine Schaffrath (Author), 2004, Das Abendmahl bei Johannes, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/112932