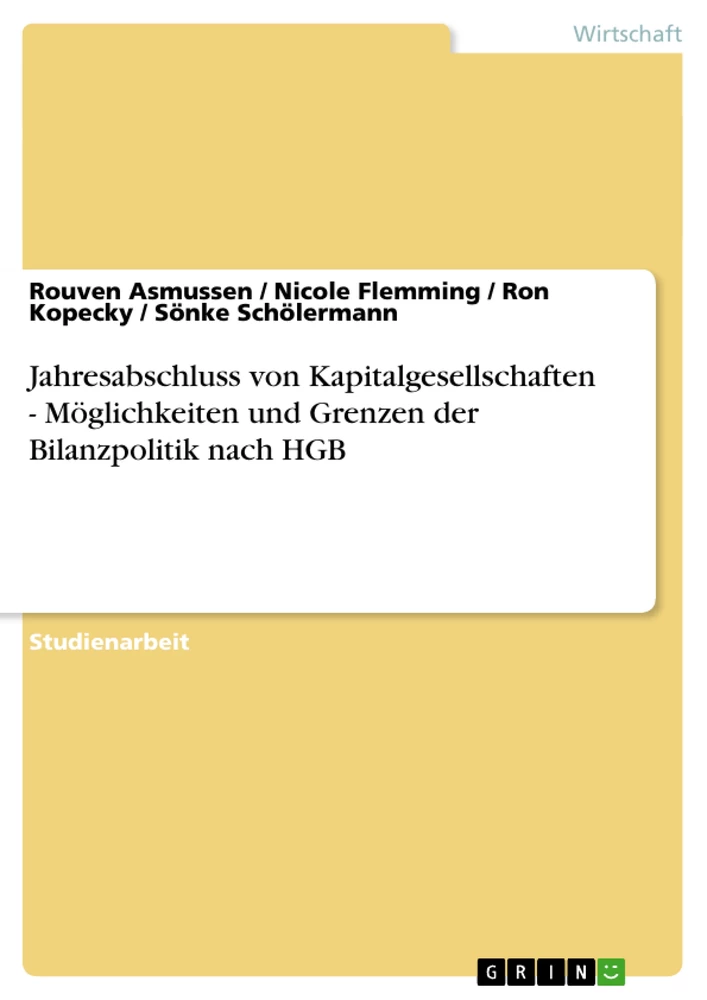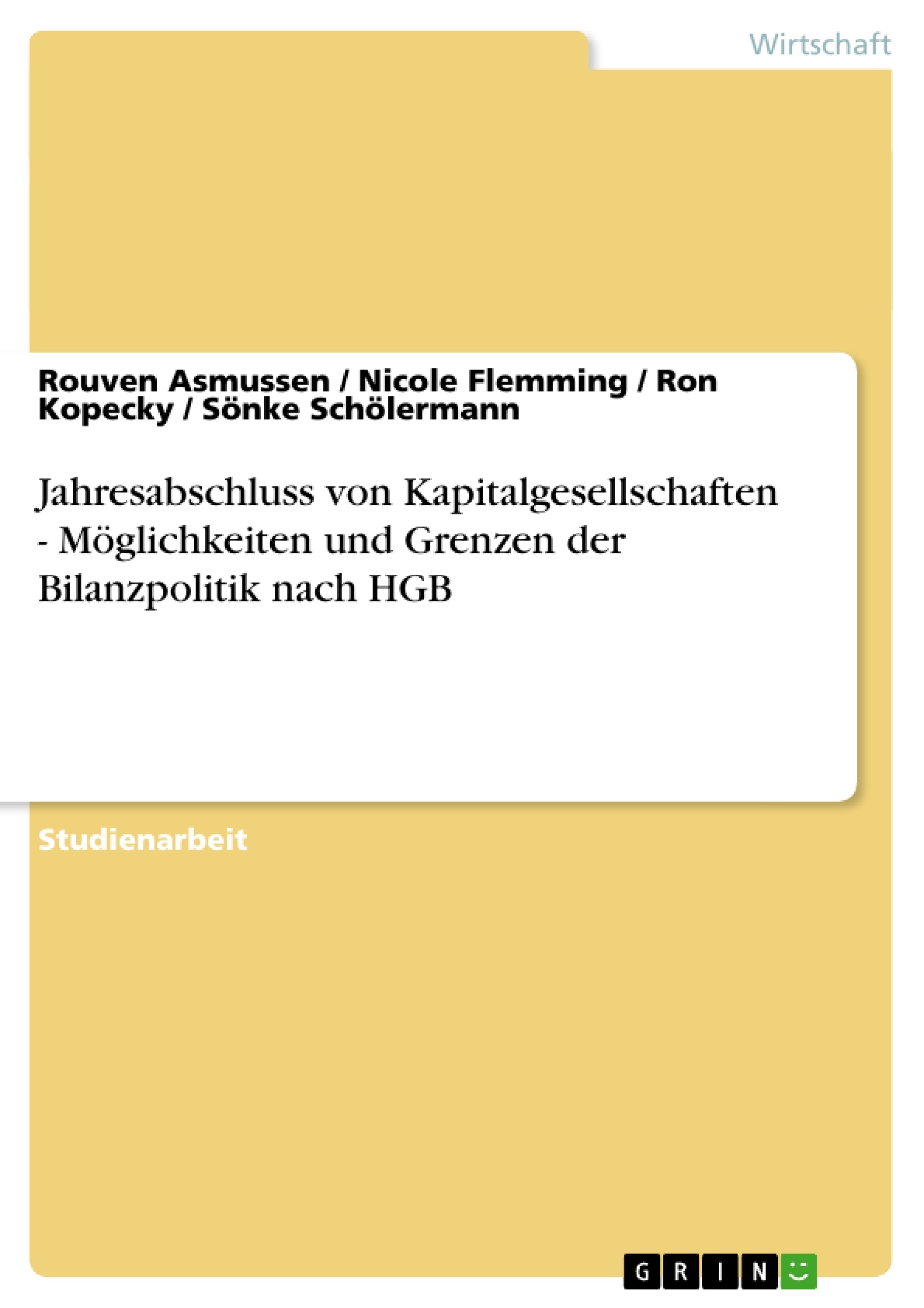[...] Ebenso lässt der
italienische Begriff „bilancia“ (Waage, Gleichgewicht) auf die heutige Bedeutung
als Abschluss des Rechnungswesens einer Unternehmung für einen
bestimmten Zeitpunkt in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen und
Kapital schließen.2
Die Verbindung zwischen Bilanz und Jahresabschluss wird dadurch hergestellt,
dass die Bilanz das Ergebnis der Tätigkeit des Jahresabschlusses ist.
Wie das Aufstellen einer „Jahresschlussbilanz“ zu erfolgen hat, wird in
Deutschland im Wesentlichen durch das Handelsgesetzbuch geregelt. So
besagt § 238 Satz 1 HGB, dass jeder Kaufmann verpflichtet ist, Bücher zu
führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu
machen. Darüber hinaus sind Kapitalgesellschaften dazu verpflichtet, den
Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, sowie einen Lagebericht3
aufzustellen.4
Die gesetzlichen Regelungen dienen primär der Dokumentation von Geschäftsvorfällen
und der Information von sämtlichen Personenkreisen, die ein
Interesse an der wirtschaftlichen Lage eines jeweiligen Unternehmens haben.
So sind Unternehmen regelmäßig darin bestrebt, ein Jahresergebnis
auszuweisen, dass nicht unbedingt die wirtschaftliche Verfassung korrekt widerspiegelt.
Ein legales Mittel um einen bestehenden „Gestaltungsspielraum“
bei der Bilanzierung den eigenen Zielsetzungen entsprechend ausnutzen zu
können, liegt in der Ausschöpfung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten.
Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser die wichtigsten Wahlrechte vorzustellen,
aber dabei ebenfalls die Grenzen der Anwendbarkeit aufzuzeigen. So sollen
zunächst die Aufgaben und Ziele der Bilanzpolitik dargestellt werden. Anschließend folgt eine kurze Erläuterung des Maßgeblichkeitsprinzips, um das
Verhältnis zwischen Handels- und Steuerbilanz zu verdeutlichen. Die Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte erfolgt im Anschluss,
wobei bei den Aktivierungswahlrechten entgegen der eigentlichen Aufgabenstellung
zusätzlich kurz auf die steuerliche Behandlung eingegangen werden
soll, damit das Verständnis des Postens der aktiven latenten Steuern erleichtert
wird. Den Abschluss bildet eine kritische Würdigung des gesamten
Sachverhalts.
2 Vgl. Gabler-Wirtschafts-Lexikon (1997), S. 614.
3 Kleine Kapitalgesellschaften sind hingegen von der Aufstellung eines Lageberichtes befreit.
4 Vgl. § 264 Abs. 1 HGB.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bilanzpolitik
- 2.1. Aufgaben und Ziele
- 2.2. Grundsatz der Mäβigkeit
- 2.3. Bilanzierungswahlrechte
- 2.3.1. Aktivierungswahlrechte
- 2.3.2. Passivierungswahlrechte
- 2.4. Bewertungswahlrechte
- 3. Kritische Würdigung
- 4. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzpolitik nach Handelsgesetzbuch (HGB) für Kapitalgesellschaften. Sie beleuchtet die Gestaltungsspielräume des Jahresabschlusses und analysiert die Auswirkungen der Steuerreform auf die Bilanzpolitik.
- Möglichkeiten der Bilanzgestaltung nach HGB
- Grenzen der Bilanzpolitik durch gesetzliche Vorschriften
- Auswirkungen der Steuerreform auf die Bilanzpolitik
- Wahlrechte bei der Aktivierung und Passivierung von Posten
- Bewertungsspielräume im Rahmen des HGB
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bilanzpolitik von Kapitalgesellschaften ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beschreibt die Relevanz des Jahresabschlusses für verschiedene Adressaten und betont die Bedeutung der Gestaltungsspielräume innerhalb des rechtlichen Rahmens des HGB. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Steuerreform.
2. Bilanzpolitik: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Thema Bilanzpolitik. Es definiert zunächst die Aufgaben und Ziele der Bilanzpolitik und erläutert den Grundsatz der Mäßigkeit. Der Hauptteil des Kapitels konzentriert sich auf die detaillierte Darstellung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten. Hierbei werden sowohl Aktivierungs- als auch Passivierungswahlrechte im Detail analysiert, einschließlich der Diskussion relevanter steuerrechtlicher Aspekte und deren Auswirkungen auf die Gestaltung des Jahresabschlusses. Die verschiedenen Wahlrechte werden anhand konkreter Beispiele illustriert und ihre Bedeutung für die Ergebnis- und Finanzlage der Kapitalgesellschaften herausgestellt. Der Abschnitt zu den Bewertungswahlrechten umfasst die Diskussion von Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Abschreibungsmethoden und der Sammelbewertung des Umlaufvermögens, wobei die jeweiligen rechtlichen Grundlagen und deren praktische Anwendung erläutert werden. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Wahlrechten und deren Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft werden ausführlich dargestellt.
3. Kritische Würdigung: (Anmerkung: Da der Text keine Zusammenfassung dieses Kapitels enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden. Eine solche Zusammenfassung würde die Analyse der vorangehenden Kapitel beinhalten und potentiell den Schluss des Werkes vorwegnehmen.)
Schlüsselwörter
Bilanzpolitik, Jahresabschluss, Kapitalgesellschaften, Handelsgesetzbuch (HGB), Bilanzierungswahlrechte, Bewertungswahlrechte, Steuerreform, Aktivierung, Passivierung, Abschreibung, Sammelbewertung, Ergebnislage, Finanzlage.
Häufig gestellte Fragen zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit, die sich mit der Bilanzpolitik von Kapitalgesellschaften nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) auseinandersetzt. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf den Gestaltungsspielräumen des Jahresabschlusses und den Auswirkungen der Steuerreform auf die Bilanzpolitik.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Bilanzpolitik, 3. Kritische Würdigung und 4. Literatur. Kapitel 2 ("Bilanzpolitik") ist besonders detailliert und behandelt Aufgaben und Ziele der Bilanzpolitik, den Grundsatz der Mäßigkeit, Bilanzierungswahlrechte (Aktivierung und Passivierung) und Bewertungswahlrechte.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzpolitik nach HGB für Kapitalgesellschaften. Im Mittelpunkt stehen die Gestaltungsspielräume im Jahresabschluss, die Auswirkungen der Steuerreform, Wahlrechte bei der Aktivierung und Passivierung von Posten sowie Bewertungsspielräume im Rahmen des HGB.
Was wird im Kapitel "Bilanzpolitik" behandelt?
Kapitel 2 ("Bilanzpolitik") definiert zunächst die Aufgaben und Ziele der Bilanzpolitik und erläutert den Grundsatz der Mäßigkeit. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Darstellung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten, einschließlich der steuerrechtlichen Aspekte und deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss. Konkrete Beispiele illustrieren die verschiedenen Wahlrechte und deren Bedeutung für die Ergebnis- und Finanzlage der Gesellschaft. Die Diskussion umfasst Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Abschreibungsmethoden und die Sammelbewertung des Umlaufvermögens.
Was ist über die "Kritische Würdigung" bekannt?
Der Text enthält keine Zusammenfassung des Kapitels "Kritische Würdigung". Eine solche Zusammenfassung würde die Analyse der vorangehenden Kapitel beinhalten und den Schluss des Werkes vorwegnehmen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bilanzpolitik, Jahresabschluss, Kapitalgesellschaften, Handelsgesetzbuch (HGB), Bilanzierungswahlrechte, Bewertungswahlrechte, Steuerreform, Aktivierung, Passivierung, Abschreibung, Sammelbewertung, Ergebnislage, Finanzlage.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und alle, die sich mit Bilanzpolitik, Jahresabschlüssen und dem Handelsgesetzbuch (HGB) auseinandersetzen. Er bietet einen guten Überblick über die zentralen Themen und die Struktur der zugrundeliegenden Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Rouven Asmussen (Autor:in), Nicole Flemming (Autor:in), Ron Kopecky (Autor:in), Sönke Schölermann (Autor:in), 2003, Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften - Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzpolitik nach HGB, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11279