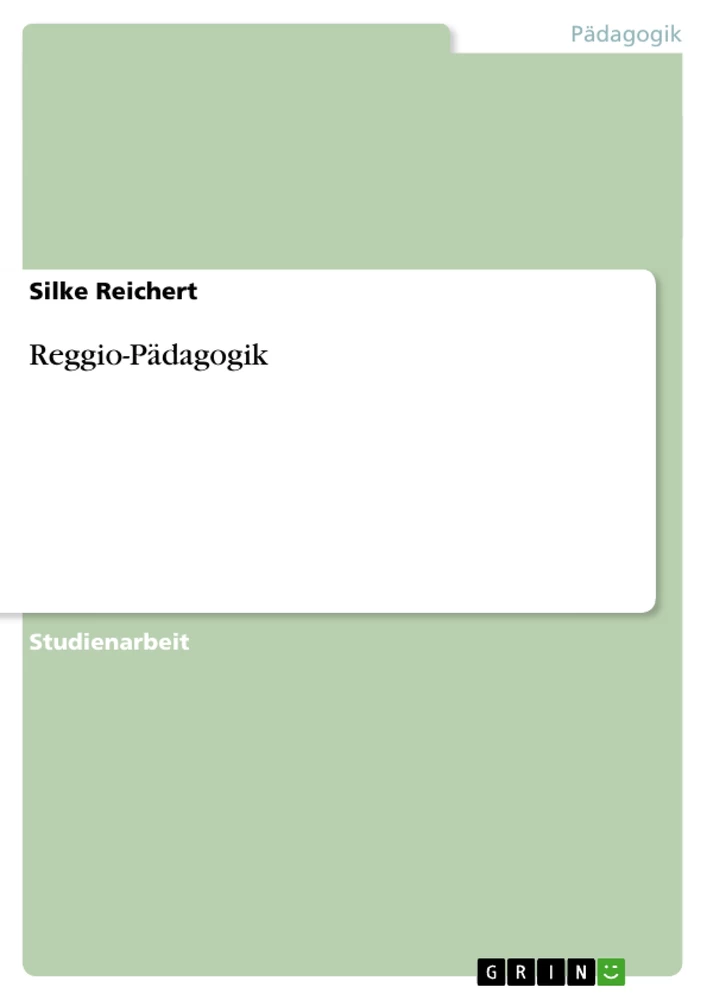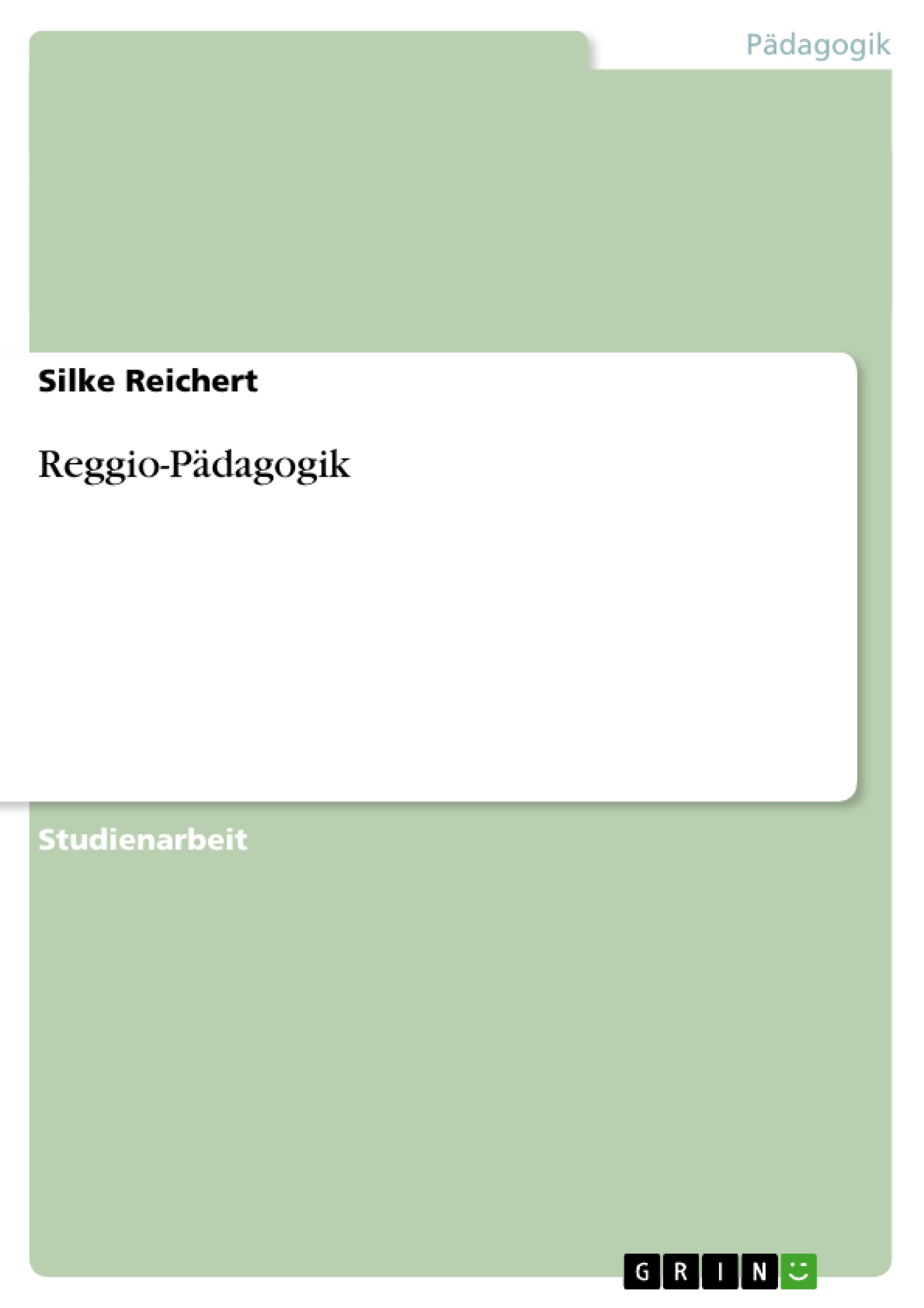[...] Dies war aber keineswegs eine Welt, die ich
kannte, sondern eine völlig fremde. Dieser Kindergarten hatte nichts mehr mit dem, den ich
noch kannte, und den damaligen Erinnerungen gemeinsam, ausser einer Erzieherin. Nach
einem längeren Gespräch und täglich folgenden Gesprächen und Diskussionen mit den
Erzieherinnen, während meines Praktikums, musste ich feststellen, dass sich in den letzten
Jahren sehr viel in den Kindergärten und somit auch in der Elementarpädagogik verändert hat
und sich auch verändern musste. Aber nicht nur der gesamte Tagesablauf mit den Aktivitäten
und Fördermaßnahmen hat sich geändert, sondern auch das gesamte Umfeld des
Kindergartens, wie die Architektur, die räumliche Gestaltung, die Gestaltung des Gartens, und
somit auch die Interessen, Möglichkeiten und Aktivitäten der Kinder.
Ein Paradebeispiel für die Veränderung der Erziehung zu der, die ich als Kind im
Kindergarten erfuhr, ist eine jüngere Pädagogik-Bewegung, die Reggio-Pädagogik.
Unterschiede lassen sich schon an dem reggianischen Bild des Kindes feststellen und geht
von den Tätigkeiten der Kinder hin bis zu der räumlichen Gestaltung der Kindergärten.
Was man unter Reggio-Pädagogik versteht, möchte ich in dieser Arbeit vorstellen. Zuerst
werde ich den historischen Hintergrund der Reggio-Pädagogik erläutern, um den
gesellschaftlichen Bezug derselbigen zu verdeutlichen. Danach werde ich versuchen die
Reggio-Pädagogik zu definieren. Warum das nicht, im Gegensatz zu anderen Pädagogik-
Konzepten, so ohne weiteres möglich ist, wird dabei deutlich werden. Fortfahren werde ich
dann mit dem reggianischen Bild vom Kinde. Anschließend komme ich zu den Zielen der
Reggio-Pädagogik und dem Wesentlichen dieser Pädagogik, der Projektarbeit. Des weiteren
stelle ich die Rolle, die die Erzieher/innen in der Reggio-Pädagogik spielen, mit ihren
Aufgaben, wie zum Beispiel der Dokumentation von Geschehnissen, dar. Durch die
Bedeutsamkeit der Räume in der Reggio-Pädagogik, welchen die Rolle des dritten Erziehers
zugeschrieben wird, zeige ich im Anschluss die architektonische Gestaltung einer solchen
Kindertagesstätte oder Krippe auf. Beenden werde ich diese Arbeit mit einer
Zusammenfassung und im Folgenden meine Meinung hinsichtlich der Probleme der
Durchsetzung dieser Pädagogik in anderen Ländern aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung
- Definition
- Das Bild vom Kind
- Ziele der reggianischen Erziehung
- Projekte
- Projekt allgemein
- Projekte in der Reggio-Pädagogik
- Bedeutung
- Projekte: Der Weg ist das Ziel
- Die Dimension des Spiels
- Was Kinder in Projekten lernen
- Rolle des Erziehers
- Projektdokumentation / Ausstellungen
- Raumgestaltung
- Der Raum als „,dritter Erzieher“
- Zusammenfassung
- Übertragungsschwierigkeiten/ Transferprobleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Reggio-Pädagogik, einer modernen pädagogischen Bewegung, die in der italienischen Stadt Reggio-Emilia ihren Ursprung hat. Sie präsentiert eine umfassende Einführung in die Philosophie und Praxis dieser pädagogischen Herangehensweise und untersucht ihre historische Entwicklung, zentralen Konzepte sowie die Rolle der Erzieher und der Raumgestaltung in der Bildung junger Menschen. Die Arbeit beleuchtet zudem die Herausforderungen, die mit der Umsetzung der Reggio-Pädagogik in anderen Ländern verbunden sind.
- Historische Entwicklung der Reggio-Pädagogik und ihre Wurzeln in der Reformpädagogik
- Definition und zentrale Elemente der Reggio-Pädagogik
- Das reggianische Bild vom Kind und seine Bedeutung für die pädagogische Praxis
- Projektarbeit als zentrales Element der Reggio-Pädagogik und ihre Bedeutung für das Lernen
- Die Rolle des Erziehers und die Gestaltung der Lernumgebung in der Reggio-Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Reggio-Pädagogik und ihre Bedeutung im Kontext der aktuellen Entwicklungen in der Elementarpädagogik. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Reggio-Pädagogik und ihre Wurzeln in der Reformpädagogik sowie ihre Entstehung in Reggio-Emilia nach dem Zweiten Weltkrieg. Kapitel 3 befasst sich mit der Definition der Reggio-Pädagogik und hebt die Schwierigkeiten hervor, die sich aus ihrer komplexen und vielschichtigen Natur ergeben. Kapitel 4 widmet sich dem reggianischen Bild vom Kind, das als aktiver und kompetenter Lerner mit eigenen Interessen und Bedürfnissen betrachtet wird. Kapitel 5 behandelt die Ziele der Reggio-Pädagogik und ihre Betonung von Bildung als Prozess der Entdeckung und des selbstständigen Lernens.
Kapitel 6 präsentiert die Projektarbeit als zentrales Element der Reggio-Pädagogik und untersucht die verschiedenen Aspekte dieses Ansatzes. Kapitel 7 konzentriert sich auf die Rolle des Erziehers in der Reggio-Pädagogik und seine Aufgaben in der Begleitung und Dokumentation von Lernprozessen. Kapitel 8 befasst sich mit der Bedeutung der Raumgestaltung in der Reggio-Pädagogik und betrachtet die Räume als „dritten Erzieher“, der die Lernumgebung aktiv gestaltet.
Schlüsselwörter
Reggio-Pädagogik, Elementarpädagogik, Bildungsprozesse, Projektarbeit, Raumgestaltung, Kindzentrierte Pädagogik, Erzieherrolle, Reggio-Emilia, Loris Malaguzzi, demokratische Erziehung, soziale Bildung, Projektdokumentation, „dritter Erzieher“.
- Arbeit zitieren
- Silke Reichert (Autor:in), 2002, Reggio-Pädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11209