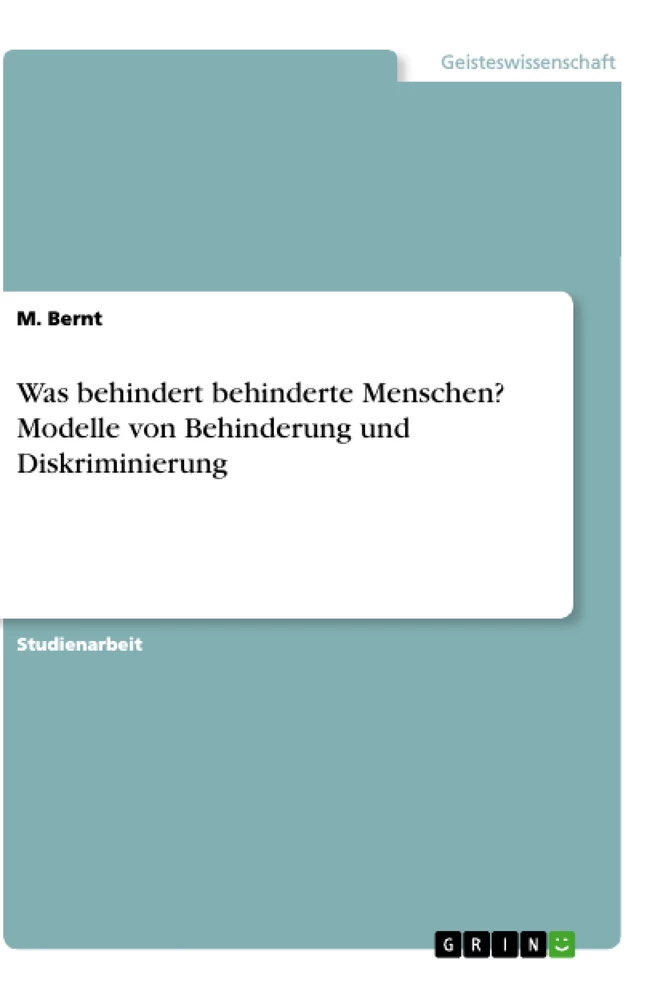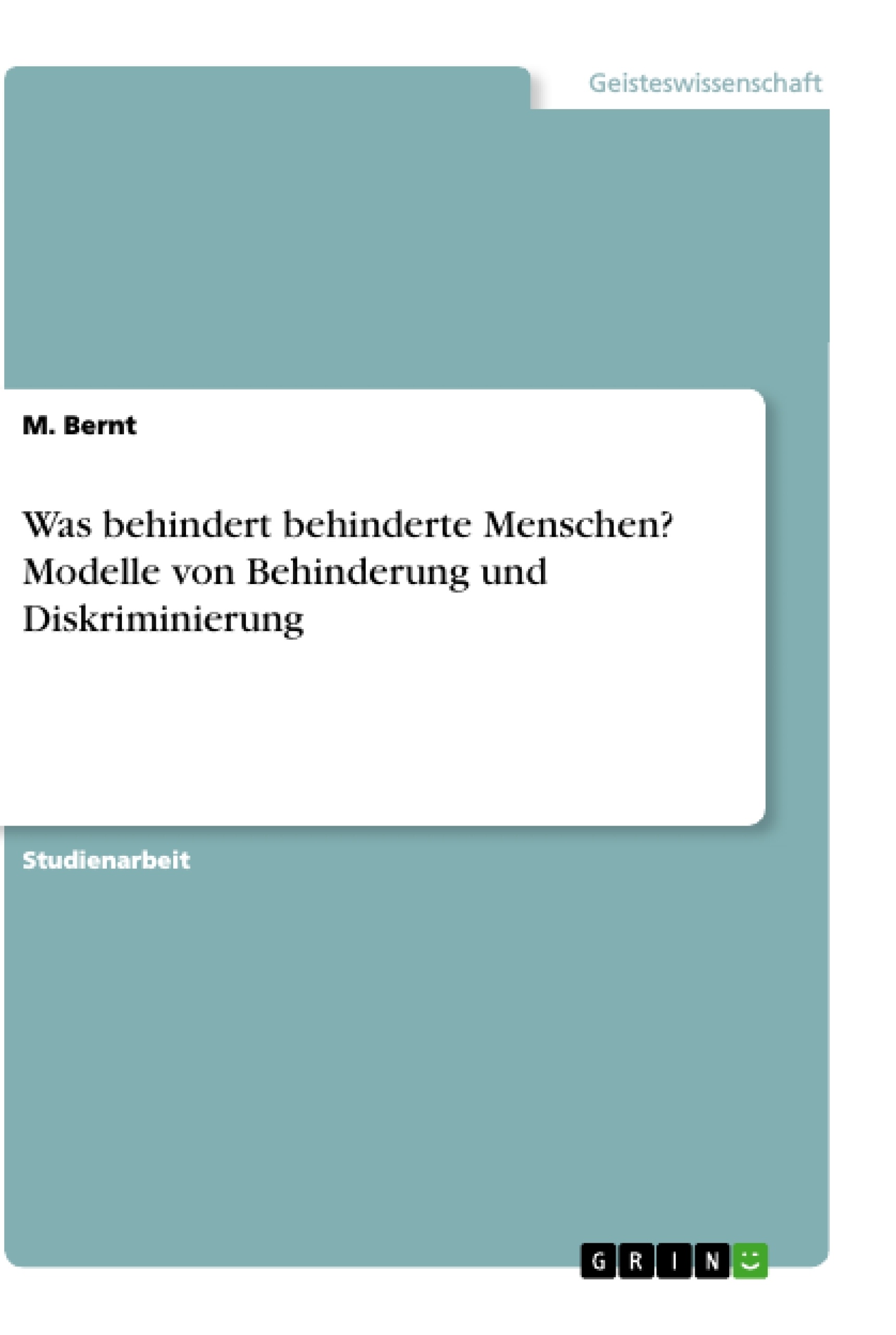Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, was behinderte Menschen behindert, sie also daran hindert, ein selbstbestimmtes Leben mit voller gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeit zu führen.
Es existieren mehrere Modelle von Behinderung, die die unterschiedlichen Auffassungen davon, was Behinderung sei, wiedergeben. Im Hauptteil dieser Arbeit werden die folgenden Modelle vorgestellt: das medizinische beziehungsweise individuelle Modell von Behinderung, das soziale Modell von Behinderung, das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung und das menschenrechtliche Modell von Behinderung. Zu jedem Modell wird in einem Zwischenfazit festgehalten, wie die Fragestellung "Was behindert behinderte Menschen?" im Sinne des jeweiligen Modells zu beantworten ist. Dem schließt sich jeweils eine kritische Betrachtung des Modells an. Außerdem wird darauf eingegangen, welche Rolle Diskriminierung aufgrund von Behinderung (Ableismus) für die Behinderung spielt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Modelle von Behinderung
- 2.1 Das medizinische bzw. individuelle Modell von Behinderung
- 2.1.1 Kritik am medizinischen bzw. individuellen Modell von Behinderung
- 2.2 Das soziale Modell von Behinderung
- 2.2.1 Kritik am sozialen Modell von Behinderung
- 2.3 Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung
- 2.3.1 Kritik am bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung
- 2.4 Das menschenrechtliche Modell von Behinderung
- 2.4.1 Kritik am menschenrechtlichen Modell von Behinderung
- 3 Diskriminierung
- 3.1 Diskriminierung aufgrund von Behinderung (Ableismus)
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, welche Faktoren behinderte Menschen an einem selbstbestimmten Leben mit voller gesellschaftlicher Partizipation hindern. Die Relevanz dieser Fragestellung für die Soziale Arbeit wird herausgestellt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Modelle von Behinderung und deren Kritikpunkte.
- Verschiedene Modelle von Behinderung (medizinisch, sozial, bio-psycho-sozial, menschenrechtlich)
- Kritikpunkte der einzelnen Modelle von Behinderung
- Der Einfluss von Diskriminierung (Ableismus) auf die Behinderung
- Partizipation und Selbstbestimmung behinderter Menschen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Hindernissen für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in den Mittelpunkt. Die Bedeutung des Themas für die Soziale Arbeit wird betont, unter Verweis auf die Rolle der Sozialen Arbeit im Hilfesystem für behinderte Menschen und die potenzielle Rolle von Sozialarbeiter*innen als unbeabsichtigte Schöpfer von Barrieren. Die steigende Anzahl schwerbehinderter Menschen in Deutschland unterstreicht die Aktualität der Thematik. Die Arbeit kündigt die Vorstellung verschiedener Modelle von Behinderung an, die im Hauptteil analysiert und kritisch beleuchtet werden.
2 Modelle von Behinderung: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Modelle zur Betrachtung von Behinderung. Es wird deutlich gemacht, dass die Vorstellung von Behinderung von gesellschaftlich vorgegebenen Konzepten und Diskursen beeinflusst wird. Die Arbeit betont die Bedeutung der Disability Studies als Grundlage für ein "neues Denken" über Behinderung. Es wird der Zusammenhang zwischen der gängigen Laienvorstellung von Behinderung und dem medizinischen Modell hervorgehoben, welches als Ausgangspunkt für die Diskussion dient.
2.1 Das medizinische bzw. individuelle Modell von Behinderung: Dieses Kapitel beschreibt das medizinische Modell, das Behinderung als Abweichung von der Norm definiert und den Fokus auf individuelle Defizite und medizinische Rehabilitation legt. Die Kritik an diesem Modell wird angedeutet, indem die Vorstellung vom "Normkörper" und die Reduktion gesellschaftlicher Benachteiligung auf körperliche oder kognitive Anomalien in Frage gestellt werden. Das Kapitel legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, in denen alternative Modelle vorgestellt und diskutiert werden.
3 Diskriminierung: Dieses Kapitel behandelt den Einfluss von Diskriminierung aufgrund von Behinderung (Ableismus) auf die Lebensrealität behinderter Menschen. Es wird voraussichtlich die komplexen Wechselwirkungen zwischen individuellen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Barrieren beleuchten und eine vertiefte Analyse der Auswirkungen von Ableismus liefern. Dieses Kapitel baut auf den vorhergehenden Kapiteln auf, indem es die in den Modellen beschriebenen Problematiken mit der Realität der Diskriminierung verbindet.
Schlüsselwörter
Behinderung, Modelle von Behinderung, medizinisches Modell, soziales Modell, bio-psycho-soziales Modell, menschenrechtliches Modell, Diskriminierung, Ableismus, Partizipation, Selbstbestimmung, Soziale Arbeit, Inklusion, Disability Studies.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Modelle von Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Faktoren, die behinderte Menschen an einem selbstbestimmten Leben mit voller gesellschaftlicher Partizipation hindern. Ein besonderer Fokus liegt auf verschiedenen Modellen von Behinderung und deren Kritikpunkten, sowie dem Einfluss von Diskriminierung (Ableismus).
Welche Modelle von Behinderung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das medizinische/individuelle Modell, das soziale Modell, das bio-psycho-soziale Modell und das menschenrechtliche Modell von Behinderung. Für jedes Modell werden sowohl die Grundzüge als auch die jeweilige Kritik dargelegt.
Was ist die Kritik am medizinischen Modell?
Das medizinische Modell wird kritisiert, weil es Behinderung als individuelle Abweichung von der Norm definiert und den Fokus auf Defizite und medizinische Rehabilitation legt. Die gesellschaftlichen Barrieren und Benachteiligungen werden dabei vernachlässigt.
Was ist das soziale Modell von Behinderung?
Das soziale Modell betont, dass Behinderung nicht durch individuelle Defizite, sondern durch gesellschaftliche Barrieren und Diskriminierung verursacht wird.
Wie wird das soziale Modell kritisiert?
Die Kritik am sozialen Modell umfasst unter anderem die potenzielle Vernachlässigung individueller Bedürfnisse und die Schwierigkeit, den Einfluss individueller Faktoren vollständig auszuschließen.
Was besagt das bio-psycho-soziale Modell?
Das bio-psycho-soziale Modell integriert biologische, psychologische und soziale Faktoren, um Behinderung zu verstehen. Es versucht, sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
Was ist die Kritik am bio-psycho-sozialen Modell?
Die Kritik am bio-psycho-sozialen Modell kann sich auf die Komplexität und die Schwierigkeit der praktischen Anwendung beziehen.
Was ist das menschenrechtliche Modell von Behinderung?
Das menschenrechtliche Modell betont die Rechte behinderter Menschen auf Teilhabe und Selbstbestimmung. Es fordert die Beseitigung von Barrieren und Diskriminierung.
Welche Rolle spielt Diskriminierung (Ableismus)?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Diskriminierung aufgrund von Behinderung (Ableismus) auf die Lebensrealität behinderter Menschen und deren Partizipation.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Behinderung, sowohl im Hilfesystem als auch in Bezug auf die potenzielle Rolle von Sozialarbeiter*innen als unbeabsichtigte Schöpfer von Barrieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Behinderung, Modelle von Behinderung, medizinisches Modell, soziales Modell, bio-psycho-soziales Modell, menschenrechtliches Modell, Diskriminierung, Ableismus, Partizipation, Selbstbestimmung, Soziale Arbeit, Inklusion, Disability Studies.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die Kernaussagen und den Aufbau der Arbeit verdeutlichen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Hindernisse für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen zu untersuchen und die Relevanz dieser Fragestellung für die Soziale Arbeit herauszustellen.
- Quote paper
- M. Bernt (Author), 2018, Was behindert behinderte Menschen? Modelle von Behinderung und Diskriminierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1119627