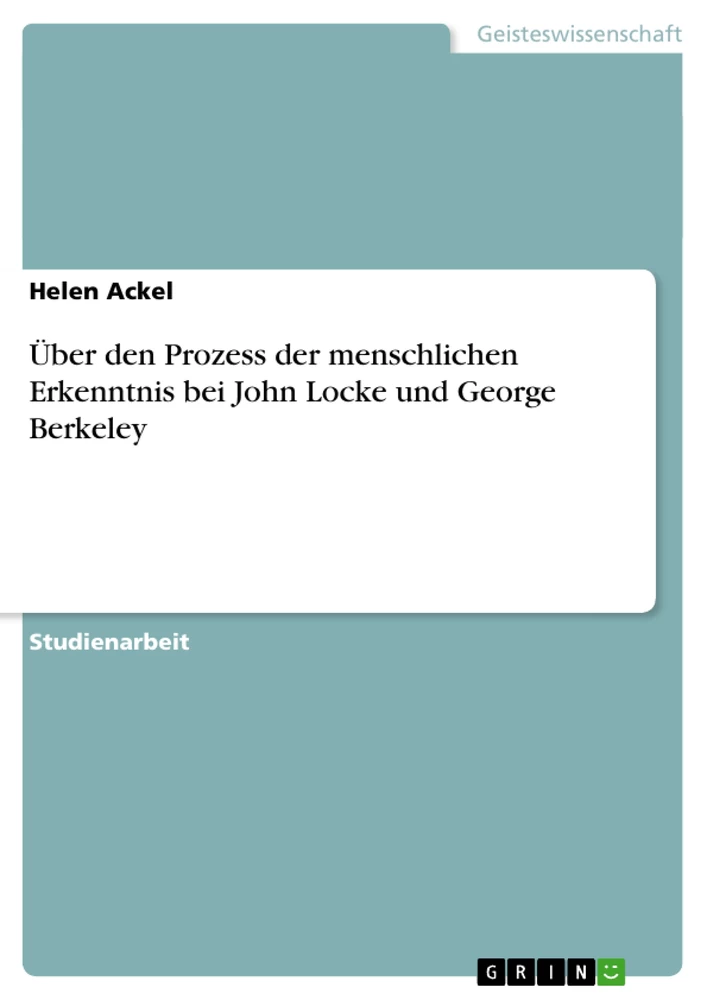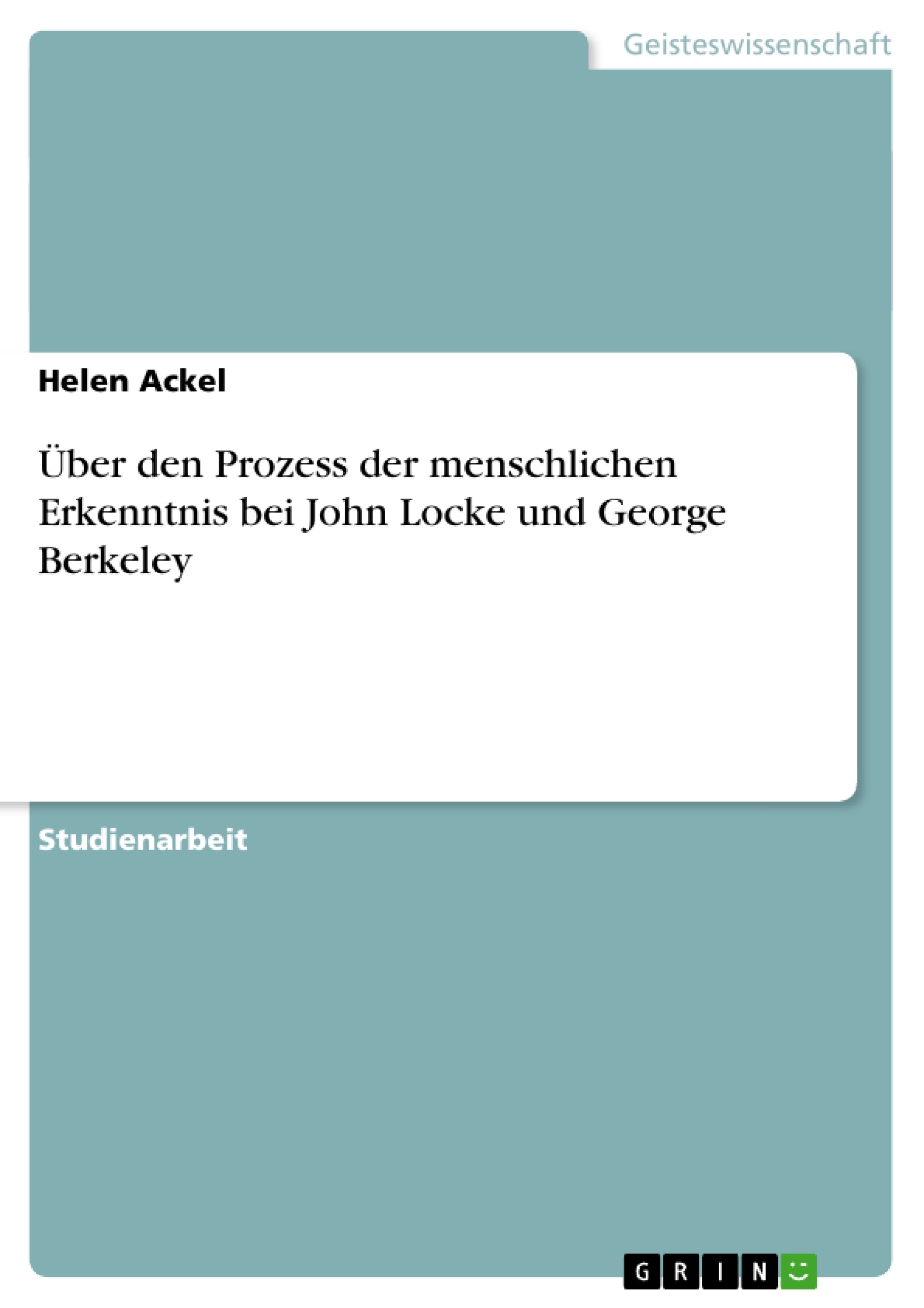Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Gegenüberstellung der Philosophien von John Locke und George Berkeley im Bezug auf erkenntnistheoretische Fragen zur Gewinnung von (allgemeinen) Ideen und ihrem Status im Hinblick auf ihre Funktion in der Sprache. In Anbetracht der Komplexität dieser Thematik, werden die historischen Umstände zur den Entstehungszeiten der benutzten Werke beim Leser vorausgesetzt, d.h. es wird nicht näher erläutert, wie sich das Aufstreben der Naturwissenschaften im England des 17. Jahrhunderts genau geäußert hat, da uns hier nur ihre Auswirkungen auf die Erkenntnistheorien der beiden Philosophen interessiert. Beide Theorien gelten als stellvertretend für die populärsten philosophischen Richtungen der Erkenntnisphilosophie dieser Zeit; ihre Gegenüberstellung soll dem Leser ein umfangreiches Bild über die damaligen erkenntnistheoretischen Forschungen zu diesem Thema bieten.
Zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Argumentationsmuster von Locke und Berkeley sind im Hinblick auf den Schwerpunkt dieser Arbeit nur wenige historische Hintergrundinformationen von Belang: Durch den Aufschwung der mechanischen Naturwissenschaften des 17. Jahrhunderts konnten „immer mehr Phänomene ohne Rekurs auf transzendente Gründe und Zwecke mit den Mitteln der Wissenschaft erklärt werden…“ (Kreimendahl 1994, S.93) Berkeley befürchtete, dass dies auf die „Eliminierung Gottes zugunsten einer rein mechanistisch-materialistischen und damit atheistischen Weltsicht hinauslaufe.“ (ebd.). Doch die Bedrohung der Religion durch die Wissenshaft war nur ein Aspekt, den Berkeley bekämpfen wollte; ihre negative Auswirkung auf die Philosophie galt es zudem einzudämmen. Erklärungsansätze zur Wahrnehmung, die „wir… mittels der Vernunft zu berichtigen suchen“ führen nach Berkeley nicht nur zu Atheismus, sondern auch in „hoffnungslosen Skeptizismus...“ (Berkeley 2005, §1). Berkeley macht es sich nun zur Auf-gabe, die „Prinzipien ausfindig (zu) machen, die all jene Zweifelhaftigkeit und Ungewissheit, jene Absurdität und Widersprüche bei den einzelnen Philosophenschule veranlasst haben, derart, dass die größten Weißen unsere Unwissenheit für unheilbar gehalten haben , indem sie sie auf die natürliche Schwäche und Beschränktheit unserer Geisteskräfte zurückführten.“( Berkeley 2005, §4). Eines dieser falschen Prinzipien ist für Berkeley „die Meinung, der Geist habe ein Vermögen, abstrakte Ideen oder Begriffe der Dinge zu bilden.“( Berkeley 2005, §6) [Hervorh. im Original], was auch zum „Mißbrauch der Sprache“(ebd.) führe. Die genaue Darlegung dieser Theorie wird ausführlich im Mittelteil dieser Arbeit behandelt werden. Betrachtet man nun die Hauptargumente von Berkeleys Philosophie, wird schnell deutlich, warum er als Widersacher Lockes gilt: Während Berkeley eine natur-wissenschaftliche Betrachtung der Erkenntnis ablehnt und somit eine stark theologisch motivierte Philosophie verfolgt, steht Lockes Theorie ganz im Zeichen ersterer, wenn er als Ursprung all unserer Ideen nicht den Geist bzw. den göttlichen Geist angibt, sondern die bewusstseinsunabhängige Materie. Zudem baut Lockes Sprachphilosophie, anders als bei Berkeley, auf der Existenz abstrakter Ideen auf, um allgemeine Ideen und Begriffe erklären zu können. Die genaue Erläuterung mit Literaturangaben findet sich im Mittelteil der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
1. John Lockes Ideenlehre
1. 1 Gewinnung von Ideen
1. 2 Ideen-Arten
1. 3 Verhältnis von Ideen und Wirklichkeit
1. 3 Lockes Sprachphilosophie
2. George Berkeleys Ideenlehre
2. 0 Quelle und Einteilung der Ideen
2. 1 Berkeleys Sprachphilosophie
2. 2 Fazit zu Berkeleys Kritik an Locke
Literatur
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Gegenüberstellung der Philosophien von John Locke und George Berkeley im Bezug auf erkenntnistheoretische Fragen zur Gewinnung von (allgemeinen) Ideen und ihrem Status im Hinblick auf ihre Funktion in der Sprache. In Anbetracht der Komplexität dieser Thematik, werden die historischen Umstände zur den Entstehungszeiten der benutzten Werke beim Leser vorausgesetzt, d.h. es wird nicht näher erläutert, wie sich das Aufstreben der Naturwissenschaften im England des 17. Jahrhunderts genau geäußert hat, da uns hier nur ihre Auswirkungen auf die Erkenntnistheorien der beiden Philosophen interessiert.[1] Beide Theorien gelten als stellvertretend für die populärsten philosophischen Richtungen der Erkenntnisphilosophie dieser Zeit; ihre Gegenüberstellung soll dem Leser ein umfangreiches Bild über die damaligen erkenntnistheoretischen Forschungen zu diesem Thema bieten.
Zum besseren Verständnis der unterschiedlichen Argumentationsmuster von Locke und Berkeley sind im Hinblick auf den Schwerpunkt dieser Arbeit nur wenige historische Hintergrundinformationen von Belang: Durch den Aufschwung der mechanischen Naturwissenschaften des 17. Jahrhunderts konnten „immer mehr Phänomene ohne Rekurs auf transzendente Gründe und Zwecke mit den Mitteln der Wissenschaft erklärt werden…“ (Kreimendahl 1994, S.93) Berkeley befürchtete, dass dies auf die „Eliminierung Gottes zugunsten einer rein mechanistisch-materialistischen und damit atheistischen Weltsicht hinauslaufe.“ (ebd.). Doch die Bedrohung der Religion durch die Wissenshaft war nur ein Aspekt, den Berkeley bekämpfen wollte; ihre negative Auswirkung auf die Philosophie galt es zudem einzudämmen. Erklärungsansätze zur Wahrnehmung, die „wir… mittels der Vernunft zu berichtigen suchen“ führen nach Berkeley nicht nur zu Atheismus, sondern auch in „hoffnungslosen Skeptizismus...“ (Berkeley 2005, §1). Berkeley macht es sich nun zur Auf-gabe, die „Prinzipien ausfindig (zu) machen, die all jene Zweifelhaftigkeit und Ungewissheit, jene Absurdität und Widersprüche bei den einzelnen Philosophenschule veranlasst haben, derart, dass die größten Weißen unsere Unwissenheit für unheilbar gehalten haben , indem sie sie auf die natürliche Schwäche und Beschränktheit unserer Geisteskräfte zurückführten.“ ( Berkeley 2005, §4). Eines dieser falschen Prinzipien ist für Berkeley „die Meinung, der Geist habe ein Vermögen, abstrakte Ideen oder Begriffe der Dinge zu bilden.“ ( Berkeley 2005, §6) [Hervorh. im Original], was auch zum „Mißbrauch der Sprache“ (ebd.) führe. Die genaue Darlegung dieser Theorie wird ausführlich im Mittelteil dieser Arbeit behandelt werden. Betrachtet man nun die Hauptargumente von Berkeleys Philosophie, wird schnell deutlich, warum er als Widersacher Lockes gilt: Während Berkeley eine natur-wissenschaftliche Betrachtung der Erkenntnis ablehnt und somit eine stark theologisch motivierte Philosophie verfolgt, steht Lockes Theorie ganz im Zeichen ersterer, wenn er als Ursprung all unserer Ideen nicht den Geist bzw. den göttlichen Geist angibt, sondern die bewusstseinsunabhängige Materie. Zudem baut Lockes Sprachphilosophie, anders als bei Berkeley, auf der Existenz abstrakter Ideen auf, um allgemeine Ideen und Begriffe erklären zu können. Die genaue Erläuterung mit Literaturangaben findet sich im Mittelteil der Arbeit.
Im Verlauf des Folgenden soll also vor allem die Gegensätzlichkeit der beiden Philosophien im Bezug auf die Erkenntnisgewinnung deutlich gemacht werden; die daraus resultierenden Ansichten bezüglich der Gewinnung und Funktion von Ideen und deren Stellenwert in der Sprache werden ebenso im Mittelteil dieser Arbeit behandelt. Als Grundlage zur Darstellung von Lockes Ideenlehre wird sein Essay Concerning Human Understanding nach Peter Nidditchs Übersetzung von 1979 verwendet, wobei sich die Stellenangaben der Reihe nach auf das Buch, das Kapitel und den Paragraphen beziehen. Für Berkeleys Philosophie, die Principles of Human Knowledge, da er in diesem Werk direkt auf Lockes Ideenlehre Bezug nimmt.
1. John Lockes Ideenlehre
1. 1 Gewinnung von Ideen
Um Berkeleys Kritik an Lockes Ideenlehre nachvollziehen zu können, soll hier zunächst Lockes Philosophie im Wesentlichen dargestellt werden.
Nach Udo Thiel ist für Locke die Erfahrung letztendliche Quelle aller unserer Ideen. Diese ist gegliedert in „innere Erfahrung“(„Reflexion“), wodurch uns allgemeine Ideen von Tätig-keiten des Geistes vermittelt werden, und „äußere Erfahrung“(„Sensation“), also Ideen, die wir über die Wahrnehmung der Außenwelt gewinnen. Auf die hierdurch vermittelten Ideen kann der menschliche Geist Operationen wie Vergleichen, Abstrahieren usw. anwenden und so komplexe Ideen bilden, die über die eigentliche Erfahrung selbst hinausgehen.
(Thiel 1997, S. 68-88, S.281)
Ideen können aber nur über Perzeption der „Kräfte“ bzw. „Qualitäten“ der Gegenstände der äußeren Welt im menschlichen Geist entstehen. Locke unterscheidet hier zwischen „aktiver“ und „passiver“ Kraft, d. h. es muss eine aktive Kraft im Gegenstand geben, die eine Idee in uns erzeugt, die wir wiederum passiv empfangen. (Nidditch 1979, II.xxi.2) (Thiel 1997, S.203). Diese „Kräfte“ der Materie, nennt Locke auch „Qualitäten“, wobei er zwischen „sekundären“ und „primären“ Qualitäten unterscheidet. Den Zusammenhang zwischen Ideen und Qualitäten, sowie ihre Gliederung beschreibt er in folgendem Passus:
„Whatsoever the Mind perceives in it self, or is the immediate object of Perception, Thought, or Understanding, that I call Idea; and the Power to produce any Idea in our mind, I call Quality of the Subject wherein that power is. Thus a Snow-ball having the power to produce in us the Ideas of White, Cold and Round, the Powers to produce those Ideas in us, as they are in the Snow-ball, I call Qualities; and as they are Sensations or Perceptions, in our Understandings, I call them Ideas; which Ideas, if I speak of sometimes, as in the things themselves, I would be understood to mean those Qualities in the Objects which produce them in us” (Nidditch 1979, II.viii.8) [Hervorh. im Original].
Nach dieser Definition gibt es also zwei Arten von Qualitäten, die Ideen in uns entstehen lassen: auf der einen Seite, die Kräfte, die dem Gegenstand bewusstseinsunabhängig inhärent sind und auf der anderen, die, welche wir dem Gegenstand aufgrund unserer Wahrnehmung zuschreiben.[2]
-Doch was genau unterscheidet nach Locke die primären, von den sekundären Qualitäten?
Die primären Qualitäten erklärt Locke am Beispiel eines Weizenkorns:
"Take a grain of Wheat, divide it into two parts, each part has still Solidity, Extension, Figure, and Mobility; divide it again, and it retains still the same qualities; and so divide it on, till the parts become insensible, they must retain still each of them all those qualities.” (Nidditch 1979, II.viii.9) [Hervorh. Im Original]
Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist demnach, dass diese Klasse von Eigenschaften im Körper auch dann Bestand haben, wenn wir sie nicht wahrnehmen, was wiederum seine These von der bewusstseinsunabhängigen Materie unterstreicht. Den Unterschied zwischen den primären und den sekundären Qualitäten von Gegenständen und den aus ihnen resultierenden Ideen beschreibt Locke folgendermaßen:
„…the Ideas of primary Qualities of Bodies, are Resemblences of them, and their Patterns do really exist in the Bodies themselves; but the Ideas, produced in us by these Secondary Qualities, have no resemblances of them at all.” (Nidditch 1979, II.viii.15) [Hervorh. im Original]
Wir können also über die wirkliche Beschaffenheit der Dinge, ihre „reale Essenz“, keine gesicherten Aussagen treffen, da nicht wahrnehmbare Teilchen, oder Korpuskel (s.o.), die Träger der primären Qualitäten sind, die in uns als wahrnehmendem Subjekt, durch verschiedene Konfigurationen Ideen von Farbe, Kälte und Gestalt entstehen lassen. Dieser Umstand hat zur Folge, dass wir bei der Beschreibung eines Gegenstandes auf die von uns perzipierten Eigenschaften zurückgreifen, die nur im wahrnehmenden Subjekt existieren, nicht aber im Gegenstand selbst.[3]
[...]
[1] Kreimendahl, Lothar: Hauptwerke der Philosophie. Rationalismus und Empirismus. Reclam, 1994. Stuttgart. S.89-92.
[2] Kienzle, Bertram: Primäre und Sekundäre Qualitäten. In: Thiel, Udo (Hrsg.): John Locke. Essay über den menschlichen Verstand. Akademie Verlag, 1997. (Klassiker Auslegen, Bd.6).
Häufig gestellte Fragen zum Text
Worum geht es in der Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Philosophien von John Locke und George Berkeley hinsichtlich erkenntnistheoretischer Fragen zur Gewinnung von Ideen (insbesondere allgemeiner Ideen) und deren Funktion in der Sprache. Sie untersucht, wie beide Philosophen die Herkunft von Ideen sehen und welche Rolle diese in ihrer Sprachphilosophie spielen.
Welche historischen Umstände werden vorausgesetzt?
Die Arbeit setzt beim Leser ein Verständnis für die historischen Umstände voraus, insbesondere den Aufstieg der Naturwissenschaften im England des 17. Jahrhunderts und dessen Einfluss auf die Erkenntnistheorien von Locke und Berkeley. Es wird nicht detailliert erläutert, wie sich dieser Aufstieg äußerte, sondern der Fokus liegt auf den Auswirkungen auf die philosophischen Theorien.
Warum werden Locke und Berkeley gegenübergestellt?
Locke und Berkeley vertreten unterschiedliche philosophische Richtungen der Erkenntnistheorie ihrer Zeit. Ihre Gegenüberstellung soll ein umfassendes Bild der damaligen erkenntnistheoretischen Forschungen zu diesem Thema vermitteln.
Was war Berkeleys Motivation für seine Philosophie?
Berkeley befürchtete, dass der Aufschwung der mechanischen Naturwissenschaften zu einer Eliminierung Gottes und einer rein mechanistisch-materialistischen Weltanschauung führen würde. Er wollte die negativen Auswirkungen auf die Religion und Philosophie eindämmen.
Worin unterscheidet sich Berkeleys Philosophie von Lockes?
Berkeley lehnt eine naturwissenschaftliche Betrachtung der Erkenntnis ab und verfolgt eine theologisch motivierte Philosophie. Er kritisiert Lockes Annahme, dass der Geist abstrakte Ideen bilden kann. Locke hingegen sieht die bewusstseinsunabhängige Materie als Ursprung aller Ideen und seine Sprachphilosophie baut auf der Existenz abstrakter Ideen auf.
Welche Schwerpunkte werden in der Arbeit gesetzt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Gegensätzlichkeit der Philosophien von Locke und Berkeley im Bezug auf die Erkenntnisgewinnung, die Gewinnung und Funktion von Ideen und deren Stellenwert in der Sprache.
Welche Werke werden als Grundlage verwendet?
Für Lockes Ideenlehre wird sein Essay Concerning Human Understanding nach Peter Nidditchs Übersetzung von 1979 verwendet. Für Berkeleys Philosophie werden die Principles of Human Knowledge herangezogen, da er in diesem Werk direkt auf Lockes Ideenlehre Bezug nimmt.
Wie gewinnt man Ideen nach Locke?
Nach Locke ist die Erfahrung die Quelle aller Ideen. Diese Erfahrung teilt sich auf in "innere Erfahrung" (Reflexion) und "äußere Erfahrung" (Sensation). Der Geist kann diese Ideen verarbeiten und komplexe Ideen bilden.
Was sind primäre und sekundäre Qualitäten nach Locke?
Primäre Qualitäten sind Eigenschaften, die einem Gegenstand bewusstseinsunabhängig inhärent sind (z.B. Festigkeit, Ausdehnung, Form). Sekundäre Qualitäten sind Eigenschaften, die wir dem Gegenstand aufgrund unserer Wahrnehmung zuschreiben (z.B. Farbe, Kälte). Locke argumentiert, dass Ideen primärer Qualitäten Ähnlichkeiten mit den Objekten selbst haben, während Ideen sekundärer Qualitäten keine solche Ähnlichkeit aufweisen.
Warum können wir keine gesicherten Aussagen über die "reale Essenz" der Dinge treffen?
Weil die wahrnehmbaren Eigenschaften (sekundären Qualitäten) nur im wahrnehmenden Subjekt existieren und nicht im Gegenstand selbst. Die Träger der primären Qualitäten sind nicht wahrnehmbare Teilchen (Korpuskel), die durch verschiedene Konfigurationen Ideen entstehen lassen.
- Quote paper
- Helen Ackel (Author), 2006, Über den Prozess der menschlichen Erkenntnis bei John Locke und George Berkeley, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111872