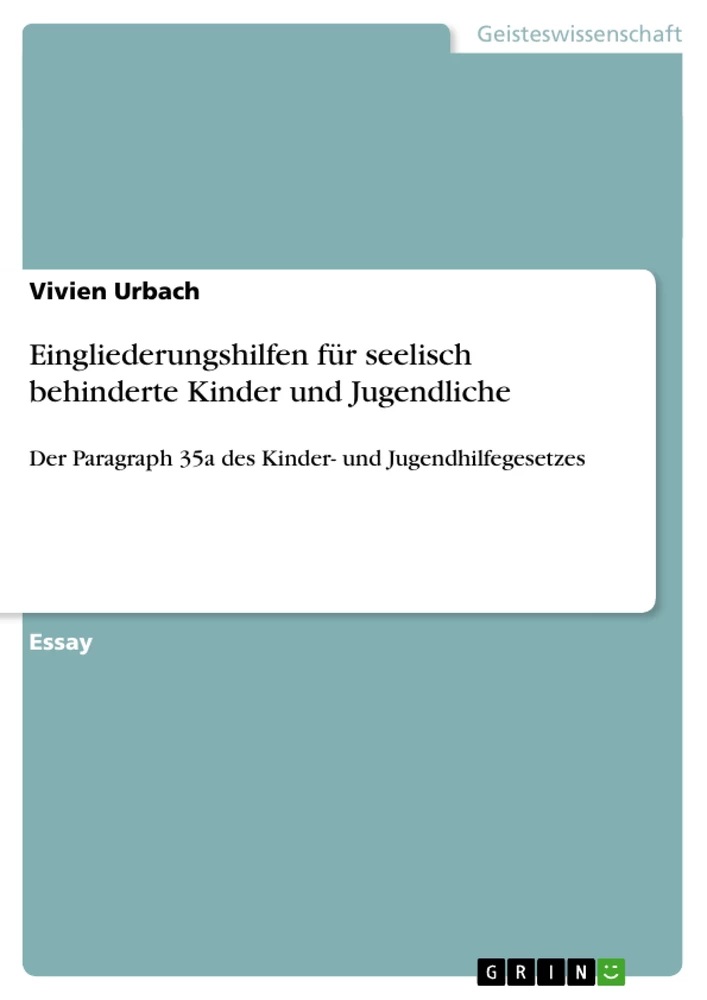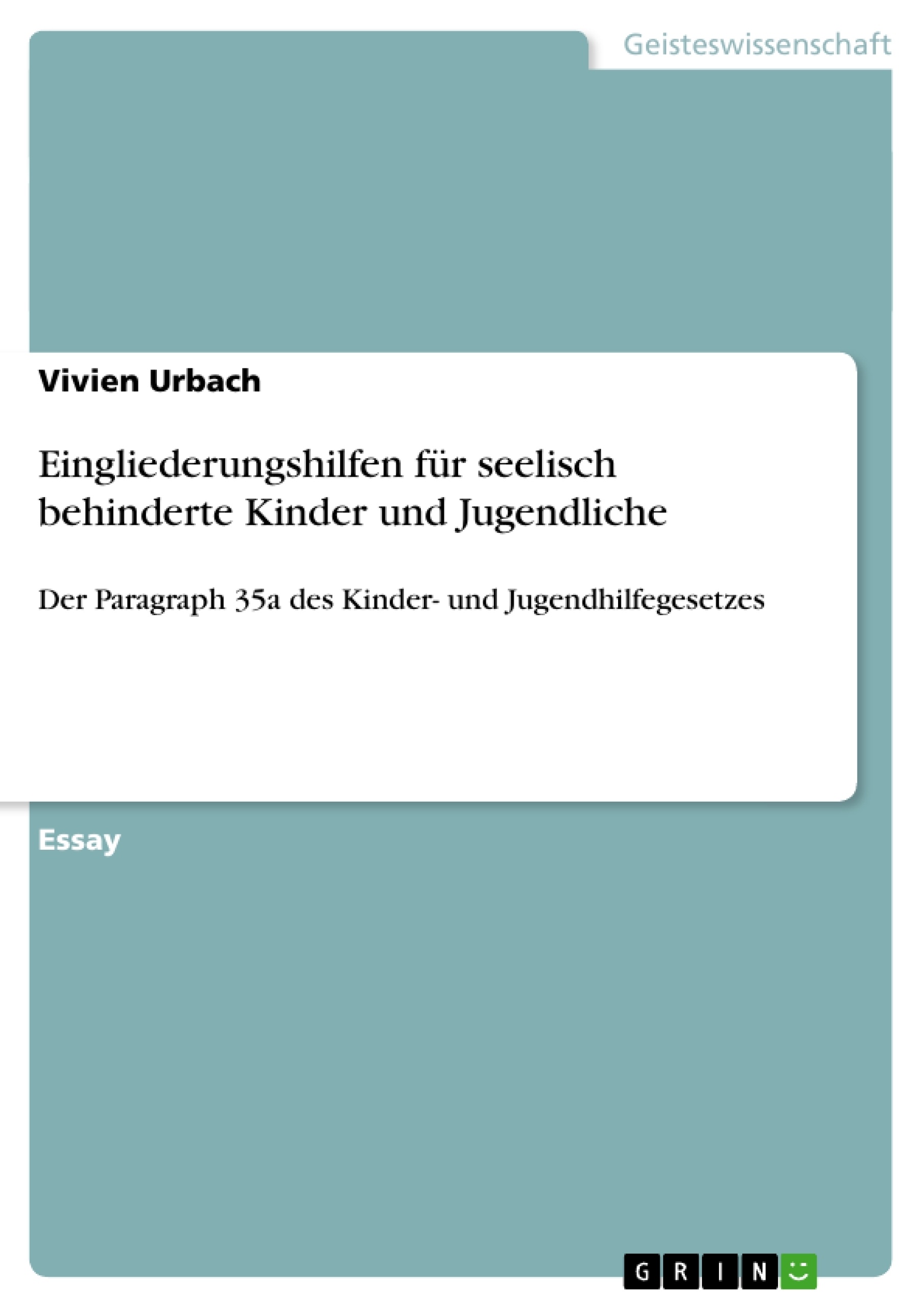Eine seelische Behinderung ist nicht so offensichtlich wie ein körperliches Gebrechen und wird bei Kindern nicht unbedingt an erster Stelle vermutet.
Eine frühzeitige Erkennung ist sehr wichtig für den Betroffenen. Leider wird eine seelische Behinderung bei Kindern und Jugendlichen jedoch oft verkannt, was zu mangelnder Rücksichtnahme durch Außenstehende führt und fatale Folgen für den/ die Betroffenen haben kann.
Die Erweiterung des Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) um den § 35a stellt eine wesentliche Erleichterung und Verbesserung für die Betroffenen auf der Suche nach Hilfe dar. Es muss aber weiterhin Ziel sein, ihnen und den Angehörigen von behinderten Menschen sämtliche Angebote und Hilfsmassnahmen überschaubar nahe zu bringen und leicht zugänglich zu machen. Dieses Abstract zeigt eine kurze Darstellung der Problematik und zeigt Lösungsansätze auf Grundlage des § 35a KJHG auf.
Gliederung
1. ‚Behinderung’: Begriff und Definition
1.1 Die Entwicklung und heutige Bedeutung des Begriffes Behinderung
1.2 Allgemeine Definition von Behinderung
1.2 Was ist seelische Behinderung?
2. Grundlagen: Das KJHG und der §35a
2.1 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
2.2 Der Paragraph 35a KJHG (Gesetzestext) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
3. Der Paragraph 35a KJHG – Bedeutung und Umsetzung
3.1 Die Formalitäten
3.1.1 Antrag und erstes Beratungsgespräch
3.1.2 Das ärztliche Gutachten
3.1.3 Hilfekonferenz und Hilfeplan
3.2 Die Eingliederungshilfen (nach § 35a KJHG)
3.2.1 Ambulante Form
3.2.2 Tages- und teilstationäre Einrichtungen
3.2.3 Pflegepersonen
3.2.4 Wohnformen
Schlussbemerkung
Quellenverzeichnis
1. „Behinderung“: Begriff und Definition
1.1 Die Entwicklung und heutige Bedeutung des Begriffes „Behinderung“
Früher war der Begriff der Behinderung ausschließlich auf körperliche Beeinträchtigungen bezogen. Erst im Zeitalter der Industrialisierung wird auch die geistige Behinderung als solche anerkannt. Psychische Störungen und Behinderungen werden jedoch weiter über einen Kamm geschert und mit Intelligenzminderung gleichgesetzt.
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ändern sich die Auffassungen und das „globale Konzept der ‚Schwachsinnigkeit’ oder ‚Idiotie’“ wird aufgelöst. Damit gehen neue Erkenntnisse über die Grundlagen der körperlichen und seelischen Entwicklung des Menschen einher und die Medizin beginnt differenzierte Nosologien (systematische Krankheitslehren) aufzustellen. (Fegert 1994, S.24).
1.2 Allgemeine Definition von „Behinderung“
Nach Lempp (1999) lässt sich eine Behinderung auf drei Ebenen beschreiben:
- objektive Ebene
Andere Behinderungen dienen hierbei als Maßstab und es wird versucht, sich an einem Durchschnittswert zu orientieren. Die Individualität des Einzelnen bleibt dabei außer Acht.
- intersubjektive Ebene
Der Betrachtungsfokus liegt auf den zwischenmenschlichen Beziehungen und somit auf dem Ziel der Reintegration in die Gesellschaft.
- subjektive Ebene
Die betroffene Person soll ihre Beeinträchtigungen selbst einschätzen. Dies erschwert die Abgrenzung, nimmt aber Rücksicht auf individuelle Gegebenheiten.
Entgegen der allgemeinen Auffassung von Behinderung handelt sich nicht um eine Bezeichnung für körperliche, geistige oder seelische Gebrechen, sondern vielmehr beschreibt der Begriff die Folgen dieser Schädigungen für die betroffene Person. Diese Folgen bedeuten die Einschränkung der Lebensfähigkeit der Betroffenen in der Öffentlichkeit und Gesellschaft im Allgemeinen. (Albrecht 1995)
Gemessen am Normalitätsbegriff der Gesellschaft wird festgelegt, wo Normalität aufhört und Behinderung anfängt. (Lempp 1999) „...Behinderung [ist] als ein Prozess der sozialen Beeinträchtigung der Lebensmöglichkeiten menschlicher Individuen zu verstehen.“ (Albrecht 1995, S.32) Das bedeutet, ein Mensch ist behindert, wenn seine Teilhabe am Leben und Alltag in der Gesellschaft beeinträchtigt oder unmöglich ist.
1.3 Was ist seelische Behinderung?
Einen ersten Erklärungsansatz dazu, was seelische Behinderung ist, bietet uns der Paragraph (Gesetzestext: siehe unter 2.3 auf Seite 5) selbst: Von einer Behinderung sprechen wir, wenn der Zustand für das Lebensalter untypisch ist und seit mindestens sechs Monaten anhält. Ein weiteres Kriterium ist - wie bereits angesprochen - die Einschränkung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Vorbote einer seelischen Behinderung ist eine seelische oder auch psychische Störung.
Psychische Störungen, die eine seelische Behinderung bedingen können, sind:
1. körperlich nicht begründbare Psychosen
2. seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von Anfallseiden oder von anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen
3. Suchtkrankheiten
4. Neurosen und Persönlichkeitsstörungen[1]
Eine seelische Behinderung ist nicht so offensichtlich wie ein körperliches Gebrechen und wird bei Kindern nicht unbedingt an erster Stelle vermutet.
Eine frühzeitige Erkennung ist sehr wichtig für den Betroffenen. Leider wird eine seelische Behinderung bei Kindern und Jugendlichen jedoch oft verkannt, was zu mangelnder Rücksichtnahme durch Außenstehende führt und fatale Folgen für den/ die Betroffenen haben kann.
Beispiele für seelische Behinderung in Kindheit und Jugend sind:
- Hyperkinetisches und Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)
- Teilleistungsschwächen
- Dissoziales Verhalten
- Kontaktstörung und Mutismus
- Autismus und autistische Störungen
- Zwangs- und Angstneurosen
- Schulphobie
- Magersucht und andere Essstörungen
- Drogen- und Alkoholabhängigkeit
Seelische Störungen sind in der Regel Folge vom Zusammenwirken verschiedenster Faktoren wie Anlagen, Umwelteinflüsse, etc.[2] Eine seelische Behinderung ist schwer abgrenzbar und lässt sich umso schwerer feststellen, je jünger das Kind ist.
[...]
[1] Aus: Lempp, Reinart: Seelische Behinderung als Aufgabe der Jugendhilfe. § 35a SGB VIII. 4. überarbeitete Auflage. Boorberg, 1999. (Praxis der Jugendhilfe)
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Entwicklung und heutige Bedeutung des Begriffs "Behinderung"?
Früher bezog sich der Begriff der Behinderung ausschließlich auf körperliche Beeinträchtigungen. Erst mit der Industrialisierung wurde auch die geistige Behinderung anerkannt. Psychische Störungen und Behinderungen wurden zunächst mit Intelligenzminderung gleichgesetzt. Im 19. Jahrhundert änderte sich dies, und das Konzept der "Schwachsinnigkeit" wurde differenzierter betrachtet.
Wie definiert man "Behinderung" allgemein?
Nach Lempp (1999) kann Behinderung auf drei Ebenen beschrieben werden: der objektiven, der intersubjektiven und der subjektiven Ebene. Die objektive Ebene orientiert sich an Durchschnittswerten, die intersubjektive an der Reintegration in die Gesellschaft, und die subjektive berücksichtigt die Selbsteinschätzung der betroffenen Person. Behinderung beschreibt die Folgen von Schädigungen für die betroffene Person, die zu Einschränkungen der Lebensfähigkeit in der Öffentlichkeit führen. Ein Mensch ist behindert, wenn seine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder unmöglich ist.
Was versteht man unter seelischer Behinderung?
Eine seelische Behinderung liegt vor, wenn der Zustand für das Lebensalter untypisch ist, seit mindestens sechs Monaten andauert und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränkt. Vorbote einer seelischen Behinderung ist eine seelische oder psychische Störung.
Welche psychischen Störungen können eine seelische Behinderung bedingen?
Psychische Störungen, die eine seelische Behinderung bedingen können, sind:
- körperlich nicht begründbare Psychosen
- seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von Anfallseiden oder von anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen
- Suchtkrankheiten
- Neurosen und Persönlichkeitsstörungen
Welche Beispiele gibt es für seelische Behinderung im Kindes- und Jugendalter?
Beispiele für seelische Behinderung in Kindheit und Jugend sind:
- Hyperkinetisches und Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)
- Teilleistungsschwächen
- Dissoziales Verhalten
- Kontaktstörung und Mutismus
- Autismus und autistische Störungen
- Zwangs- und Angstneurosen
- Schulphobie
- Magersucht und andere Essstörungen
- Drogen- und Alkoholabhängigkeit
- Arbeit zitieren
- Vivien Urbach (Autor:in), 2006, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111803