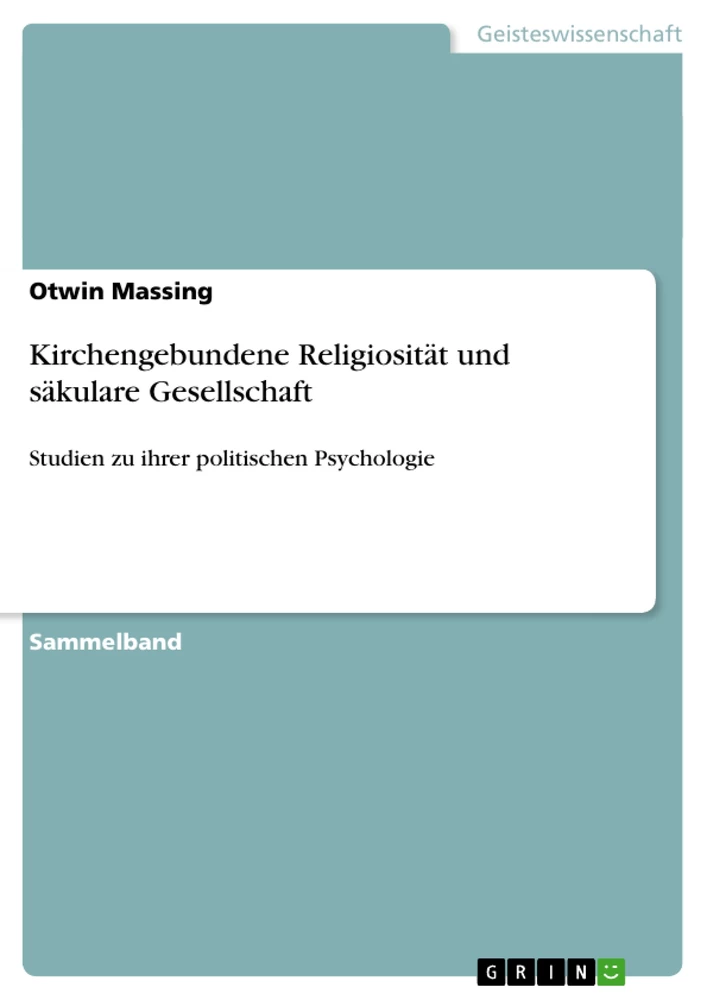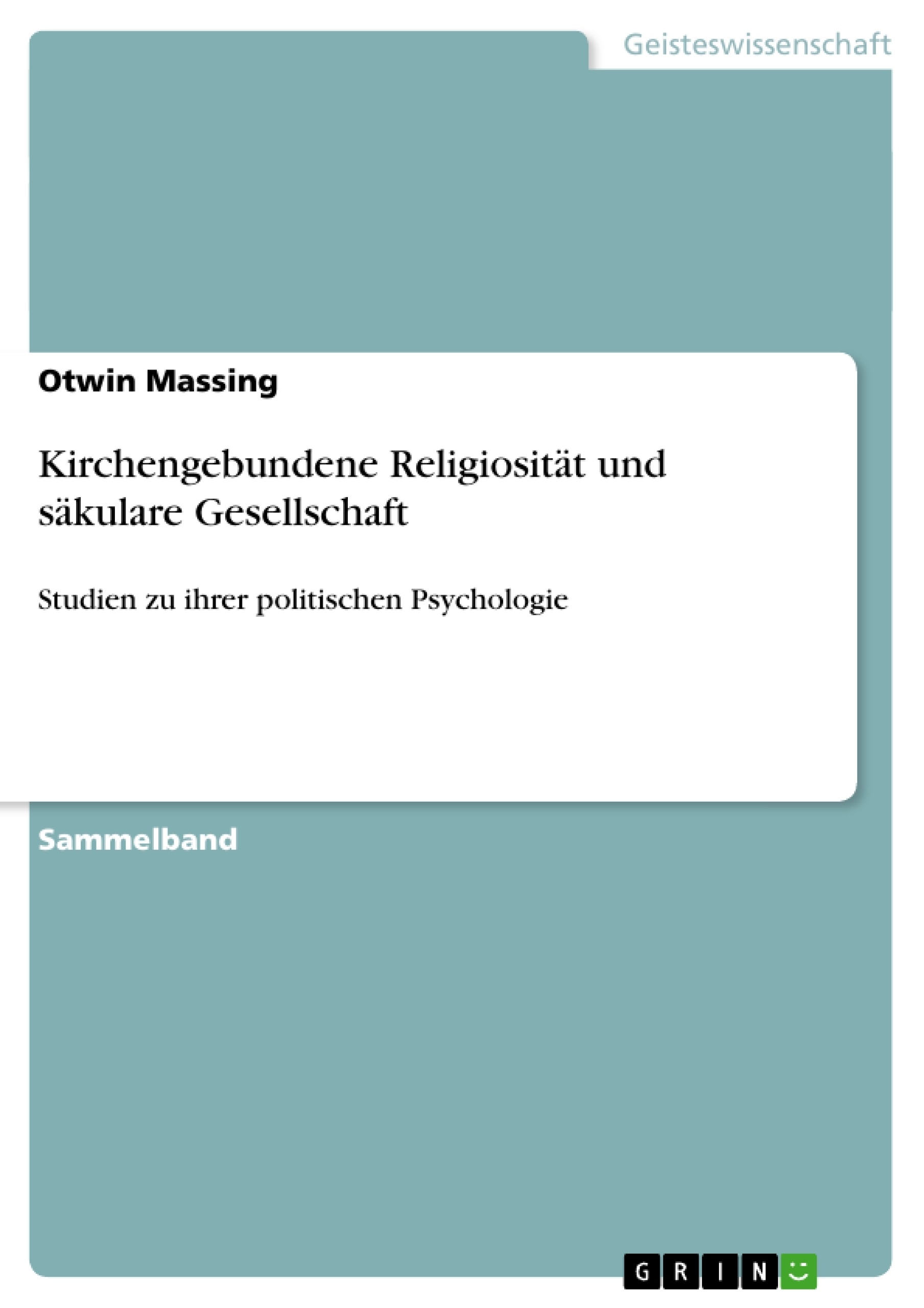Seit den Anfängen der modernen, gleichermaßen an ideologiekritischen wie an organisationstheoretischen Fragestellungen interessierten Religionssoziologie, die zunächst als Soziologie der christlich-abendländischen Kirchen und ihrer jeweiligen Varianten im Kulturkreis der "Neuen Welt" in Erscheinung trat, sind im Zusammenhang mit Untersuchungen zur "organisierten Heilsanstalt", wie die Kirchen in der Nachfolge Max Webers regelmäßig beschrieben wurden, deren jeweiliger Zeitgestalt, insbesondere ihrer verrechtlichten Form gegenüber immer wieder fundamentale Vorbehalte angemeldet worden. Diese erstrecken sich vor allem auf das Problem, ob "Kirche" als institutionell determinierte, in der Regel mit staatlich verbrieften Rechten ausgestattete Anstalt nicht
notwendigerweise den Realitätskontakt zu ihrer "Basis" verlieren und sich aufgrund ihrer Organisationsstruktur von den alltagspraktischen Bedürfnissen ihrer Anhänger unweigerlich entfremden müsse.
In der Folge dieser soziologischen Tradition hat man sich angewöhnt, in Dualen zu reden. Der soziologische, zu analytischen Zwecken durchaus brauchbare, weil Operationalisierungen gestattende Sprachgebrauch, "Amt" und "Gemeinde", "Volk" und "Hierarchie", "Institution" und "Basis" dualistisch einander gegenüberzustellen, wurde zudem von den entsprechenden ekklesiologischen und pastoralen Sprachbildern, kurz: von theologischer Theoriebildung, teils evoziert, teils legitimatorisch gestützt. Die Theologen selber ergingen sich lange Zeit in idealtypisierenden, soziologisch geprägten dualen Argumentationsfiguren. Inzwischen ist eine Tendenzwende eingetreten. Sie betrifft sowohl die Vorbehalte der betroffenen Gläubigen gegenüber der als Provokation empfundenen historischen Zeitgestalt "ihrer" Religion als auch die theologische "Überwindung" jener Dichotomien, die von der Theologie selber produziert worden waren. Erinnert sei nur an die verschiedenen, miteinander konkurrierenden "modernen" Ekklesiologien, die als innertheologischer Reflex auf den soziologisch zwar konstatierbaren, theologisch jedoch inakzeptablen Tatbestand einer Zwei-Reiche-Lehre innerhalb der einen Konfession zu interpretieren sind. Andererseits ufern die weitgehend privat-egoistisch motivierten Distanzierungsversuche kirchengebundener Religiosität in eine "Bewegung" massenhafter Kirchenaustritte aus – Privatreligion wird allgemein –, gleichzeitig nehmen freikirchliche Gruppierungen an Zahl und Bedeutung zu.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Soziologische Überlegungen zum Verhältnis institutionell verfasster "Religion" (Kirche), volkskirchlicher Massen-Basis und "expressiven Gruppen"
- Kapitel 2: Kommunikationstheoretische Überlegungen zum Orientierungsdefizit institutionalisierter Religion heute
- Kapitel 3: Nachrichten für die geistige Provinz? Zum Strukturdilemma konfessioneller (katholischer) Publizistik
- Kapitel 4: Die Kirchen und ihr "image". Materialien und Meinungsprofile zu ihrer Situation in der Bundesrepublik
- Kapitel 5: Der (europäische) Präambelgott. Fetisch, sakralisierende Überhöhung oder Skandalon? Über den Atavismus politischer Symbolsprache in "modernen" Staaten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von institutionalisierter Religion (Kirche), der säkularen Gesellschaft und den individuellen religiösen Praktiken. Sie analysiert die Herausforderungen, denen Kirchen in modernen Gesellschaften gegenüberstehen, und beleuchtet die Kommunikation zwischen Kirche und ihren Anhängern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Medien und der öffentlichen Wahrnehmung von Kirchen.
- Soziologische Analyse des Verhältnisses von Kirche und ihren Mitgliedern
- Kommunikationsprobleme zwischen Kirche und Gesellschaft
- Das Image der Kirche in der Öffentlichkeit
- Die Rolle der Medien in der Darstellung der Kirche
- Politische Symbolik und Religion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Soziologische Überlegungen zum Verhältnis von institutionell verfasster "Religion" (Kirche), volkskirchlicher Massen-Basis und "expressiven Gruppen": Dieses Kapitel befasst sich mit der kritischen Auseinandersetzung der Religionssoziologie mit der Institution Kirche. Es analysiert das Spannungsfeld zwischen der formalen Struktur der Kirche und den Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Die traditionelle Dualität von "Amt" und "Gemeinde", "Volk" und "Hierarchie" wird kritisch hinterfragt, und es wird auf die Entwicklung neuer ekklesiologischer Modelle eingegangen, die diese Dichotomien zu überwinden versuchen. Die zunehmende Distanzierung der Gläubigen von der Kirche wird im Kontext von Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft betrachtet. Die Untersuchung legt ein besonderes Augenmerk auf die historischen Entwicklungen und die damit einhergehenden Veränderungen des Verhältnisses zwischen Kirche und ihren Mitgliedern.
Kapitel 2: Kommunikationstheoretische Überlegungen zum Orientierungsdefizit institutionalisierter Religion heute: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Es wird ein Platzhalter bereitgestellt.)
Kapitel 3: Nachrichten für die geistige Provinz? Zum Strukturdilemma konfessioneller (katholischer) Publizistik: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Es wird ein Platzhalter bereitgestellt.)
Kapitel 4: Die Kirchen und ihr "image". Materialien und Meinungsprofile zu ihrer Situation in der Bundesrepublik: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Es wird ein Platzhalter bereitgestellt.)
Kapitel 5: Der (europäische) Präambelgott. Fetisch, sakralisierende Überhöhung oder Skandalon? Über den Atavismus politischer Symbolsprache in "modernen" Staaten: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Es wird ein Platzhalter bereitgestellt.)
Schlüsselwörter
Kirchengebundene Religiosität, Säkulare Gesellschaft, Religionssoziologie, Institution Kirche, Volkskirche, Expressive Gruppen, Kommunikation, Orientierungsdefizit, Konfessionelle Publizistik, Image, Politische Symbolik, Moderne Staaten.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Soziologische und kommunikationstheoretische Aspekte der Religion in modernen Gesellschaften
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert das Verhältnis von institutionalisierter Religion (Kirche), säkularer Gesellschaft und individuellen religiösen Praktiken in modernen Gesellschaften. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen, denen Kirchen gegenüberstehen, der Kommunikation zwischen Kirche und Anhängern sowie der Rolle der Medien und der öffentlichen Wahrnehmung von Kirchen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text besteht aus fünf Kapiteln:
- Kapitel 1: Untersucht das Spannungsfeld zwischen der formalen Struktur der Kirche und den Bedürfnissen ihrer Mitglieder, die Dualität von „Amt“ und „Gemeinde“, und die Entwicklung neuer ekklesiologischer Modelle. Die zunehmende Distanzierung von der Kirche wird im Kontext von Individualisierung und Pluralisierung betrachtet.
- Kapitel 2: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext)
- Kapitel 3: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext)
- Kapitel 4: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext)
- Kapitel 5: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext)
Welche soziologischen und kommunikationstheoretischen Aspekte werden behandelt?
Der Text behandelt soziologische Aspekte des Verhältnisses von Kirche und ihren Mitgliedern, Kommunikationsprobleme zwischen Kirche und Gesellschaft, das Image der Kirche in der Öffentlichkeit, die Rolle der Medien in der Darstellung der Kirche und die politische Symbolik im Zusammenhang mit Religion.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Kirchengebundene Religiosität, Säkulare Gesellschaft, Religionssoziologie, Institution Kirche, Volkskirche, Expressive Gruppen, Kommunikation, Orientierungsdefizit, Konfessionelle Publizistik, Image, Politische Symbolik, Moderne Staaten.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht das komplexe Verhältnis zwischen institutionalisierter Religion, säkularer Gesellschaft und individuellen religiösen Praktiken. Er analysiert die Herausforderungen für Kirchen in der Moderne und beleuchtet die Kommunikation zwischen Kirche und ihren Anhängern, insbesondere die Rolle der Medien in der öffentlichen Wahrnehmung.
Für welche Zielgruppe ist der Text bestimmt?
Der Text richtet sich an Leser, die sich für die soziologischen und kommunikationstheoretischen Aspekte von Religion in modernen Gesellschaften interessieren. Die akademische Sprache und die detaillierte Analyse der Themen deuten auf eine Zielgruppe mit entsprechendem Vorwissen hin.
- Arbeit zitieren
- Otwin Massing (Autor:in), 2008, Kirchengebundene Religiosität und säkulare Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111752