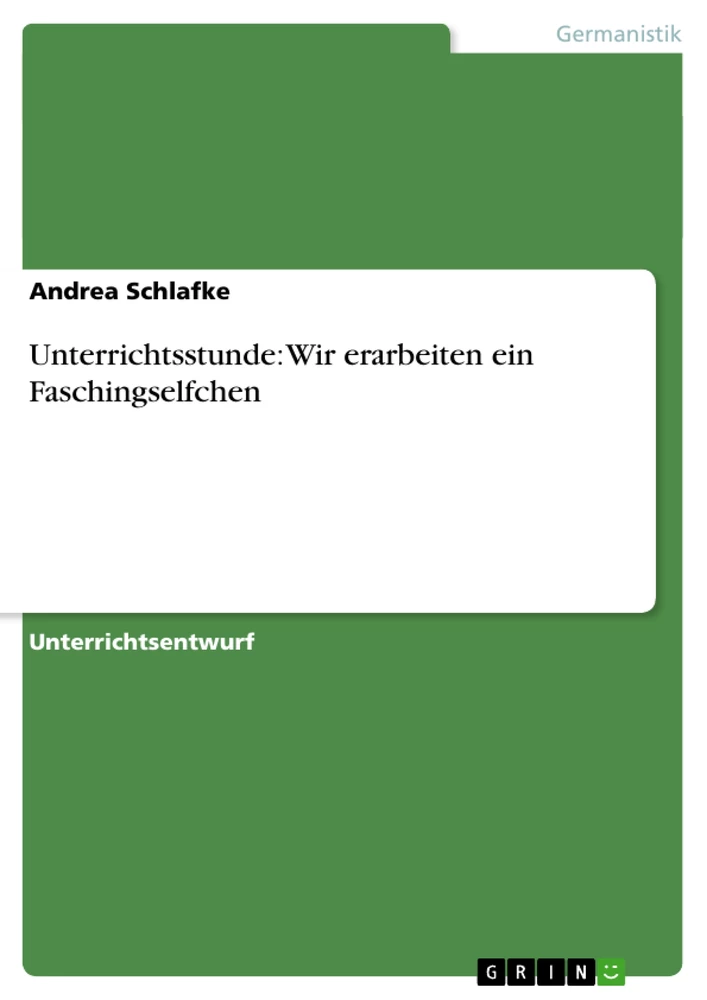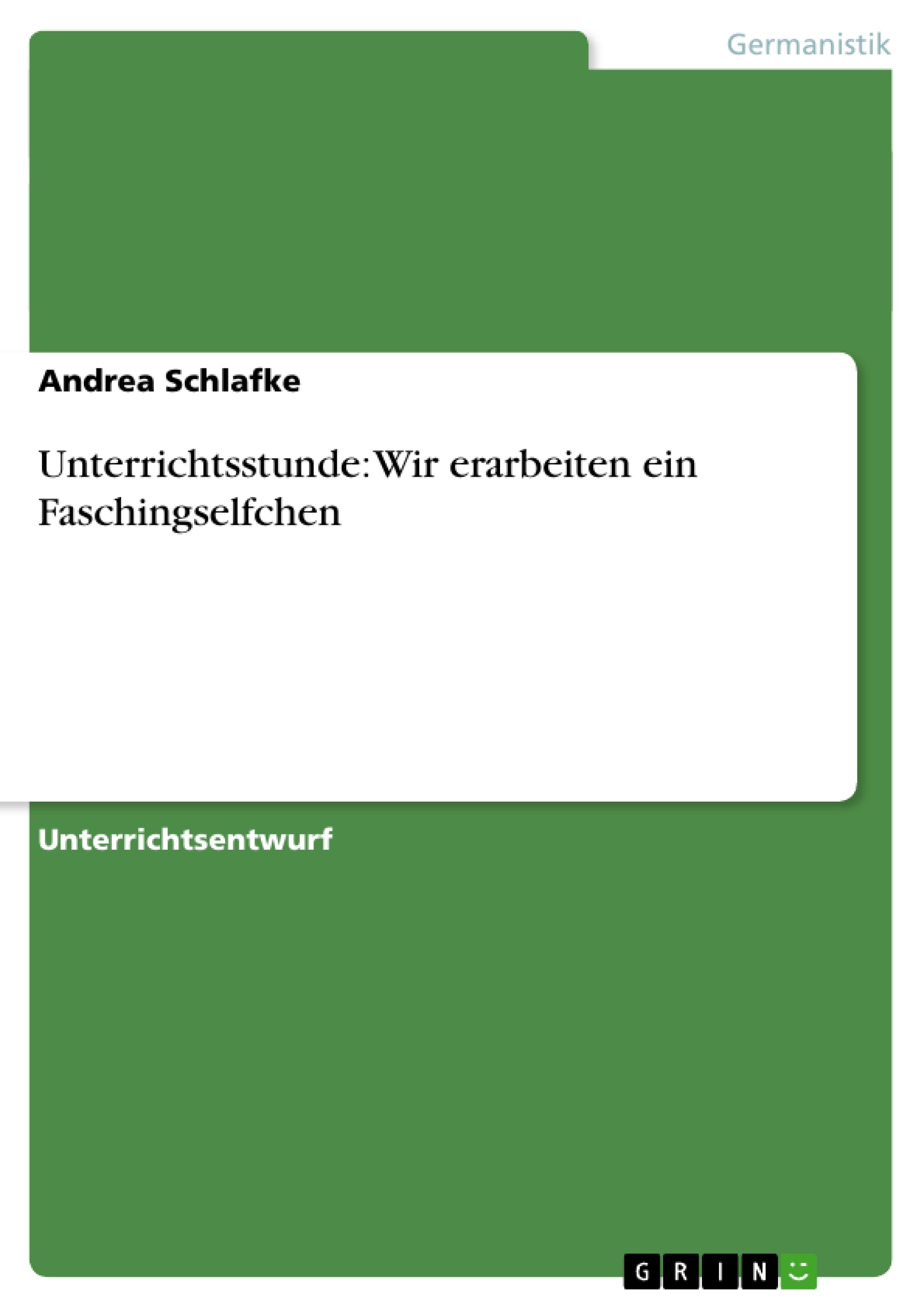Für die Mehrzahl der Kinder stellen lyrische Texte die früheste sprachästhetische Erfahrung dar: Schon dem Säugling wird von den Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern vorgesungen, Einschlaflieder oder Verse werden vorgesprochen. Dadurch bekommen die Kinder schon frühzeitig ein Gefühl für Melodie und Rhythmus, sogar ehe sie überhaupt fähig sind Sprache zu erfassen. Daraus lässt sich folgern, dass die Schüler gewisse Voraussetzungen mitbringen, welche der Lehrer im Unterricht aufgreifen kann. Auch im Laufe des Erwachsenwerdens nimmt das Lied einen wichtigen Platz im Leben vieler Kinder und Jugendlicher ein und stellt somit meist die bedeutendste Vermittlungsart von Lyrik dar. Die Erfahrungen in der Schule – sei es durch Gedichtrezeption oder Gedichtproduktion – können die Kinder prägen. Viele Erwachsene beherrschen heute noch Verse, die sie zu ihrer Grundschulzeit kennen lernten. Allerdings kann der Unterricht auch in schlechter Erinnerung bleiben, beispielsweise durch den lediglich kognitiv erfahrenen Zugang zu Gedichten. Es besteht die Gefahr, dass der Spaß an Lyrik durch diese unästhetische Behandlungsweise vernichtet wird. Das Elfchen ist eine Form von Lyrik, die sich ähnlich der japanischen Gedichtform Haiku, an bestimmte Strukturmerkmale hält. Der Name „Elfchen“ enthält bereits eine wichtige Vorgabe: Das Gedicht besteht aus elf Wörtern, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden. Die erste Zeile besteht aus einem Wort, die zweite aus zwei, die dritte aus drei und die vierte aus vier Wörtern. Den Abschluss bildet ein Wort. Es ist eine gute Möglichkeit für das kreativ-produktive Verfassen eines Textes. Die Anordnung der Wörter erfolgt jeweils nach einem bestimmten, vorher festgelegten Bauplan.
Inhaltsverzeichnis
1. Klassenanalyse
2. Klärung des Sachzusammenhangs
2.1 Bedeutung des Gedichts für den Unterricht
2.2 Sachanalyse zu der Gedichtform „Elfchen“
2.3 Sachanalyse zum Rahmenthema Fasching
2.4 Passung
3. Einordnung in den Lehrplan
3.1 Amtlicher Lehrplan
3.2 Klasseneigener Lehrplan
4. Ziele
4. 1 Übergeordnete Stundenziele
4.2 Kompetenzen
5. Begründung der methodischen Maßnahmen
6. Verwendete Literatur
7. Unterrichtsverlauf
8. Anhang
1. Klassenanalyse
Die Klasse 3 unter der Leitung von Frau xxx besuchen 19 Kinder. Hiervon sind 11 Schüler männlich und 8 weiblich.
In dieser Klasse erteile ich eigenverantwortlichen Unterricht im Fach Kunsterziehung und Förderunterricht, sowie für einige Kinder eine Stunde Förderkurs pro Woche.
Gelegentlich hospitiere ich in dieser Klasse während des Gesamtunterrichts und nehme daran zur Unterstützung der Lehrkraft aktiv teil.
Normalerweise sitzen die Schüler in vier Reihen mit jeweils drei Schulbänken frontal zur Tafel gerichtet.
Für diese Unterrichtsstunde allerdings wurde aus organisatorischen Gründen die Sitzordnung aufgelöst und in eine Hufeisenform gebracht.
So haben die Kinder zu Beginn der Stunde für einen Sitzkreis und zum Abschluss zum Vortragen ihrer Werke ausreichend Platz.
Für Differenzierungsmaßnahmen gibt es an der Schule weitere Räume, so dass die schwächeren und stärkeren Schüler getrennt werden und ihren Ansprüchen gemäß individueller gefördert werden können.
Die Klassenzimmergestaltung ist sehr ansprechend.
Bunte, selbst gemalte Bilder und Zeichnungen und der stets den Jahreszeiten angepasste Fensterschmuck schaffen ein angenehmes und geborgenes Lernklima.
Das große Angebot an Freiarbeitsmaterialien oder auch Hüpfseilen dürfen die Kinder vor dem Unterricht und in der Pause ungefragt nutzen und mit den anderen Klassen teilen.
Ein starkes Leistungsgefälle zeigt sich besonders bei einem Schüler, dem auch eine Leserechtschreibschwäche diagnostiziert wurde. Dieser nimmt zwar meist ebenso aktiv am Unterricht teil, ist aber noch sehr unkoordiniert. Er arbeitet mit mangelhafter Ordnung und Sauberkeit und wird daher im wöchentlichen Förderkurs, besonders wenn es um Lesetexte und Rechtschreibung geht, unterrichtet.
Jedoch zeigt sich jetzt schon bei einigen Schülern in ihrem Lernverhalten und ihrer schnellen Auffassungsgabe, vor allem bei einigen Mädchen, Potenzial für den Übertritt ans Gymnasium.
Die Schüler dieser Klasse sind begeisterungsfähig und zeigen große Wissbegierde. Bisher traten noch keinerlei Disziplinschwierigkeiten auf und auch untereinander kommen die Kinder schnell in Kontakt und sind sowohl der Lehrkraft, wie auch den Mitschülern gegenüber sehr hilfsbereit. Erwähnenswert ist weiterhin die sehr gute Klassengemeinschaft, die unter diesen Schülern vorhanden ist. Sicher gibt es eine gewisse Trennung zwischen Jungen und Mädchen, aber jeder wird akzeptiert und die Grundstimmung ist als gut zu bezeichnen.
2. Klärung des Sachzusammenhangs
2.1 Bedeutung des Gedichts für den Unterricht
Für die Mehrzahl der Kinder stellen lyrische Texte die früheste sprachästhetische Erfahrung dar: Schon dem Säugling wird von den Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern vorgesungen, Einschlaflieder oder Verse werden vorgesprochen. Dadurch bekommen die Kinder schon frühzeitig ein Gefühl für Melodie und Rhythmus, sogar ehe sie überhaupt fähig sind Sprache zu erfassen. Daraus lässt sich folgern, dass die Schüler gewisse Voraussetzungen mitbringen, welche der Lehrer im Unterricht aufgreifen kann.
Auch im Laufe des Erwachsenwerdens nimmt das Lied einen wichtigen Platz im Leben vieler Kinder und Jugendlicher ein und stellt somit meist die bedeutendste Vermittlungsart von Lyrik dar. Die Erfahrungen in der Schule – sei es durch Gedichtrezeption oder Gedichtproduktion – können die Kinder prägen. Viele Erwachsene beherrschen heute noch Verse, die sie zu ihrer Grundschulzeit kennen lernten. Allerdings kann der Unterricht auch in schlechter Erinnerung bleiben, beispielsweise durch den lediglich kognitiv erfahrenen Zugang zu Gedichten. Es besteht die Gefahr, dass der Spaß an Lyrik durch diese unästhetische Behandlungsweise vernichtet wird[1].
2.2 Sachanalyse zur Gedichtform „ Elfchen“
Das kreative Schreiben hat im Laufe der Jahre im Rahmen des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts als ein methodisches Mittel immer mehr Eingang gefunden.[2] „Sprachbetrachtung und eigene Sprachgestalten sollen sich ergänzen. [...] Nicht nur zum Zwecke des besseren Verständnisses von Literatur sollte man das Selbstschreiben, das Dichten" mit Schülern versuchen, sondern jenseits aller Forderungen eines Fachlehrplanes, einfach, um die Freude am Selbstausdruck, mit Sprache schöpferisch umzugehen, zu wecken."[3]
In diesem Sinne rechnet Valentin Merkelbach zu den produktionsorientierten Konzepten im Literaturunterricht im Wesentlichen drei Unterrichtsmodelle:
„1. Das literarische Gespräch über dichterische Texte, das gelegentlich auch von produktiven Schreibverfahren gefördert werden kann,
2. die produktive Vermittlung literarischen Wissens und
3. das kreative Schreiben"[4]
Zu den Methoden des kreatives Schreibens, die in unterschiedlichen thematischen Zusammenhängen zueinander stehen und die sich auch immer miteinander verbinden lassen, können folgende Verfahren gezählt werden:
Verfahren des kreativen Schreibens Beispiele[5]
Assoziatives Verfahren Cluster, etc.
Schreibspiele Geschichten reihum, etc.
Schreiben nach. Vorgaben, Regeln Elfchen, Schreiben nach math. Regeln
und Mustern
Schreiben zu und nach literarischen Textreduktion, zu Ende schreiben,
Texten Werbetexte, Bilderbücher
Schreiben zu Stimuli Musik, Bild, Musik und Bild, Orte (z.B. Museum), vier Elemente
Weiterschreiben an kreativen über den Rand hinaus schreiben,
Texten operieren mit Textteilen, (Revisions-und Produktionsverfahren), Textlupe
In dieser Übersicht findet sich das Elfchen unter dem Punkt Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern.
Das Elfchen ist eine Form von Lyrik, die sich ähnlich der japanischen Gedichtform Haiku, an bestimmte Strukturmerkmale hält. Der Name „Elfchen“ enthält bereits eine wichtige Vorgabe: Das Gedicht besteht aus elf Wörtern, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden. Die erste Zeile besteht aus einem Wort, die zweite aus zwei, die dritte aus drei und die vierte aus vier Wörtern. Den Abschluss bildet ein Wort.
Es ist eine gute Möglichkeit für das kreativ-produktive Verfassen eines Textes.
Die Anordnung der Wörter erfolgt jeweils nach einem bestimmten, vorher festgelegten Bauplan, der in dieser Faschingsstunde wie folgt aussieht:
1. Zeile: Eine Farbe (1 Wort)
2. Zeile: Eine Person oder eine Figur mit dieser Farbe (2 Wörter)
3. Zeile: Deren genauere Beschreibung: Was tut die Person? (3 Wörter)
4. Zeile: Ein Satz über die Person, mit „Ich" beginnend (4 Wörter)
5. Zeile: Ein abschließendes, zusammenfassendes Wort[6]
In diesem Sinn weist das Elfchen eine strenge Struktur mit engen formalen Vorgaben auf. Es kann vielfältige Inhalte haben, die es in verdichteter Form darstellt. Die zunehmende Wortzahl von Zeile zu Zeile innerhalb des Elfchens, sowie die Rückbesinnung auf das lyrische Ich in der vierten Zeile weisen auf eine erweiterte Wahrnehmung hin. Die erste und die fünfte Zeile, in denen jeweils nur ein Wort steht, bilden einen Rahmen, wobei die erste Zeile nur eine Farbe nennt, was dann in der fünften Zeile in einem zusammenfassenden
Wort wieder aufgenommen wird. Außerdem beginnt jede Zeile mit einem Großbuchstaben (ungeachtet der grammatischen Struktur) und es werden keine Satzzeichen verwendet.
Elfchen werden zu bestimmten Themen geschrieben, wie z. B. „Frühlings-EIfchen", „Farb-Elfchen" oder wie in diesem Fall „Faschings-EIfchen".
Möglicherweise stammt das Elfchen aus dem Holländischen. Joachim Frizsche, Günter Waldmann wie auch Mosler / Herholz verweisen auf Jos van Hestvon der Autorenfachschule „Het colofon“ in Amsterdam. Diesen relativ neuen Quellenangaben steht allerdings die Einschätzung Lutz Werders gegenüber, der das Elfchen den klassischen lyrischen Schreibspielen zuordnet. Jos van Hest hat für die Gestaltung des Elfchens als erstes Wort eine Farbe vorgesehen. In der Literatur findet sich jedoch eine Erweiterung auf Eigenschaften, Gegenstände, Tiere, Personen, Gefühle oder Jahreszeiten. In der zweiten Zeile wird die Farbe oder Person näher beschrieben. Die dritte Zeile gibt Auskunft darüber, wo sich der Gegenstand befindet oder lässt weitere Assoziationen zu. In der vierten Zeile nähern sich die Verfasser dem Gegenstand noch weiter an oder schreiben eine persönliche Empfindung dazu, um dann mit dem letzten Wort einen passenden Abschluss zu finden. Dies kann eine Pointe, eine treffender Ausruf, ein Adjektiv oder ein zusammenfassendes Wort sein.[7] „Das letzte Wort fasst Assoziationen zusammen, oft in einem das Ganze überhöhenden Schlussgedanken. Bei sehr gelungen Beispielen wird es der prägnante Punkt, der aus der Wortsammlung etwas Poetisches macht.“[8]
Die Schreibweise der Wörter zu Beginn jeder Zeile ist nicht einheitlich geregelt. Meiner Ansicht nach ist jedoch die wortartengerechte Schreibweise am Anfang jeder Zeile zu bevorzugen, um den Schülern nicht zu suggerieren, dass es sich um eine Aneinanderreihung von Sätzen handelt.
Die Zuordnung des Elfchens im Bereich der deutschen Sprache gestaltet sich insofern schwierig, als dass es sich zwar um eine Gedichtform handelt, das Füllen des Strukturschemas aber dem kreativen Schreiben zugeordnet werden kann.[9] Für die Zuordnung des Elfchens zur Gattung Lyrik spricht der Zwang zur Reduktion bzw. die verdichtete Form von Wörtern. Darüber hinaus werden syntaktische Regeln aufgehoben und eine Versform vorgegeben.[10]
[...]
[1] Spinner, Kaspar H.: Kreatives Schreiben. In: Praxis Deutsch 119/1993, S. 17-23.
[2] Chromik, Therese: „Dichten" in der Schule - wozu? Aufgaben und Ziele des kreativen Schreibens. In: Merkelbach, Valentin (Hrsg.): Kreatives Schreiben. Braunschweig 1993, S. 59.
[3] Ebenda.
[4] Merkelbach, Valentin: Produktionsorientierter Literaturunterricht und kreatives Schreiben. In: Merkelbach, Valentin (Hrsg.): Kreatives Schreiben. Braunschweig 1993.
[5] Maras, Rainer/ Ametsbichler, Josef/ Eckert-Kalthoff, Beate: Handbuch für die Unterrichtsgestaltung in der Grundschule. Planungshilfen. Strukturmodelle. Didaktische und methodische Grundlagen. Donauwörth 20052. S. 162.
[6] Vgl. Auer, M. und Horst w. Hartwig (Hrsg.): Lehrplankommentar für die bayerische Grundschule.
Didaktische Grundlagen und praktische Umsetzung. Band 1. Donauwörth 2001, S. 119.
[7] Vgl. Mosler / Herholz, Die Musenkussmaschine, 1992, S. 58; Stanik, Elfchen – Kinder schreiben Lyrik, 1993, S. 26 und Fritzsche, Schreibwerkstatt, 1989, S. 101.
[8] Schulz, Umgang mit Gedichten, 1997, S. 77f.
[9] Vgl. Mosler /Herholz, Die Musenkussmaschine, 1992, S. 18.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Klassenanalyse?
Die Klassenanalyse beschreibt die Klasse 3 mit 19 Kindern (11 Jungen, 8 Mädchen) unter der Leitung von Frau xxx. Es wird die Unterrichtserfahrung der Autorin in Kunsterziehung, Förderunterricht und gelegentlicher Hospitation beschrieben. Die Sitzordnung, Differenzierungsmaßnahmen, Klassenzimmergestaltung und das Lernklima werden erläutert. Ein Leistungsgefälle wird festgestellt, insbesondere bei einem Schüler mit Leserechtschreibschwäche. Das Potenzial einiger Schüler für den Übertritt ans Gymnasium wird erwähnt, ebenso wie die Begeisterungsfähigkeit, Wissbegierde, Hilfsbereitschaft und die gute Klassengemeinschaft der Schüler.
Was wird im Abschnitt "Klärung des Sachzusammenhangs" behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung von Gedichten für den Unterricht, wobei hervorgehoben wird, dass lyrische Texte oft die früheste sprachästhetische Erfahrung für Kinder darstellen. Es wird die Rolle von Liedern im Leben der Kinder und Jugendlichen erwähnt und die potenziellen positiven und negativen Einflüsse des Unterrichts auf die Wahrnehmung von Lyrik. Des Weiteren wird die Gedichtform "Elfchen" sachanalytisch betrachtet, inklusive ihrer Strukturmerkmale und Anwendung im kreativen Schreiben.
Was ist ein Elfchen?
Ein Elfchen ist eine kurze Gedichtform bestehend aus elf Wörtern, die in fünf Zeilen angeordnet sind: 1 Wort, 2 Wörter, 3 Wörter, 4 Wörter, 1 Wort. Es ist eine Form des kreativen Schreibens mit bestimmten Strukturvorgaben. Im Kontext des Faschings-Elfchens in diesem Dokument wird eine spezielle Anordnung der Wörter vorgeschlagen, die sich auf Farben, Personen/Figuren mit dieser Farbe, deren Beschreibung und einen abschließenden Satz bezieht.
Welche methodischen Überlegungen stecken hinter dem Einsatz des Elfchens im Unterricht?
Der Einsatz des Elfchens wird im Kontext des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts betrachtet. Es soll die Freude am Selbstausdruck und dem schöpferischen Umgang mit Sprache wecken. Das Elfchen wird als Methode des kreativen Schreibens eingeordnet, die es den Schülern ermöglicht, literarisches Wissen produktiv zu vermitteln und sich in einem literarischen Gespräch über dichterische Texte auszutauschen.
Woher stammt das Elfchen und wie hat es sich entwickelt?
Der Ursprung des Elfchens ist nicht eindeutig geklärt, wird aber möglicherweise auf Jos van Hestvon von der Autorenfachschule „Het colofon“ in Amsterdam zurückgeführt. Ursprünglich war die erste Zeile auf eine Farbe beschränkt, wurde aber später auf Eigenschaften, Gegenstände, Tiere, Personen, Gefühle oder Jahreszeiten erweitert. Das letzte Wort soll eine Zusammenfassung oder eine Pointe darstellen.
Wie wird die Schreibweise im Elfchen gehandhabt?
Die Schreibweise der Wörter zu Beginn jeder Zeile ist nicht einheitlich geregelt. Es wird jedoch die wortartengerechte Schreibweise am Anfang jeder Zeile bevorzugt, um den Schülern nicht zu suggerieren, dass es sich um eine Aneinanderreihung von Sätzen handelt.
- Quote paper
- Andrea Schlafke (Author), 2008, Unterrichtsstunde: Wir erarbeiten ein Faschingselfchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111407