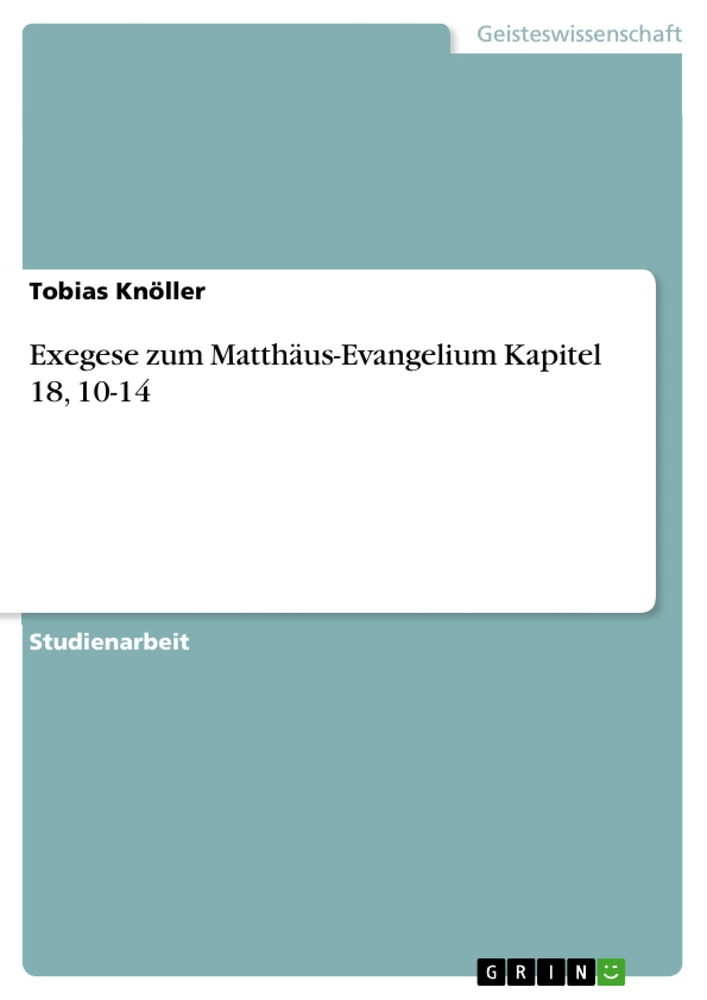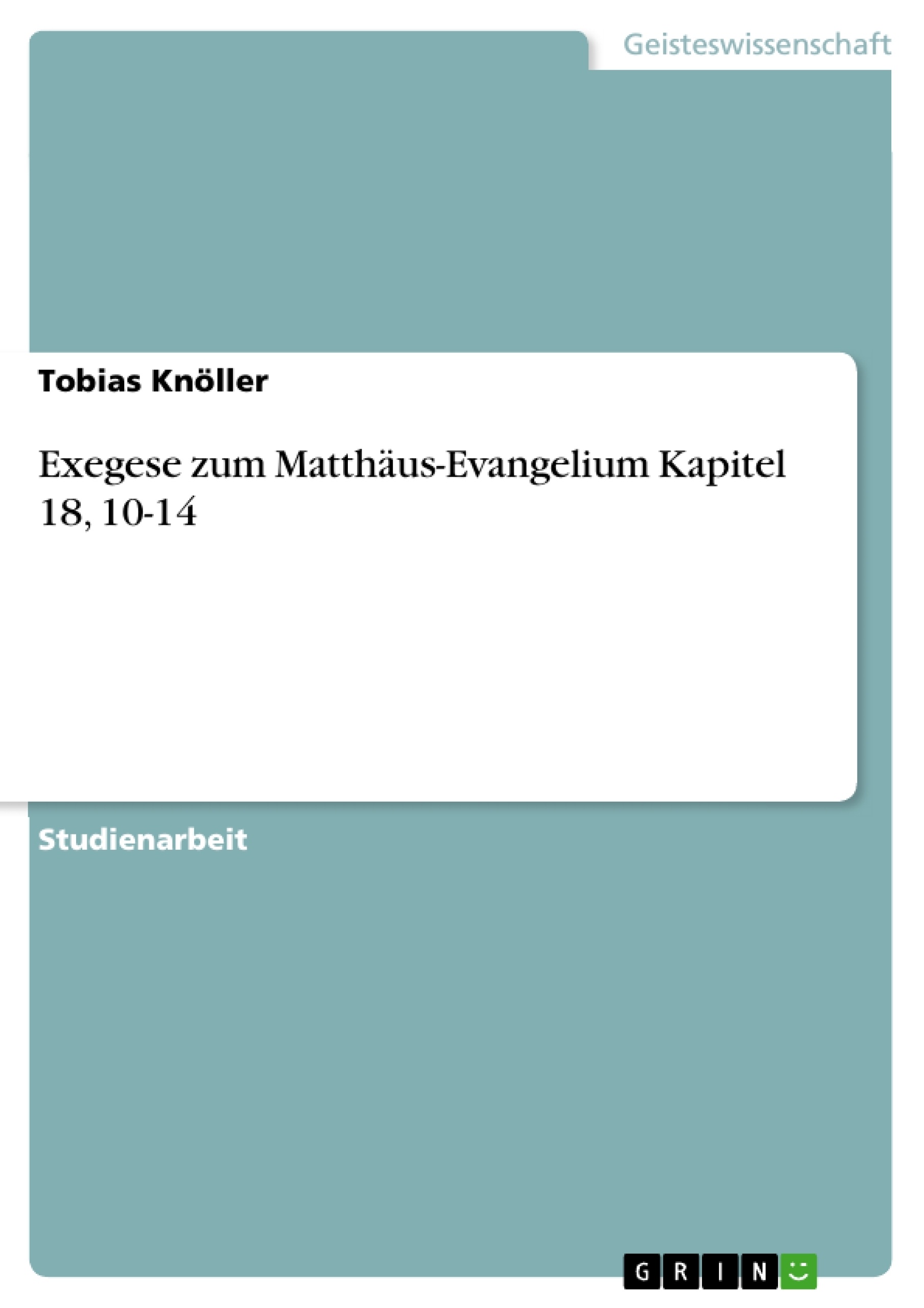Wie bei allen Sätzen unseres Herrn Jesus Christus handelt es sich meiner Meinung nach auch hier um ein Stück der Heiligen Schrift, mit denen der Menschensohn uns Schwachgebliebenen in den Stunden tiefster Nacht und Gottverlassenheit durch den Lichtstrahl seiner Worte die Gnade unseres Gottes wieder erkennen und spüren lässt. Ein Wort, so empfinde ich, voller Wärme und Zuversicht für die am Wegesrand Gehenden und wie ein Wegweiser, eine leuchtende Laterne, auf unseren so schwer passierbaren Lebenswegen.
Es sind jedoch auch Verse, welche uns neben der Ermutigung zugleich auch mahnen und erinnern. Schon zu Beginn des Gleichnisses, beim Lesen und Meditieren des ersten Verses treffen wir auf Worte, die uns Christen in unserem oft so selbstgerechten Alltagstrott wachrütteln. Die uns wieder bewusst machen, dass wir nicht um unser selber Willen glauben und leben dürfen, sondern dass wir gerade denjenigen unter uns Beachtung und Liebe schenken müssen, die in unseren Augen als klein erscheinen bzw. die wir kleiner machen, um selber größer dazustehen. Bei ehrlicher Betrachtung erkennen wir hier leider eine große Gruppe von Menschen und Personen, die in dieses „Raster“ passen: wir können das Wort Jesu einmal wörtlich interpretieren und versuchen zu bedenken, wie mit Kindern und Jugendlichen heutzutage in einigen Fällen umgegangen wird; wie sie teilweise nur als Objekte wahrgenommen, jedoch nicht als Subjekte angenommen werden. Doch ebenso schließt es auch die anderen aus unserer Sicht Kleinen, für uns minimal bedeutsamen oder interessanten Leben ein: Kranke, Alte, Aussätzige, Menschen anderer Religionen oder Konfessionen, Weltansichten, Hautfarben, sexuellen Orientierungen, politischen Einstellungen und so fort. Gerade hier wird für mich unsere eben schon von mir angedeutete große menschliche Schwachheit erkennbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Textbegegnung
- 1.1 Ersteindruck
- 2. Textanalyse
- 2.1 Textkritik
- 2.2 Überlieferungsgeschichte
- 2.3 Redaktionsgeschichte
- 2.4 Formgeschichte
- 2.5 Begriffe und Motive
- 2.6 Einzelexegese
- 3. Textaneignung
- 3.1 Wirkungsgeschichte
- 3.2 Erfahrungsbezug
- 3.3 Botschaft des Textes
- 4. Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Matthäus 18,10-14, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ziel ist eine detaillierte Exegese des Textes, unter Berücksichtigung textkritischer, überlieferungsgeschichtlicher und formgeschichtlicher Aspekte. Die Arbeit beleuchtet die Botschaft des Gleichnisses und deren Relevanz für die heutige Zeit.
- Textkritik und Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen
- Interpretation des Gleichnisses im Kontext des Matthäusevangeliums
- Die Bedeutung der "Kleinen" und der verlorenen Schafe
- Die Rolle des barmherzigen Hirten (Gottes)
- Anwendung des Gleichnisses auf die heutige Gemeinde und das persönliche Glaubensleben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Textbegegnung: Der einführende Abschnitt beschreibt den persönlichen Ersteindruck des Autors vom Gleichnis. Es wird hervorgehoben, dass der Text sowohl Ermutigung als auch Mahnung beinhaltet. Der Autor reflektiert über die Bedeutung der "Kleinen" im Gleichnis und die Gefahr, diese zu verachten, in Bezug auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen (Kinder, Kranke, Alte etc.). Die Barmherzigkeit Gottes und die Suche nach dem Verlorenen werden als zentrale Themen herausgestellt, sowie die Frage nach der eigenen Haltung als Teil der christlichen Gemeinschaft.
2. Textanalyse: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten textkritischen Analyse von Matthäus 18,10-14, indem verschiedene Bibelübersetzungen (Luther, Einheitsübersetzung, Elberfelder) verglichen werden. Der Autor analysiert Unterschiede in der Wortwahl und Satzstruktur und deutet deren Bedeutung. Die Kapitel 2.2 bis 2.6 behandeln die Überlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichte, Formgeschichte, Begriffe und Motive sowie eine Einzelexegese des Textes (obwohl die Details dieser Unterkapitel in dieser Zusammenfassung nicht enthalten sind, da sie auf die jeweiligen Unterkapitel Bezug nehmen).
Schlüsselwörter
Matthäus 18,10-14, Gleichnis vom verlorenen Schaf, Exegese, Textkritik, Überlieferungsgeschichte, Formgeschichte, Barmherzigkeit, die Kleinen, verloren, Hirte, Gemeinde, Glaube.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Hausarbeit: Exegese des Gleichnisses vom verlorenen Schaf (Matthäus 18,10-14)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf in Matthäus 18,10-14. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Exegese des Textes, unter Berücksichtigung textkritischer, überlieferungsgeschichtlicher und formgeschichtlicher Aspekte. Ziel ist es, die Botschaft des Gleichnisses und deren Relevanz für die heutige Zeit zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 ("Textbegegnung") beschreibt den persönlichen Ersteindruck des Autors und erste Reflexionen zum Text. Kapitel 2 ("Textanalyse") beinhaltet eine detaillierte textkritische Analyse, unter Einbezug verschiedener Bibelübersetzungen, sowie die Untersuchung der Überlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichte und Formgeschichte des Gleichnisses. Kapitel 3 ("Textaneignung") befasst sich mit der Wirkungsgeschichte, dem Erfahrungsbezug und der Botschaft des Textes für heute. Kapitel 4 enthält Anlagen (genauer Inhalt nicht spezifiziert).
Welche Methoden werden in der Textanalyse angewendet?
Die Textanalyse verwendet verschiedene exegetische Methoden, darunter Textkritik (Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen), die Untersuchung der Überlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichte und Formgeschichte. Zusätzlich wird eine Einzelexegese durchgeführt, um den Text detailliert zu interpretieren und seine Bedeutung zu erschließen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der "Kleinen" und der verlorenen Schafe im Gleichnis, die Rolle des barmherzigen Hirten (Gottes), und die Anwendung des Gleichnisses auf die heutige Gemeinde und das persönliche Glaubensleben. Die Interpretation des Gleichnisses im Kontext des Matthäusevangeliums spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Matthäus 18,10-14, Gleichnis vom verlorenen Schaf, Exegese, Textkritik, Überlieferungsgeschichte, Formgeschichte, Barmherzigkeit, die Kleinen, verloren, Hirte, Gemeinde, Glaube.
Welche Bibelübersetzungen wurden verwendet?
Die Hausarbeit vergleicht verschiedene Bibelübersetzungen, darunter die Lutherbibel, die Einheitsübersetzung und die Elberfelder Bibel, um textkritische Unterschiede zu analysieren.
Wie wird die Relevanz des Gleichnisses für die heutige Zeit dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie die Botschaft des Gleichnisses vom verlorenen Schaf auf die heutige Gemeinde und das persönliche Glaubensleben angewendet werden kann. Dabei wird auch die Bedeutung der "Kleinen" in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten (z.B. Kinder, Kranke, Alte) reflektiert.
- Quote paper
- Tobias Knöller (Author), 2007, Exegese zum Matthäus-Evangelium Kapitel 18, 10-14, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/111363