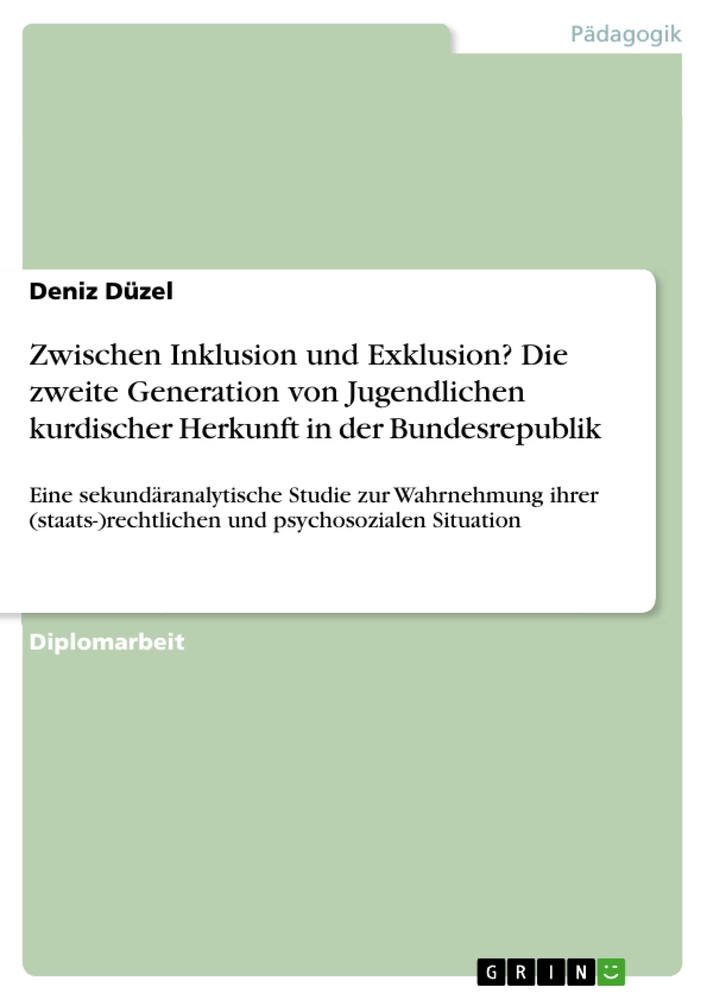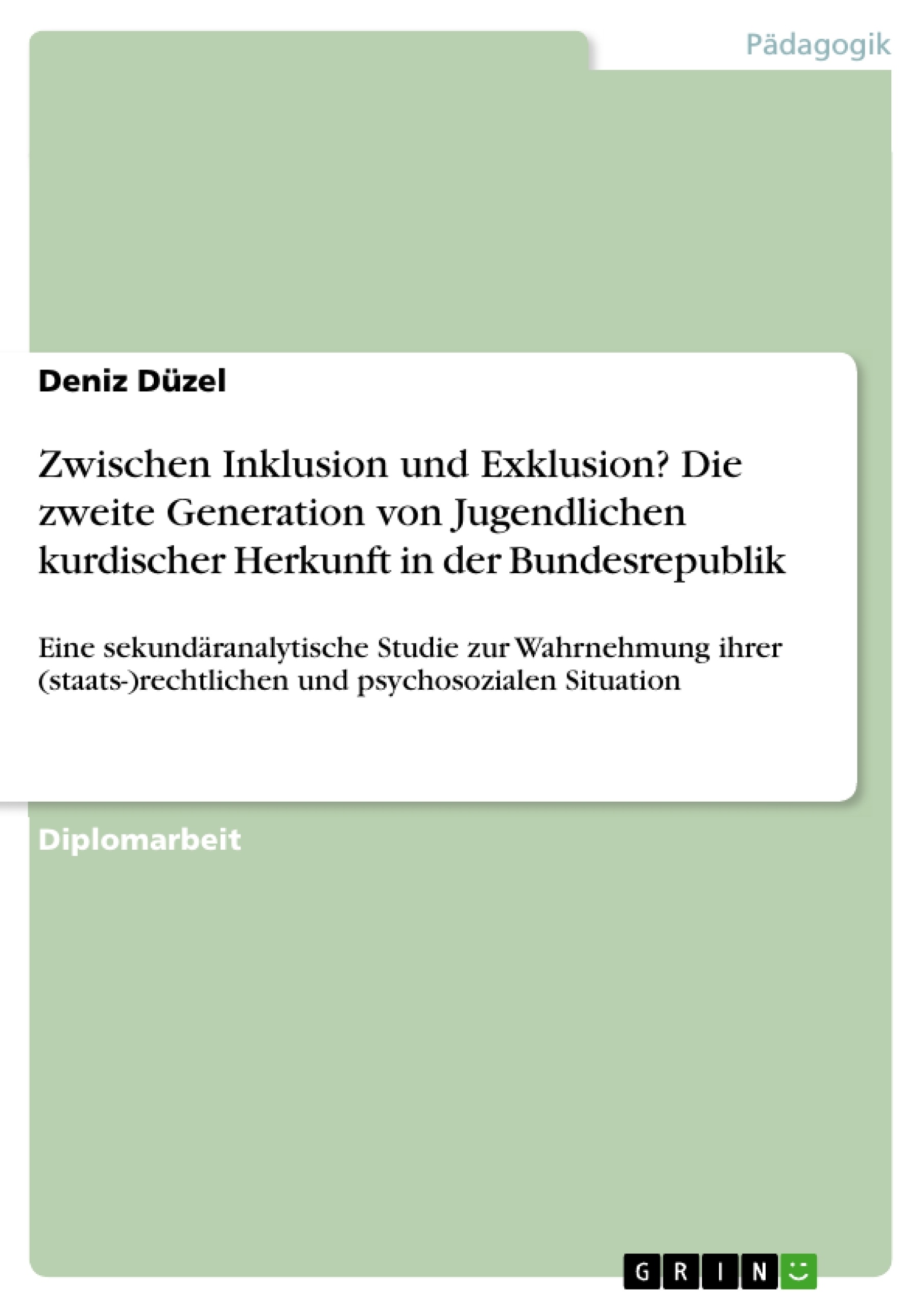In diesem Abschnitt der zugrundeliegenden Arbeit sollen vorneweg die bisherigen Erkenntnisse über den Forschungsstand referiert werden, um darauf aufbauend die eigenen Forschungsziele darzulegen, wenngleich es nicht nur in Bezug auf KurdInnen in der Bundesrepublik, sondern auch über Kurden im Allgemeinen nur wenige Erkenntnisse gibt, die als gesichert gelten können. Daher hat es sich die vorliegende Untersuchung in Anlehnung an bereits verfasste und publizierte Studien (vorwiegend aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, kurz: NRW) zum Ziel gemacht, durch Einblicke in Lebenszusammenhänge und deren Deutung einen Zugang zum Verständnis von und für Jugendliche kurdischer Herkunft aus der Türkei zu eröffnen bzw. fortzuschreiben und mit Hilfe sekundäranalytischen Materials ergänzend zu interpretieren.3 Vor dem Hintergrund, dass „KurdInnen die zweitgrößte Migrantengruppe darstellen und daher auf eine lange Tradition der Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland zurückblicken“ (Schmidt 1998, S.12)4, wird hier mit der Formulierung einer neuen Frage ein Forschungsfeld ausgebreitet, das bisher so gut wie keine Beachtung in der Migrationsforschung erfahren hat. Ausgehend von den vorliegenden qualitativen als auch quantitativen Studien zur Selbst- und Fremdethnisierung dient diese Untersuchung vor allen Dingen der Erforschung der psychosozialen Situation dieser spezifischen ethnischen Minderheit im Umgang mit gesellschaftlicher Erfahrung von Inklusion und Exklusion, weil es ihr an dieser Stelle den gleichen Stellenwert beizumessen gilt, welcher im Hinblick auf andere MigrantInnengruppen (wie etwa die der Türken, Ex-Jugoslawen etc.) schon lange selbstverständlich ist. Es ist also das primäre Anliegen dieser Diplomarbeit, durch die sekundäranalytische Auswertung sowie Interpretation anhand eigener Beobachtungen in verschiedenen Institutionen, die sich mit kurdischen Jugendlichen auseinandersetzen, der deutschen Öffentlichkeit ein differenziertes Bild der kurdischen Minderheit in der Bundesrepublik zu vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG…………………………….
- 1. ZIELSTELLUNG UND GLIEDERUNG…………………....
- I. Theoretischer Bezugsrahmen
- 1. ALLGEMEINER ÜBERBLICK zur MIGRATION......
- 2. DAS KONZEPT DIASPORA.………………………………..
- 2.1 Faktoren der Selbst- und Fremdethnisierung
- 2.2 Transnationalismus: Bezugspunkte und Funktionen
- 2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- 3. HISTORISCHER ÜBERBLICK zu KurdInnen..........
- 3.1 Die Lage der Kurdinnen in der Türkei .....
- 3.2 Kurden und Kurdinnen in der BRD ...
- 3.2.1 Zur Konfliktimportthese......
- 3.2.2 Jugendliche kurdischer Herkunft in Deutschland...42
- II. Kurdische Jugendliche in Familie, Peer-
groups und Alltag
- 1. Das Problem, in zwei Welten zu leben ...
- 2. Zur Lebenswelt kurdischer Jugendlicher in Deutschland........
- 2.1 Grenzgängertum bei kurdischen Jugendlichen....
- 2.2 Die Sprache der Jugendlichen: „Code- Switching" ......
- 2.2.1 Exkurs: Muttersprachlicher Unterricht in Kurdisch: Überblick und aktueller Stand..........
- 3. DIE (MIGRANTEN-) FAMILIE…………………………….
- 3.1 Die Beziehungen zwischen den Familiengenerationen.......
- 1,3.2 Die familiäre Situation der interviewten Jugendlichen........
- 4. PUBERTÄT und ADOLESZENZ………………….
- 4.1 Das Leben in der Gleichaltrigen-Gruppe….........
- 4.2 Freundschaft und Freizeitkontakte der Interviewten........
- 4.3 Zu einigen „Überpointierungen“ im Zusammenhang mit spezifischen Belastungen allochthoner Jugendlicher…..........
- 5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND FAZIT………......
- III. Allochthone Jugendliche im Übergang von
der Schule in die Berufswelt...
- 1. ZUR FUNKTION VON SCHULE
- 1.1 Schulischer Werdegang der Interviewten im europäischen Vergleich………………...
- 1.2 Kriminalisierungstendenzen Jugendlichen.......
- 1.3 Zusammenfassende Auswertung: Der „Dritte Stuhl" als Alternativperspektive……………………..
- 2. Allochthone Jugendliche in AUSBILDUNG, BERUF und
ARBEIT...........
- 2.1 Zur Wahrnehmung von kurdischen Jugendlichen..............
- 2.2 Ausblick: Präventive Maßnahmen und Modellprojekte für die Arbeit mit kurdischen Jugendlichen.....
- 2.3 RESUMEE…........
- 1. ZUR FUNKTION VON SCHULE
- IV. Schlussfolgerungen und forschungsrelevante Perspektiven
- LITERATURVERZEICHNIS
- Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der psychosozialen Situation von Jugendlichen kurdischer Herkunft in Deutschland. Sie untersucht, wie diese Jugendlichen mit gesellschaftlicher Erfahrung von Inklusion und Exklusion umgehen und welche Herausforderungen sie im Kontext ihrer multikulturellen Lebenswelt bewältigen müssen. Die Arbeit basiert auf einer sekundäranalytischen Auswertung von empirischen Studien sowie eigenen Beobachtungen in verschiedenen Institutionen, die sich mit kurdischen Jugendlichen auseinandersetzen.
- Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes Bild der kurdischen Minderheit in der Bundesrepublik zu vermitteln und ihre Besonderheiten gegenüber anderen MigrantInnengruppen aufzuzeigen.
- Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Lebensbedingungen und Erfahrungen von Jugendlichen kurdischer Herkunft in Bezug auf ihre familiäre Situation, ihre Peer-Groups und ihren schulischen Werdegang.
- Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die mit dem „Dritten Stuhl" verbunden sind, und untersucht, wie kurdische Jugendliche zwischen den Kulturen navigieren und ein positives Selbstbild entwickeln können.
- Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse von Kriminalisierungstendenzen bei kurdischen Jugendlichen und der Suche nach präventiven Maßnahmen und Modellprojekten für die Arbeit mit dieser Zielgruppe.
- Die Arbeit untersucht, wie die deutsche Gesellschaft auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Jugendlichen kurdischer Herkunft reagieren kann und welche Rolle die Schule in diesem Kontext spielt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt den aktuellen Forschungsstand zur Situation von KurdInnen in der Bundesrepublik Deutschland dar und erläutert die Forschungsziele der vorliegenden Untersuchung. Sie zeigt auf, dass es bisher nur wenige gesicherte Erkenntnisse über die Lebensbedingungen und Erfahrungen von Jugendlichen kurdischer Herkunft gibt und dass diese Gruppe in der Migrationsforschung bisher kaum Beachtung gefunden hat.
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich dem theoretischen Bezugsrahmen der Untersuchung. Es werden die Konzepte von Migration und Diaspora erläutert und die Faktoren der Selbst- und Fremdethnisierung sowie der Transnationalismus beleuchtet. Das Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der kurdischen Diaspora und die Lage der KurdInnen in der Türkei und in der Bundesrepublik Deutschland.
Das zweite Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Lebenswelt von Jugendlichen kurdischer Herkunft in Deutschland. Es untersucht die Herausforderungen, die mit dem „Dritten Stuhl" verbunden sind, und analysiert die Beziehungen zwischen den Familiengenerationen, die Rolle der Peer-Groups und die Bedeutung von Sprache und Kultur im Alltag der Jugendlichen.
Das dritte Kapitel der Arbeit widmet sich dem Übergang von der Schule in die Berufswelt. Es untersucht den schulischen Werdegang von Jugendlichen kurdischer Herkunft im europäischen Vergleich und analysiert die Kriminalisierungstendenzen bei dieser Gruppe. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Schule als Integrationsfaktor und untersucht, wie die deutsche Gesellschaft auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Jugendlichen kurdischer Herkunft reagieren kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die kurdische Diaspora, Inklusion und Exklusion, Jugendliche kurdischer Herkunft, Lebensbedingungen, Integration, Schule, Beruf, Kriminalisierung, Transnationalismus, Selbst- und Fremdethnisierung, Kultur, Sprache, Familie, Peer-Groups, „Dritter Stuhl".
- Quote paper
- Deniz Düzel (Author), 2006, Zwischen Inklusion und Exklusion? Die zweite Generation von Jugendlichen kurdischer Herkunft in der Bundesrepublik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/110862