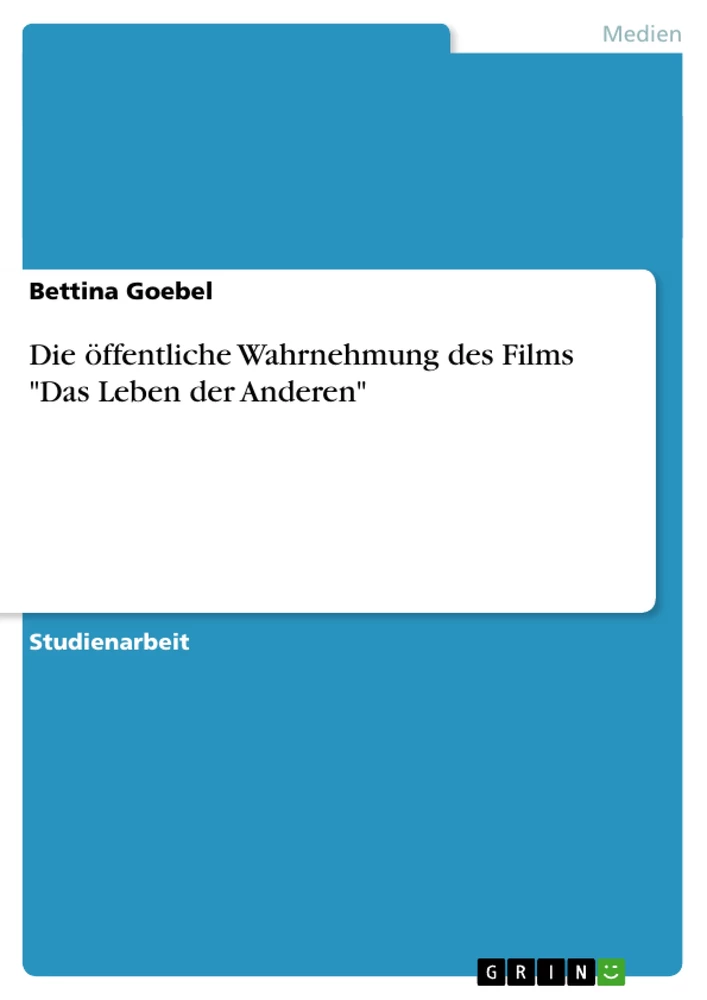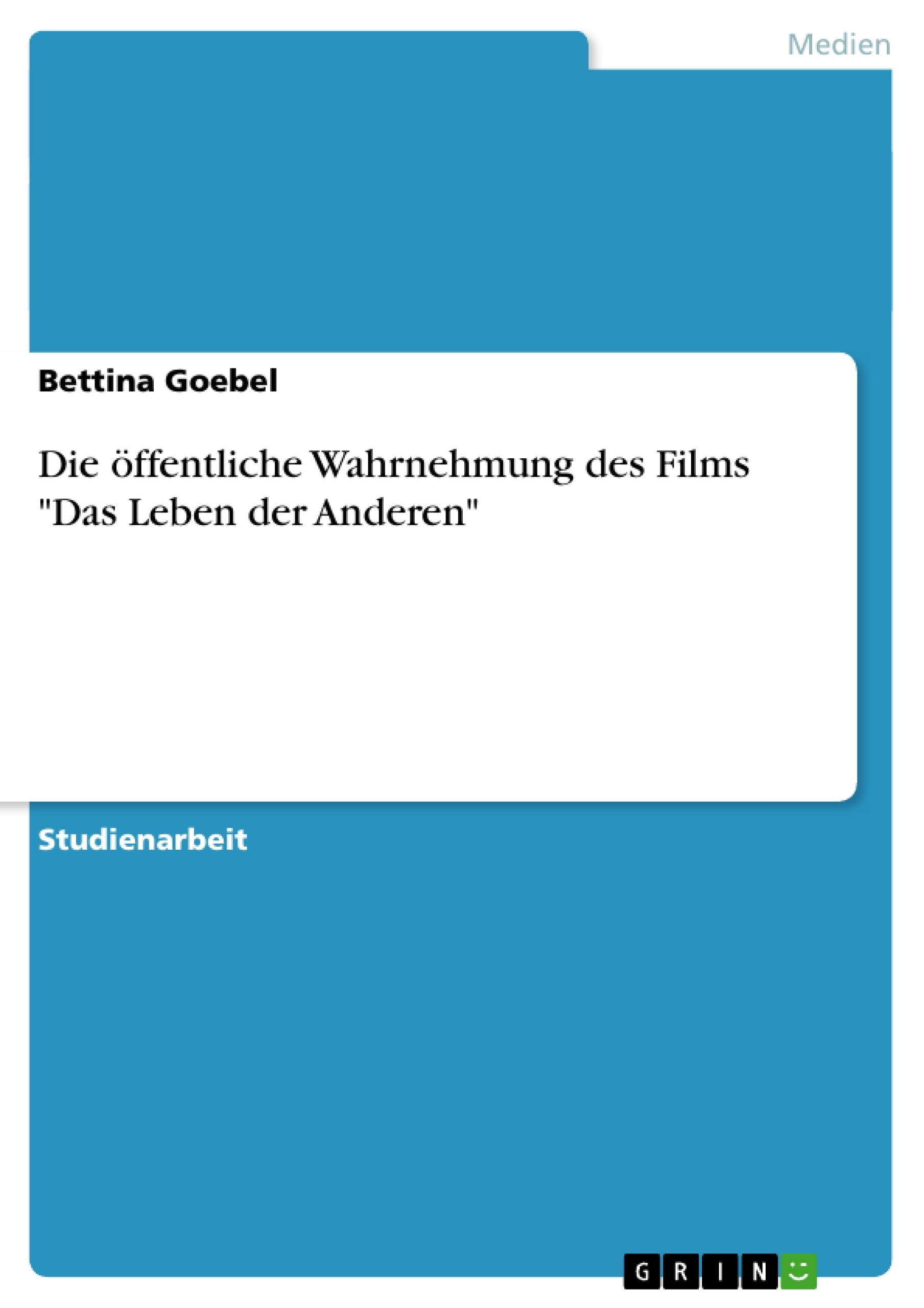In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe zum Teil sehr erfolgreiche deutsche Filme gedreht worden, die zur Zeit der Deutschen Demokratischen Republik und deren Endphase spielen, darunter „Sonnenallee“ von Leander Haußmann und Thomas Brussig (1999), „Helden wie wir“ von Sebastian Peterson und Thomas Brussig (1999) und „Goobye Lenin“ von Wolfgang Becker (2003). Im Gegensatz zu diesen Filmen, die das Thema DDR komödiantisch verarbeiten, beschäftigt sich „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck mit der grausamen Seite des DDR-Regimes, der systematischen „Zersetzung“ von Künstlern durch die Bespitzelung der Staatssicherheit (Stasi).
Sechzehn Jahre nach dem Fall der Mauer hat der Film eine erneute öffentliche Diskussion um die Stasi und ihre Methoden angestoßen und beschäftigt nicht nur die Kritiker der Feuilletons. Mitglieder des Bundestages wurden exklusiv zur Vorpremiere eingeladen, Personen des öffentlichen Lebens mit einschlägiger Kompetenz wie Joachim Gauck, Marianne Birthler und Wolf Biermann haben sich zum Film geäußert. Im Publikum hat er eine Fülle von z.T. sehr emotionalen Reaktionen ausgelöst, die sich in der Presse, wie auch im Fernsehen und in Internet-Foren niederschlagen. In der Talkshow „Menschen bei Maischberger“ hieß es beispielsweise „der Film bedrücke seit Wochen hunderttausende Kinobesucher“.
INHALT
Einleitung
1. Der Film
1.1. Rahmendaten
1.2. Inhalt
2. Verortung – DDR und Stasi als Thema im Post-Wall Cinema
3. Kritikerstimmen
3.1. Einleitung
3.2. Kritikerstimmen Pro
3.3. Kritikerstimmen Contra
4. Die aktuelle Stasi-Debatte und die Reaktion der Opfer
5. Kleiner Nachtrag zum Hintergrund
6. Fazit und Ausblick
Literatur- und Quellennachweis
Modulbegründung
Diese Hausarbeit wurde im Modul 3: „Medienästhetik und Medienanalyse“ erstellt und
erkundet exemplarisch für einen aktuellen deutschen Film die Rezeptionswirkung und
Beurteilung im deutschen Fachpublikum anhand von Rezensionen, beschäftigt sich mit dem
gesellschaftspolitischen Zusammenhang der Filmerzählung, sowie mit Schwächen des
Filmplots. Sie stellt damit kulturelle Bezüge her und beinhaltet Elemente von Medienanalyse
und Medienästhetik. Inhaltlich gibt es Querverbindungen zum Seminar „Ulrich Plenzdorf im
Kontext der Literatur- und Medienlandschaft zweier deutscher Staaten“, wo u.a. die
Einwirkung der Stasi auf die Filmproduktion in der DDR ein Thema war. Das „Post-Wall-
Cinema“, das deutsche Kino nach der Wiedervereinigung, bietet mit dem besprochenen Film
ein besonders interessantes Feld der Vergangenheitsbewältigung durch Unterhaltungskino.
Die spezifischen Ereignisse der deutschen Geschichte und deren Bearbeitung im Film tragen
ihren Teil zum nationalen Selbstverständnis bei. Die Wahrnehmung in einem internationalen
Umfeld, also durch das Ausland, macht den Film zu einem Teil des „World Cinema“.
3
4
Einleitung
In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe zum Teil sehr erfolgreiche deutsche Filme
gedreht worden, die zur Zeit der Deutschen Demokratischen Republik und deren Endphase
spielen, darunter „Sonnenallee“ von Leander Haußmann und Thomas Brussig (1999),
„Helden wie wir“ von Sebastian Peterson und Thomas Brussig (1999) und „Goobye Lenin“
von Wolfgang Becker (2003). Im Gegensatz zu diesen Filmen, die das Thema DDR
komödiantisch verarbeiten, beschäftigt sich „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel
von Donnersmarck mit der grausamen Seite des DDR-Regimes, der systematischen
„Zersetzung“ von Künstlern durch die Bespitzelung der Staatssicherheit (Stasi).
Sechzehn Jahre nach dem Fall der Mauer hat der Film eine erneute öffentliche Diskussion
um die Stasi und ihre Methoden angestoßen1 und beschäftigt nicht nur die Kritiker der
Feuilletons. Mitglieder des Bundestages wurden exklusiv zur Vorpremiere eingeladen,
Personen des öffentlichen Lebens mit einschlägiger Kompetenz wie Joachim Gauck,
Marianne Birthler und Wolf Biermann haben sich zum Film geäußert. Im Publikum hat er eine
Fülle von z.T. sehr emotionalen Reaktionen ausgelöst, die sich in der Presse, wie auch im
Fernsehen und in Internet-Foren niederschlagen. In der Talkshow „Menschen bei
Maischberger“ hieß es beispielsweise „der Film bedrücke seit Wochen hunderttausende
Kinobesucher“2.
Das wirft eine Reihe Fragen auf: „Das Leben der Anderen“ ist keinesfalls der erste Film der
Nachwendezeit, der sich kritisch mit der Stasi und ihren gesellschaftlichen Folgen
auseinandersetzt. Warum also hat es so lange gedauert, bis nach all den Komödien
(jüngstes Beispiel: „NVA“ von Leander Haußmann) ein Film, der sich mit der „dunklen“ Seite
des Überwachungsstaates befasst, ein breites Publikum erreicht? Brauchten die Deutschen
erst einmal einen ausreichenden Abstand durch den komödiantischen, „lockeren“, sogar
albernen Umgang mit der Vergangenheit (z.B. in Ostalgie-Shows), bevor sie sich der
unangenehmen Seite der Geschichte zuwenden konnten?3 „Filme sind Ausdruck eines
1 zeitgleich mit dem „Eklat von Hohenschönhausen“, wie weiter unten näher ausgeführt wird
2 Sendung vom 9.5.2006, ARD: „Im Schatten der Stasi: Hexenjagd oder späte Gerechtigkeit?“.
Der Film wird dort als einer der Anlässe für die Talkshow-Diskussion genannt. Video der Sendung unter
http://www.daserste.de/maischberger/sendung_dyn~uid,i8jhtbgjjlgabj9fj5sxxpdr~cm.asp.
3 Das Ostalgie-Phänomen und die „seltsame Verniedlichung der SED-Diktatur hat der Psychoanalytiker Jochen
Schade als Methode der „Schamabwehr“ bezeichnet.“ Mariam Lau: Schluss mit Lustig. „Die Welt“ v. 22.3.2006
5
zeitbedingten Selbstverständnisses und verraten indirekt vieles über uns: das Publikum“4.
Eignet sich „Das Leben der Anderen“ zur Vergangenheitsbewältigung oder hat der Film gar
eine Art „Deutungshoheit“ für das Thema erlangt, wie manche Kritiker vermuten?5
Wie nehmen die Ost-Zuschauer6 den Film wahr im Vergleich zu den Zuschauern im Westen?
Während die ostdeutschen Zuschauer den Film mit ihren eigenen Erfahrungen abgleichen
können, kann der Film bei West-Zuschauern ohne authentische Erinnerung an die DDR ein
bestimmtes Geschichtsbild prägen, das sie unter Umständen zu einem ähnlichen Urteil
kommen läßt wie Joachim Gauck („Ja, so war es!“)7 - trotz des Wissens, dass es sich um
eine fiktive Erzählung handelt und nicht um einen Dokumentarfilm. Der Film erhebt einen
Anspruch auf Authentizität, der sich unter anderem in der detailgetreuen Ausstattung der
Filmkulisse und der aufwendigen Vorrecherche niederschlägt und hat dadurch bei Publikum
und Kritikern eine Diskussion um wahrheitsgetreue Darstellung entfacht. Der Vorwurf einer
Verfälschung von Geschichte muss angesichts der Vorführung vor Schulklassen durchaus
ernstgenommen werden.
Natürlich können nicht alle der aufgeworfenen Fragen im Rahmen dieser Hausarbeit
beantwortet werden. Um mich dem Thema anzunähern, habe ich ca. 30 Rezensionen,
Interviews und Kritikerstimmen zum Film ausgewertet, darunter von prominenten Experten
wie Joachim Gauck, Marianne Birthler, Wolf Biermann, Thomas Brussig, Hubertus Knabe
(Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen) und Wolfgang Schmidt (ehemaliger
Abteilungsleiter im Ministerium für Staatssicherheit). Ergänzt werden sie durch kritische
Stellungnahmen aus dem Publikum, unter anderem aus dem Forum der Stasi-Opfer8. Eine
vollständige Rezensionsanalyse würde den Rahmen sprengen, daher habe ich mich darauf
beschränkt, die Hauptargumente der Kritiker zu extrahieren und sie gegenüber zu stellen.
Zur Einführung folgen als Nächstes die Rahmendaten und eine Inhaltsangabe des Films,
sowie eine kurze Einordnung in den Kontext anderer Nachwende-Filme über die DDR.
4 Andreas Kötzing, Editorial zu „Film und Gesellschaft“, Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 44/2005
vom 31. Oktober 2005
5 Knut Elstermann: „Mit großer Gester überschätzt“; Neues Deutschland v. 15.5.2006
6 Mit „Ost-“ bzw. „West-Zuschauer“ ist hier das Publikum gemeint, das zur Zeit der deutschen Teilung in den
jeweiligen Landesteilen lebte
7 Stern vom 24.3.2006, http://www.stern.de/unterhaltung/film/558074.html
8 www.stasiopfer.de
6
1. Der Film
1.1. Rahmendaten
„Das Leben der Anderen“ ist der Debütfilm von Regisseur und Drehbuchautor Florian
Henckel von Donnersmarck (Jahrgang 1973), der in Westdeutschland aufgewachsen ist und
sich das Wissen über die Deutsche Demokratische Republik und die Stasi-Methoden durch
eigene Recherche angeeignet hat. Insgesamt hat er von der Idee bis zur Fertigstellung acht
Jahre an dem Film gearbeitet, der zugleich seine Abschlussarbeit an der Hochschule für Film
und Fernsehen in München ist. Das Melodram wurde mit Preisen überhäuft, erhielt vier
bayerische Filmpreise, sieben Deutsche Filmpreise („Lolas“)9 und schließlich im Juli 2006
noch den Friedenspreis des Deutschen Films. Kinostart war der 23. März 2006, im Juli 2006
hatten über 1,3 Millionen Zuschauer den Film gesehen10. In den Hauptrollen sind zu sehen
Ulrich Mühe (Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler), Sebastian Koch (Schriftsteller Georg Dreyman),
Martina Gedeck (Christa-Maria Sieland, dessen Lebensgefährtin), Ulrich Tukur
(Oberstleutnant Grubitz) und Thomas Thieme (Minister Hempf).
1.2. Inhalt
Ost-Berlin, 1984. Der linientreue Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler wird vom Kulturminister
Hempf beauftragt, den Schriftsteller und Dramatiker Georg Dreyman zu überwachen. Ein
Operativer Vorgang (OV) wird eingeleitet, Dreymans Wohnung wird verwanzt und auf dem
Dachboden des Wohnhauses eine Abhörzentrale eingerichtet, in der Wiesler von nun an am
Privatleben von Dreyman, seiner Lebensgefährtin Christa-Maria Sieland und deren Künstler-
Freundeskreis teilnimmt. Nach und nach stellt sich heraus, dass Hempf keine politischen,
sondern private Gründe hat, Dreyman zu überwachen: er hat eine erzwungene Affäre mit der
von ihm begehrten schönen Schauspielerin Christa-Maria, die er dazu benutzt, sie auch
beruflich unter Druck zu setzen. Dreyman, der bisher den Balanceakt des anerkannten
staatstreuen Dramatikers mit kritischem Bewusstsein meistert, wandelt sich nach dem
Selbstmord eines Freundes, des mit Berufsverbot belegten Theaterregisseurs Jerska, zum
Dissidenten und beschließt, für den „Spiegel“ einen Artikel über die hohe Suizidrate in der
9 Die Preisverleihung wird auch auf der Website der deutschen Bundesregierung erwähnt: siehe
http://www.bundesregierung.de/nn_23686/Content/DE/Artikel/2006/05/2006-05-13-deutscher-filmpreis-fuer-dasleben-
der-anderen-.html
10 1,35 Millionen Zuschauer im Juli 2006 (Quelle: International Movie Database, imdb Business Data,
http://german.imdb.com/title/tt0405094/business)
7
DDR zu schreiben. Wiesler gerät in seiner Abhörzentrale angesichts der Wandlungen
Dreymans zusehends in einen Gewissenskonflikt. Durch das Lauschen gewinnt er Einblicke
in eine Lebenswelt, die ihm bisher unbekannt war, und die im Gegensatz zu seiner eigenen
eine Fülle an sozialen Kontakten, Gefühlen, künstlerischen und politischen Ambitionen
beinhaltet. Der gefühlskalte, innerlich verhärtete und berechnende Stasi-Hauptmann nimmt
zunehmend Anteil an den Konflikten des Künstlerpaares und wandelt sich so zum fühlenden
Wesen (Schlüsselszene: Dreyman spielt nach dem Selbstmord seines Freundes auf dem
Klavier die „Sonate vom guten Menschen“, die Wiesler zu Tränen rührt). Wiesler beschließt,
Dreyman zu schützen und fängt an, die Abhörprotokolle zu seinen Gunsten zu fälschen. Er
lässt ein Beweisstück, die Schreibmaschine, auf der Dreyman das Manuskript für den
„Spiegel“-Artikel geschrieben hat, vor einer Durchsuchungsaktion der Stasi verschwinden.
Durch eine weitere Aktion lässt er Dreyman Zeuge der heimlichen Affäre von Christa-Maria
und Hempf werden. Die tablettensüchtige Frau Sieland wird aus fadenscheinigen Gründen
verhaftet (der lange Arm des Ministers Hempf) und kurzerhand zum IM verwandelt. Sie kehrt
in die gemeinsame Wohnung des Paares zurück, wo sie Dreyman, nun im vollen
Bewusstsein des Vertrauens-bruchs, erwartet. Er überspielt jedoch sein Wissen. Beim
Verlassen der Wohnung läuft Christa-Maria vor ein Auto und verunglückt tödlich. Wieslers
Fälschungen fliegen auf, und er wird in die Poststelle strafversetzt, wo er zukünftig Briefe
aufdampfen darf.
Epilog.
Jahre später, nach dem Fall der Mauer. Dreyman sitzt in der Gauck-Behörde und liest seine
Stasi-Akten. Er entdeckt, dass er durch den Stasi-Spitzel mit dem Kürzel HGW XX/7
geschützt wurde, der, um die „Spiegel“-Aktion zu verdecken, eine komplette Geschichte über
die Verfassung eines linientreuen Jubiläums-Theaterstückes erfunden hat. Er entdeckt auch
zu seiner Erschütterung, dass Christa-Maria als IM angeworben wurde, und der Stasi das
Versteck seiner „Spiegel“-Unterlagen und der verdächtigen Schreibmaschine verraten hat.
Wiesler verdient unterdessen seinen mageren Lebensunterhalt durch das Austragen von
Werbeprospekten. Er kommt zufällig an einem Buchladen vorbei und sieht im Schaufenster
das Bild des mittlerweile erfolgreichen Dreymans aus Anlass der Veröffentlichung seines
neuen Buches. Er geht in den Buchladen, um es zu kaufen. Als er die erste Seite aufschlägt,
sieht er folgende Widmung: „HGW XX/7 gewidmet, in Dankbarkeit.“11
11 zum Inhalt vgl. u.a. das Buch zum Film und das Filmheft der Bundeszentrale für politische Bildung
8
2. Verortung – DDR und Stasi als Thema im Post-Wall Cinema 12
Es gibt und gab eine Reihe Filme, die sich kritisch mit der DDR und der Wiedervereinigung
beschäftigten, wie Ralf Schenk in seinem Artikel „Die DDR im deutschen Film nach 1989“
darlegt:13 schon gleich nach dem Mauerfall, 1990 und 1991 setzten sich ehemalige DEFARegisseure
mit dem eben vergangenen Staat auseinander (z.B. „Letztes aus der Da Da eR“
von Jörg Foth, „Das Land hinter dem Regenbogen“ von Herwig Kipping oder „Verfehlung“
von Heiner Carow). Der ehemalige DDR-Schauspieler Michael Gwisdek drehte 1993 mit
„Abschied von Agnes“ eine „Psychostudie über die Totalüberwachung eines Individuums“14.
Später versuchten sich auch West-Regisseure mehr oder weniger erfolgreich an dem Thema
DDR und Stasi, so Margarethe von Trotta („Das Versprechen“, 1995), Helma Sanders-
Brahms („Apfelbäume“, 1992) und Connie Walther („Wie Feuer und Flamme“, 2001). Die
Stasi spielte bei der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit in den Medien und auch in einigen
Filmen eine Art Sündenbock-Rolle, die die Masse der ehemaligen DDR-Bürger von Schuld
freisprach und die Stasi-Protagonisten wurden als brutal und hinterhältig dargestellt.15 Diese
Filme hatten aber keinen kommerziellen Erfolg und blieben einem begrenzten Programmkino-
Publikum vorbehalten, während die wirklich erfolgreichen Filme Kömodien wie „Helden
wie wir“ (1999) waren, die das Thema ironisch-satirisch verarbeiten.
Als mögliche Erklärung hierfür bemerkt Schenk: „Die Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher mit
dem, was sie in und an der Bundesrepublik vorfanden, schlug sich unter anderem in einem
verklärenden Blick zurück, einer vom Wende-Zorn längst abstrahierten, freundlicheren Sicht
auf die DDR nieder. In dieser Situation kam Leander Haußmanns und Thomas Brussigs Film
„Sonnenallee“ gerade recht.“ Aber auch in der Gunst der westdeutschen Zuschauer lagen
Komödien wie „Goodbye Lenin“ (‚Die DDR als Traum, Refugium oder Fake’) bisher vorne.
Warum also ist „Das Leben der Anderen“ der erste ernsthafte DDR-Film, der Zuspruch bei
einem breiten Publikum bekommt? Der Historiker Ulrich Herbert erwidert im Interview auf die
Frage: „Erst „Good Bye, Lenin!“, dann „Das Leben der Anderen“: Läuft Aufarbeitung
eigentlich immer in bestimmten Phasen ab?“: „Nein, es gibt keine feste Rhythmisierung,
auch wenn es nach Diktaturen oft erstmal das Bedürfnis gibt, zu vergessen und die neuen
12 engl. Begriff für das deutsche Nachwende-Kino, so u.a. verwendet in „The German Cinema Book“
13 in: „Film und Gesellschaft“; Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 44/2005 vom 31. Oktober 2005, S. 31-38
14 ebd., S. 36
15 vgl. ebd., S. 35; lt. G. Jeschonnek kamen auf sechzig DDR-Bürger ein hauptberuflicher oder inoffizieller
Mitarbeiter der Staatssicherheit (Deutschland Archiv Nr. 3/2006, S. 503)
9
Verhältnisse zu etablieren. Dann gibt es das Bedürfnis, sich über die früheren Machthaber
lustig zu machen: Hitler-Witze nach ’45 oder Honecker-Witze nach ’89 hatten etwas
Befreiendes. Erst nach einer gewissen Zeit taucht der Schrecken wieder auf. Nehmen wir
den Stasi-Film „Das Leben der Anderen“: Schon vor 15 Jahren gab es Stasi-Debatten, aber
damals wurde das als fast normal, zum Teil gar als nervtötend empfunden. Die zeitliche
Distanz ermöglicht es nun, dass Jüngere ihre Fassungslosigkeit angesichts des bis dahin
historisch unbekannten und unvorstellbaren Maßes der staatlichen Bespitzelung von
Privatleben zum Ausdruck bringen können.“16
Der Historiker, DDR- und Stasi-Experte Stefan Wolle schreibt dazu : „…offenbar hat es ein
Defizit gegeben. „Das Leben der Anderen“ hat einen unsichtbaren Nerv getroffen. Er wirft
Fragen auf, die durch die Wissenschaft nicht zu klären sind. Er zeigt, dass zwischen dem
Alltag in der DDR und dem Stasi-System keine Grenze verlief, sondern dass im Gegenteil
der Überwachungs- und Repressionsapparat tief in das Leben der Menschen eingegriffen
hat. Die Stasi bekommt ihr menschliches Gesicht zurück, das sie in 16 Jahren der
Versachlichung verloren hat.“17 Wolle bezieht sich hier auf die historische Aufarbeitung der
Stasi-Vergangenheit und der SED-Diktatur wie z.B. durch die ‚Stiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur’ oder die Gauck-Behörde. Dazu zählen auch Dokumentarfilme wie „Keine
verlorene Zeit“ von Dörte Franke, Christopher Bauder und Marc Bauder (2000) und „Das
Ministerium für Staatssicherheit – Alltag einer Behörde“ von Jan Lorenzen und Christian
Klemke (2003). Obwohl sich natürlich Fiktion und Dokumentarfilm als verschiedene Genres
nicht miteinander vergleichen lassen, muss sich ein Film wie „Das Leben der Anderen“ nicht
nur in Fragen der Publikumswirkung zu den DDR-Komödien, sondern auch in Fragen der
Authentizität zu Dokumentationen in Bezug setzen, die einen Gegenpol zu den Komödien im
weiten Feld der DDR-Vergangenheitsbewältigung darstellen.
16 „Geteilte Erinnerung“; Interview: Christiane Peitz; Der Tagesspiegel vom 16.05.2006
17 Stefan Wolle: „Stasi mit menschlichem Antlitz“; in: Deutschland Archiv; Zeitschrift für das vereinigte
Deutschland Nr. 3/2006, S. 498
10
3. Kritikerstimmen
3.1. Einleitung
Schon im Vorfeld des Filmstarts, besonders aber nach den Preisverleihungen, ging ein
Sturm der Begeisterung durch die deutschen Feuilletons, der mitunter relativ kritiklos
anmutete. Der Film „versetzt die Filmkritik in Verzückung, lockt das Publikum in hellen
Scharen ins Kino, erhält Preise und beschäftigt nebenbei sogar noch die Klatschspalten der
Zeitungen. Kurzum, ein Kultfilm wurde geboren.“18 „Viele junge Menschen und besonders
auch Westdeutsche haben den Eindruck, jetzt endlich das wahre Herrschaftssystem des
ostdeutschen Kommunismus vorgeführt zu bekommen“.19 Es meldeten sich anschließend
aber auch kritische Stimmen von fachkompetenten Zeitzeugen zu Wort, die Vorwürfe von
Verharmlosung und Geschichtsverfälschung laut werden ließen. So wirft z.B. Günter
Jeschonnek dem Regisseur vor: „Er entmündigt seine Zuschauer und entlässt sie mit einer
historischen Lüge. Ernstzunehmende Filmkritiker und Historiker haben sich vor allem
deshalb nicht den pauschalen Lobeshymnen vieler Feuilletonisten angeschlossen“.20
Zur psychologischen Wirkung des Films schreibt Stefan Wolle: „Der Film ruft jenes
untergründige und oft verdrängte Gefühl der Angst wieder hervor, jenes allgegenwärtige
Gefühl des Misstrauens, das Bewusstsein der Doppelbödigkeit aller menschlichen
Beziehungen. (…) Er zeigt eine Gesellschaft, die bis in die innersten Zirkel der Privatheit
vom Stasi-Gift zersetzt war.“21 Diese Wirkung wurde jedoch für manche fachkundige
Rezipienten durch erhebliche sachliche Fehler im Plot und eine unglaubwürdige Darstellung,
ja, durch eine unglaubwürdige Erzählung insgesamt geschmälert. Im Folgenden werde ich
zunächst die Statements der Befürworter, anschließend die Argumente der Kritiker
auszugsweise zusammenfassen. Die Urteile von Stasi-Opfern und ehemaligen MfSAngehörigen
(wie Wolfgang Schmidt), von DDR- und Stasi-Experten (wie Stefan Wolle,
Günter Jeschonnek, Jens Gieseke) und westdeutschen Feuilletonisten unterscheiden sich
18 Wolle, a.a.O.
19 Rainer Eckert: Grausige Realität oder schönes Märchen? Entfacht „Das Leben der Anderen“ eine neue
Diskussion um die zweite deutsche Diktatur?“ in: Deutschland Archiv; Zeitschrift für das vereinigte Deutschland
Nr. 3/2006, S. 500
20 Günter Jeschonnek: „Die Sehnsucht nach dem unpolitischen Märchen“; Ein kritischer Kommentar zum Stasi-
Film „Das Leben der Anderen“. in: Deutschland Archiv; Zeitschrift für das vereinigte Deutschland Nr. 3/2006,
S. 503
21 Wolle, a.a.O.
11
dabei naturgemäß sehr stark, allerdings nicht immer in eine Richtung, die man vermuten
würde.
3.2. Kritikerstimmen Pro
An positiven Pressestimmen herrschte kein Mangel, von denen ich hier nur einige erwähnen
möchte: vom „bisher besten Nachwende-Film über die DDR“ und einer „Parabel über die
Unmöglichkeit, sich vor den politischen Verhältnissen in einer Nische der Wohlanständigkeit
zu verschanzen“ ist die Rede22, andernorts heißt es: „Der Film (…) vermittelt ein Gefühl für
die DDR, wie man es so noch nicht im Kino erlebt hat, frei von Folklore und Ornamenten.
(…) Florian Henckel von Donnersmarck legt die Mechanik der Macht bloß.“ Er „ist dabei, mit
seinem Film eine Diskussion in Bewegung zu setzen, deren Tragweite er womöglich
unterschätzt hatte.“23
Unter den Kritikern sind besonders jene Zeitzeugen interessant, die aufgrund ihrer Biografie
und beruflichen Kompetenz ein ausgeprägtes Urteilsvermögen in Sachen Deutsche
Demokratische Republik und Staatssicherheit mitbringen.24 Hier möchte ich Joachim Gauck,
Marianne Birthler, Wolf Biermann und Thomas Brussig zitieren.
Joachim Gauck, der ehemalige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes,
war von dem Film emotional sehr ergriffen und verstieg sich zu einem begeisterten
„Ja, so war es!“. Er habe sich in die damalige Zeit zurück versetzt gefühlt, auch wenn es
einen Stasi-Offizier wie Wiesler vermutlich nicht gegeben hat. Aber: „ein Spielfilm ist keine
zeitgeschichtlicher Dokumentation, er kann freier mit Geschichte umgehen.“25
Marianne Birthler, seine Amtsnachfolgerin, kommt zu einem ausgewogenen, positiven Urteil:
„Was die Authentizität des Falls betrifft, in dem ein Stasi-Offizier sich unter hohem eigenen
Risiko auf die Seite seiner Opfer schlägt, seine Vorgesetzten das ahnen, ihn aber trotzdem
gewähren lassen: Einen solchen Fall gab es nach unserer Kenntnis nicht.“26 Aber: „Vielleicht
22 Evelyn Finger: „Die Bekehrung“; DIE ZEIT Nr. 13/06 vom 23.03.2006
23 Frank Junghänel: „Fürsorglicher Beobachter“; in: Berliner Zeitung v. 18./19.3.2006
24 „Drei starke und zugleich fachkompetente Sympathisanten des Films unterstützen diese Botschaft. Sie
scheinen wegen ihrer Biografien über jeden Zweifel erhaben: Die Literaten Wolf Biermann und Thomas Brussig
sowie der ehemalige oberste Stasi-Aufklärer Joachim Gauck finden den Film hervorragend und authentisch.“
(Günter Jeschonnek, a.a.O.)
25 Stern vom 24.3.2006, http://www.stern.de/unterhaltung/film/558074.html
26 „Widerliches Treiben“ – Interview mit Marianne Birthler vom 7.5.2006, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
12
erzählt der Film auch mehr von der Sehnsucht danach. (…) „Das Leben der Anderen“ zeigt
in bedrängender Weise, wie auch in einer eher unblutigen Diktatur wie der späten DDR
Menschen eingeschränkt und des Vertrauens zu ihren Mitmenschen beraubt werden.“27
Auch Wolf Biermann bescheinigt dem Film trotz historischer Ungenauigkeiten einen
authentischen Bezug und lobt die gelungene emotionale Vermittlung des Gewissenskonflikts:
„Die Grundgeschichte in „Das Leben der Anderen“ ist verrückt und wahr und schön – soll
heißen: ganz schön traurig. Der politische Sound ist authentisch, der Plot hat mich bewegt.“
Gewisse, von Freunden bekrittelte „Unschärfen“ hält er für nebensächlich und lobt die
künstlerische Leistung des Films, den gesichtslosen Stasi-Schergen seiner Vergangenheit,
durch die auch er „zersetzt“ werden sollte, in Gestalt von Ulrich Tukur endlich ein Gesicht
verliehen zu haben. Er räumt aber ein, dass sein verstorbener Freund und Stasi-Opfer
Jürgen Fuchs wahrscheinlich anders über den Film geurteilt hätte.28
Regisseur und Schriftsteller Thomas Brussig bezeichnet die Geschichte vom Stasi-Spitzel,
der seine Opfer beschützt, als „Kinolüge“, die vermutlich kaum auffallen wird: „Denn sein
Film ist in den Details so realistisch, dass man wie von selbst glaubt, er beruhe auf
Tatsachen.“ Dennoch: „Er lässt Spielraum für die verbreitete Auffassung, in der DDR hätten
stolze, freie Menschen gelebt, die nur durch die Stasi und die Verbreitung nackter Angst
niedergehalten wurden“, was jedoch eine Illusion sei. Zu seiner eigenen Verteidigung als Co-
Autor des Films „Sonnenallee“ sagt er: „Nicht die DDR-Komödien haben das Bild verzerrt,
sondern das schlichte Nichtvorhandensein solcher Filme wie „Das Leben der Anderen“.29
Der ehemalige DDR-Journalist Martin Sachse identifiziert sich so sehr mit der Geschichte,
dass er den Filmtitel in „Mein eigenes Leben“ ummünzt und ihn zum Anlass nimmt, seine
eigene Leidensgeschichte zu erzählen. Er wurde beim DDR-Fernsehen und den DEFAStudios
mit Berufsverbot belegt, und durch die Stasi-Verfolgung privat und beruflich
„erfolgreich zersetzt“ – allerdings ohne Happy-End. Im Gegensatz zu den obigen Zeitzeugen
sagt er: „Die Geschichte könnte sich so zugetragen haben, hat sie doch viele Analogien zu
Schicksalen verfolgter Intellektueller und Künstler.“ Er wertet den Film als „wichtigen Beitrag,
den politikmüden Menschen in unserem Land die jüngste deutsche Diktatur näher zu
bringen.“30
27 Mishra / Neubauer: „Das gute Leben im Schlechten“; Interview mit M. Birthler, Rheinischer Merkur v. 25.5.2006
28 Wolf Biermann: „Die Gespenster treten aus dem Schatten“. in: „Die Welt“ v. 22.3.2006
29 Thomas Brussig: „Klaviatur des Sadismus“; in: Süddeutsche Zeitung v. 21.3.2006
30 Martin Sachse: „Das Leben der Anderen – Mein eigenes Leben“, Beitrag auf der Website der Medienfabrik
Berlin vom 30.3.2006; http://www.medienfabrik-b.de/beta01/texte/sites/kultur/kultur05.html
13
Welche historische Tragweite das Thema hat und wie ernst der Film genommen wird, zeigt
die mehrfache Erwähnung im Pressespiegel zum Votum der Expertenkommission zur
Schaffung eines Geschichtsverbundes „Aufarbeitung der SED-Diktatur“31, mit der eine neue
Etappe der Vergangenheits-Aufarbeitung eingeleitet werden soll. Auf die Frage: „Wie weit
sind Ost- und Westdeutschland noch voneinander entfernt, wenn es um eine Einschätzung
und Haltung zu den Ereignissen in der ehemaligen DDR geht?“ antwortet Tobias Hollitzer im
Interview mit Telepolis: „Unter diesem Gesichtspunkt sind Filme wie "Das Leben der
Anderen", (…) bei allen Einwänden, die man im Detail oder von Seiten der Wissenschaft
erheben könnte, wichtige Momente staatspolitischer Bildung. Sie bauen eine Brücke von
dem Teil des Landes, der die kommunistische Diktatur hautnah erlebt hat, zu dem Teil, der
sich darunter nichts Genaues vorstellen kann.“32
Dies weist wiederum auf das von Wolle erwähnte Defizit hin, das es offenbar bei der
ernsthaften und dennoch unterhaltsamen und spannenden Vermittlung von menschlichen
Trägodien aus der Deutschen Demokratischen Republik gegeben hat. Nach der wissenschaftlichen
Aufarbeitung und der humoristischen Distanzierung fehlte offensichtlich noch
der emotionale Bezug zu den tausendfach erlittenen Schicksalen und „zersetzten“
Existenzen.33
31 Pressespiegel vom 06.05.2006 – 01.06.2006, als PDF-Dokument unter www.zeitgeschichte-online.de/
zol/portals/_rainbow/documents/pdf/presse_votum.pdf
32 Thorsten Stegemann: „Unterm Schlussstrich kommt der Neuanfang“; Telepolis v. 19.05.2006,
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22698/1.html
33 lt. des Dokumentarfilms „Jeder schweigt von etwas anderem“ gab es schätzungsweise 250.000 politische
Gefangene in der DDR. http://www.bauderfilm.de/jeder_schweigt.html
14
3.3. Kritikerstimmen Contra
Bei den Kritikern, die den Film negativ beurteilen, überwiegen hauptsächlich die Vorwürfe
der sachlich-historischen Fehler, der mangelnden Authentizität oder sogar der
Verharmlosung. Es gibt, so die „Junge Welt“, den Unterschied zwischen den Wissenden und
den Unwissenden,34 also den Zuschauern, die den Stasi-Terror selbst erlebt haben, und
denjenigen, die ihn nur medial vermittelt kennen. Innerhalb der „Wissenden“ muss man
natürlich unterscheiden zwischen den Reaktionen von Stasi-Opfern und denen von
ehemaligen MfS-Mitarbeitern, den „Stasi-Insidern“.35 Als weitere Gruppe sind abermals
kritische Experten vertreten.
Florian von Donnersmarcks Fachberater waren Manfred Wilke (Leiter im Forschungsverbund
SED-Staat an der FU Berlin) und Wolfgang Schmidt (ehemaliger Stasi-Oberstleutnant und
zuletzt Leiter der Auswertungsgruppe der Hauptabteilung XX, die auch für Kultur zuständig
war). Dennoch finden sich im Plot eine Reihe sachlicher Fehler, die die Geschichte
unglaubwürdig machen:
- Hauptmann Wiesler ist im Film Dozent an der Stasi-Hochschule, Leiter des
Operativen Vorgangs und Spitzel in einer Person. In Wirklichkeit waren diese
Funktionen streng getrennt und auf verschiedene Personen verteilt. „Der Kardinalfehler
in Bezug auf die historischen Fakten liegt darin, dass es einen Stasi-Mann, der
gleichzeitig Dozent an der Stasi-Hochschule, persönlicher Überwacher und Leiter der
Verhöre von Verdächtigen war, nicht gab. Tatsächlich praktizierte gerade die Stasi
strenge Arbeitsteilung.“36
- Auch das Abhören und die Abschrift der Bänder (die Abhörprotokolle) wurde von zwei
verschiedenen Personen durchgeführt, so dass ein Betrug unmöglich gewesen wäre:
Abhörbander und Abschrift lagen dem MfS immer gemeinsam vor.37
- Diese Arbeitsteilung bewirkte auch, dass der Überwachte nicht als Mensch, sondern
als „Objekt“ oder Feind wahrgenommen wurde, dass es „eine organisierte Distanz
zwischen Opfer und Täter gab“38, die eine gefühlsmäßige Annäherung wie im Film
34 Jürgen K. Klaus: „In falschen Hälsen“; Junge Welt v. 23.3.2006
35 siehe hierzu das „Insider-Komitee zur Förderung der kritischen Aneignung der Geschichte des MfS“
http://www.mfs-insider.de/
36 Rüdiger Suchsland: „Mundgerecht konsumierbare Vergangenheit“; Telepolis v. 28.3.2006;
ähnlich äußern sich Wolfgang Schmidt und Jens Gieseke.
37 Mario Falcke, Forum der Stasi-Opfer, Beitrag v. 18.4.2006, www.stasiopfer.de
38 Hubertus Knabe, zitiert nach Mario Falcke, Beitrag im Forum der Stasi-Opfer vom 22.5.2006
15
zwischen Wiesler und Dreyman verhindert hätte: „Die Möglichkeit, dass ein
Verfolgter als Mensch unmittelbar auf den für seine Verfolgung verantwortlichen
Stasi-Offizier einwirken konnte, war faktisch nicht vorhanden. Und das war kein
Zufall, sondern System. Es war einer der entscheidensten Wirkungsmechanismen
der Stasi“.39
- Kulturminister Hempf hätte kraft seines Amtes nicht die Anordnung eines Operativen
Vorgangs veranlassen können: „Ein Kulturminister, der mit diesem Amt nicht einmal
Mitglied im DDR-Politbüro war, konnte einem Stasioffizier übrigens auch keine
Befehle erteilen oder seine Karriere beeinflussen. Kein Funktionär konnte auch die
Stasi mal eben so auf einen x-beliebigen DDR-Bürger ansetzen, schon gar nicht aus
derlei persönlichen Motiven.“40
Wolfgang Schmidt bezeichnet einige Darstellungen im Film als „völlig absurd“41 und kommt
damit zu einem teilweise ähnlichen Urteil wie Stefan Wolle:
- die Sexualmoral im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war eher spießig42:„Gerade
im Parteiapparat war die Atmosphäre von kleinbürgerlicher Spießigkeit und nicht von
morbider Sinneslust geprägt.“43 Vor diesem Hintergrund war eine Affäre wie die
zwischen Hempf und Sieland unwahrscheinlich: „Mitarbeiter, die sich auf intime
Beziehungen zu IM’s eingelassen hatte, wurden in aller Regel aus dem MfS entfernt.“
- Auch gab es laut Schmidt und Wolle keine Berufsprostituierten, die Mitarbeitern des
MfS Hausbesuche auf Kosten des Arbeitgebers abstatteten: „…die Behauptung, das
MfS hätte einen kostenlosen Service zur Befriedigung der erotischen Bedürfnisse
einsamer Mitarbeiter unterhalten, ist schlichtweg albern.“44
- die zur „Raumüberwachung“ benötigte Technik sei, wie alles in der DDR,
Mangelware gewesen und nur „in Ausnahmefällen“ eingesetzt worden. Für das
Einleiten eines Operativen Vorgangs hätte es konkrete Verdachtsmomente geben
müssen, keinesfalls sei ein OV aus Eifersuchtsmotiven, wie im Film, denkbar.
- kaum vorstellbar sei, dass Margot Honecker dem Schriftsteller Dreyman Alexander
Solschenizyns Buch „Archipel Gulag“ schenkt.
39 ebd.
40 Suchsland, a.a.O.; ähnlich W. Biermann, a.a.O.
41 Wolfgang Schmidt: „Zum Film ‚Das Leben der Anderen’ – Ein Bericht in eigener Sache“; 21.03.2006,
MfS-Insider-Forum, http://www.mfs-insider.de/Erkl/Zum%20Film.htm
42 ebd.
43 Wolle, a.a.O.
44 Wolle, ebd.
16
- abwegig sei auch, daß einem neuen inoffiziellen Mitarbeiter erklärt wird „Sie sind jetzt
IM!“. Das Kürzel „IM“ (Inoffizieller Mitarbeiter) war eine rein MfS-interne Bezeichnung
und wurde erst 1990 öffentlich bekannt.
- 40 Stunden dauernde Verhöre, so wie sie von Wiesler im Film demonstriert werden,
habe es nicht gegeben, denn „der Achtstundentag galt auch im MfS“.45
Schmidt relativiert allerdings die sachlichen Fehler angesichts der künstlerischen Freiheit
und der Botschaft, die von Donnersmarck vermitteln will. Einwände wie von Jens Gieseke,
dass es so eine Figur wie Wiesler im wirklichen Leben nicht gegeben hat bzw. geben konnte,
(„reale Vorbilder für Wiesler muss man schon sehr gewaltsam an den Haaren
herbeiziehen“46) seien irrelevant, da es sich um eine fiktive Figur handelt, die den
Gewissenskonflikt eines Stasi-Spitzels verdeutlichen soll. „Nun wäre es Schwachsinn, eine
fiktive Handlung am Maßstab der Realität zu messen. Überhöhung von Konflikten oder die
Komprimierung von Eigenschaften in einzelnen Personen sind legitime Mittel künstlerischer
Gestaltung. So lohnt es sich nicht darüber zu polemisieren, ob und inwieweit ein
Kulturminister Weisungsrechte gegenüber MfS-Mitarbeitern besaß, oder wie die damit
angedeutete führende Rolle der SED im MfS konkret umgesetzt wurde“47. Ein Mitglied aus
dem Forum der Stasi-Opfer stellt fest, dass die Erzählung des Plots durch die historischen
Ungenauigkeiten erst möglich wird.48
Ein weiterer Kritikpunkt ist die persönliche Motivation von Minister Hempf, Dreyman
überwachen zu lassen: damit wird ein eigentlich politisches Thema entschärft, denn „er (von
Donnersmarck) rechnet die Ideologie einfach auf das Private herunter.“49 Aus einem Politwird
ein Eifersuchts-Drama, das erst später durch Dreymans Wandlung zum Dissidenten
einen politischen Anstrich bekommt. „Das ist das eigentlich Kuriose an diesem Film: Die
Überwachung, von der er erzählt, und mit dem er die wahre Natur des Überwachungsstaats
bloßlegen will, ist rein persönlich durch Eifersucht motiviert und gar keine politische.“50 Diese
Schwäche im dramaturgischen Gerüst erscheint umso unverständlicher, als es reale
Vorlagen zuhauf gibt, in denen Künstler aus politischen Gründen abgehört wurden. „Die hoch
45 „Der Achtstundentag galt auch im MfS“; Interview mit Wolfgang Schmidt, Junge Welt v. 1.4.2006;
allerdings ist zu bedenken, dass es sich hierbei nicht um eine neutrale Sichtweise handelt.
46 Jens Gieseke: „Der traurige Blick des Hauptmanns Wiesler“. Zeitgeschichte online, April 2006.
http://www.zeitgeschichte-online.de/zol/portals/_rainbow/documents/pdf/gieseke_lbda.pdf
47 Schmidt, a.a.O.
48 Beitrag von Dr. Dietrich Koch vom 22.05.2006, www.stasiopfer.de
49 Anke Westphal: „Unsere liebe Stasi“; Berliner Zeitung v. 22.3.2006
50 Suchsland, a.a.O.
17
dramatischen und schmerzhaften Geschichten der deutsch-deutschen Vergangenheit liegen
quasi auf der Straße. Man muss sie nicht in mehrjähriger Recherchearbeit gegen die Fakten
erfinden wollen wie von Donnersmarck.“51 Warum also hat von Donnersmarck nicht eine
reale Begebenheit verfilmt?
Peter Körte bezeichnet den Film in der FAZ als Konsensfilm: „So sieht der Konsensfilm aus,
den sich die Branche bestellen müsste, wenn er nicht schon da wäre. (…) Er tut niemandem
weh, er organisiert Einverständnis, indem er noch im Scheitern (…) einen Sinn findet.“52
Im Wandel des bösen Stasi-Spitzels zum Gutmenschen und dem versöhnlichen Ende des
Films - Dreyman ist auch im Westen erfolgreich, während Wiesler sein Leben als
Zeitungsausträger fristen muss, jedoch durch Dreymans Widmung getröstet wird – sehen
einige Kritiker ein „Entlastungsbedürfnis“ als mögliches Motiv der Vergangenheitsbewältigung.
"Dass von Donnersmarck (…) gerade diese Figur erfunden hat, kann für Knabe bei
aller ernsthafter aufklärerischer Absicht nur einen Grund haben: ‚Die Suche nach
Entlastung.’ “53 Rüdiger Suchsland fragt: „Henckel von Donnersmarck erfindet sich den guten
Stasi-Menschen - und man möchte schon wissen, woher das Entlastungsbedürfnis eigentlich
kommt, das sich in solchen Szenarien befriedigt?“54
Noch weiter geht Jan Schulz-Ojala, der im „Tagesspiegel“ die These aufstellt, dass der Film
in eine Reihe zu stellen sei mit den Filmen „Der Untergang“ und „Der freie Wille“, die
allesamt Täter zu Opfern stilisieren, indem sie die menschliche, die menschelnde Seite des
Bösen entdecken. Schulz-Ojala diagnostiziert dies als Teil eines allgemeinen
gesellschaftlichen Trends, in dem sich die Betonung in der medialen Darstellung der
Deutschen vom einstigen Tätervolk zur Darstellung eines Volks von Opfern verschoben
hat.55
Günter Jeschonnek spricht angesichts des überschwenglichen Lobs der Kritiker und der
verharmlosenden Filmerzählung von einem „Faustschlag ins Gesicht“ der Stasi-Opfer. Als
Beispiel nennt er die Strafmaßnahme, die gegen Hauptmann Wiesler angeordnet wird,
nachdem seine gefälschten Abhörprotokolle auffliegen (er wird in die Postkontrolle versetzt,
51 Jeschonnek, a.a.O.
52 Peter Körte: „Der Unberührende. ‚Das Leben der Anderen’ ist der ideale Konsensfilm“,
in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 19.03.2006, S. 27
53 Sonja Boerdner: „Macht und Ohnmacht“; Märkische Allgemeine Zeitung v. 22.3.2006;
gemeint ist Hubertus Knabe.
54 Suchsland, a.a.O.
55 Jan Schulz-Ojala: „Die Täterversteher“; Der Tagesspiegel v. 22.3.2006
18
um Briefe aufzudampfen) – und setzt dem ein berüchtigtes Zitat von Stasi-Chef Erich Mielke
entgegen, in dem dieser jedem Abtrünnigen die Todesstrafe androht: „ …hinrichten, wenn
notwendig auch ohne Gerichtsurteil.“56 Ein Verrat der Staatssicherheit wurde mit Todesstrafe
geahndet, und nicht mit derlei harmlosen Sanktionsmaßnahmen wie im Film57.
4. Die aktuelle Stasi-Debatte und die Reaktion der Opfer
Hier lässt sich ein Zusammenhang herstellen zum aktuellen Stand der DDR-Vergangenheitsaufarbeitung
und dem Verhalten ehemaliger Stasi-Offiziere, die sich durch ihr Auftreten in
der Gedenkstätte Hohenschönhausen diskreditiert haben: anlässlich einer Podiumsdiskussion
zur Aufstellung eines Gedenksteins am 14.3.2006 kam es zum Eklat, als 200
ehemalige MfS-Offiziere erschienen, von denen einige das Wort ergriffen, sich gegen die
Gedenkstätte und die Formulierung „kommunistische Diktatur“ wandten und jede Schuld
abstritten. „Der langjährige Gefängnischef schimpfte über die Museumsführer, die
größtenteils früher selbst bei ihm in Haft waren: „Sie stellen sich als Opfer dar und
deklarieren uns zu Tätern.““58 Der Eklat hat zu Rücktrittsforderungen gegenüber
Kultursenator Flierl (PDS) geführt, der sich nicht deutlich von den Provokationen distanzierte.
Dazu Günter Jeschonnek: „Bis heute hat sich nicht ein einziger Stasi-Offizier mit seiner
Arbeit und Schuld kritisch und öffentlich auseinandergesetzt – im Gegenteil: In Berlin traten
in diesen Tagen die einstigen Amtsträger der Stasi selbstbewusst auf unf verkündeten
schamlos die Rechtmäßigkeit ihres Tuns.“59 Am selben Tag fand übrigens auch die
Vorführung von „Das Leben der Anderen“ für Mitglieder des Deutschen Bundestags statt60.
Der Filmstart und der Eklat von Hohenschönhausen haben sich so in ihrer Wirkung als
Anstoß zu einer neuen Stasi-Debatte verstärkt.61
56 s. Jeschonnek, a.a.O., S. 502; ein historischer Fall ist der 1981 zum Tode verurteilte und unter Geheimhaltung
durch Genickschuss hingerichtete Stasi-Offizier Werner Teske.
57 Knabe, Leipziger Volkszeitung v. 06.04.2006
58 vgl. den Gastkommentar von Hubertus Knabe: „Die Diffamierung des Gedenkens“; Stiftung Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen, http://www.stiftung-hsh.de/ und Jürgen Schreiber: „Die Schatten werden wieder
länger“, Tagesspiegel v. 13.4.2006; Es ging um die Einweihung eines Gedenksteins mit der Aufschrift „Den
Opfern kommunistischer Gewaltherrschaft 1945 - 1989“.
59 Jeschonnek, a.a.O., S. 502
60 „Kinopremiere für den deutschen Bundestag“, Regierung Online, Meldung v. 14.3.2006,
www.bundesregierung.de/nn_25226/Content/DE/Artikel/2006/03/2006-03-14-kinopremiere-fuer-den-deutschenbundestag.
html
61 vgl. Christina Tillmann: „Das andere Leben“. Über die neue Stasi-Debatte. Tagesspiegel v. 21.3.2006 und
Claus Löser: „Wenn Spitzel zu sehr lieben“, taz v. 22.3.2006
19
In dieser gereizten, aufgeladenen Atmosphäre fallen dann auch die Reaktionen von
Opferverbänden auf den Film dementsprechend aus: In einer Pressemitteilung im Vorfeld
der Verleihung des Deutschen Filmpreises erklärt die „Vereinigung der Opfer des
Stalinismus“ (VOS), dass der Film eine solche Würdigung nicht verdient hätte, weil von ihm
ein „falsches Signal“ ausgehe: „Dem unbedarften Kinobesucher, also der großen Masse
schlechthin wird hier suggeriert, dass die Stasi-Verbrecher im Grunde doch bedauernswerte
Leute sind, die nach 1990 ihre Existenz verloren haben und nun zum Sozialfall geworden
sind. Und sie waren ja auch Menschen wie wir, was man an dem Sinneswandel eines Stasi-
Hauptmannes ersehen kann.“62 Die VOS wertet dieses Signal als eine Demütigung und
Beleidigung der Opfer und schlägt damit in dieselbe Kerbe wie Stasi-Opfer M. Falcke, der in
einem Kommentar auf der Website der „Zeit“ zum Filmboykott aufruft: „In einer Mischung aus
dokumentativer Kamera und eher literaturtypischer Sprache, gaukelt der Autor/Regisseur
dem Publikum eine Stasi vor die es so nie gab.“ Zu der Aufzählung der sachlichen Fehler
sagt er: „Was für den einen oder anderen als Erbsenzählerei anmuten dürfte ist für
Menschen, die bis zum Erbrechen durch derartige konspirative Methoden geschädigt
wurden, keine Lappalie.“63
Hubertus Knabe, Leiter der Gedenkstätte für Stasi-Opfer im ehemaligen MfS-Gefängnis
Hohenschönhausen, verweigerte von Donnersmarck die Drehgenehmigung mit der
Begründung, dass der Film die „Heroisierung eines Stasi-Mannes“64 betreiben würde. „Die
Opfervertreter haben das (die Drehgenehmigung, Anm. d. Verf.) kategorisch abgelehnt, weil
ihre Erfahrung mit der Staatssicherheit diametral anders war”, so Knabe. Man könne „einen
Ort, in dem Menschen gelitten haben und den sie vielleicht im Kino wiedererkennen, nicht als
Kulisse für einen Film missbrauchen, der so lässig mit dieser Vergangenheit umgeht.”65
62 Pressemitteilung der Vereinigung der Opfer des Stalinismus vom 9.5.2006,
http://www.medienfabrik-b.de/beta01/texte/sites/kultur/kultur05.html
63 M. Fal style="line-height:150%;">Evelyn Finger, 03.04.2006; http://zeus.zeit.de/comments/2006/13/Leben_der_anderen?comment_id=13996
&base=/2006/13/Leben_der_anderen
64 Wolfgang Schmidt, 21.3.2006; http://www.mfs-insider.de/Erkl/Zum%20Film.htm
65 Leipziger Volkszeitung vom 06.04.2006 – zitiert nach Saskia Weneit: „Kritik an „Das Leben der Anderen“,
http://www.meinberlin.de/nachrichten_und_aktuelles/26603.html
20
5. Kleiner Nachtrag zum Hintergrund: Die Stasi-Vergangenheit der Jenny Gröllmann
Es gibt eine beklemmende Parallele des Films zur Biografie des Hauptdarstellers Ulrich
Mühe: Jahre nach dem Fall der Mauer fand er heraus, dass seine frühere Frau Jenny
Gröllmann als „IM“ für die Stasi gearbeitet hatte. In einem Interview, das im Buch zum Film
veröffentlicht wurde, spricht er darüber und über seine Erfahrungen beim Lesen der eigenen
Stasi-Akten.66 Frau Gröllmann hat daraufhin im April 2006 eine einstweilige Verfügung beim
Landgericht Berlin erwirkt, wonach das Buch nur noch mit geschwärzten Textpassagen
vertrieben werden darf.67 Sie streitet eine Mitarbeit für das MfS bis heute ab, obwohl laut
Marianne Birthler der Fall nach Aktenlage völlig unstrittig ist.68 Ihre Biografie ähnelt „fatal
Donnersmarcks Film, dem sie eine besondere Authentizität zu verleihen scheint“69 und auf
den sie nun einen wahrscheinlich unbeabsichtigten, aber willkommenen Werbeeffekt ausübt.
Die Geschichte des ehemaligen DDR-Schauspieler-Traumpaars Mühe/Gröllmann liest sich
dabei wie eine Vorlage zum Filmstoff und wird sich in der Wahrnehmung der Zuschauer mit
der fiktiven Figur der Christa-Maria Sieland verbinden.70
66 „Es hat ja schon viele Versuche gegeben, die DDR-Realität einzufangen“. F.H. v. Donnersmarck und Christoph
Hochhäusler im Gespräch mit Ulrich Mühe. In: F.H. v. Donnersmarck, Das Leben der Anderen. S. 182-204
67 vgl. Markus Deggerich: „Gericht stoppt Suhrkamp-Buch“; Spiegel Online Meldung v. 13.4.2006
68 Interview im „Rheinischen Merkur“ vom 25.5.2006, s.o.
69 Daniel Kothenschulte: „Die Sünden der Anderen“; Frankfurter Rundschau v. 19.4.2006; Pressedossier
Zeitgeschichte Online
70 Frank Pergande: „Sie waren einmal ein Traumpaar“; Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 29.4.2006; vgl.
Kothenschulte, ebd.
21
6. Fazit und Ausblick
Zusammenfassend möchte ich noch einmal die Kritiker zu Wort kommen lassen und ihre
Antworten auf die Fragen nach gelungener oder misslungener Vergangenheitsbewältigung,
der zugesprochenen Deutungshoheit und den Anspruch auf angemessenen Umgang mit
Geschichte durch den Film. Die zahlreichen Kritikpunkte lassen den Schluss zu, dass es sich
bei „Das Leben der Anderen“ entsprechend seinem Schöpfer doch um ein Werk mit einem
westdeutschen Blick auf ein fiktives Einzelschicksal in der Geschichte der DDR handelt. „Der
Film ist künstlerisch ein Meisterwerk, historisch ein Märchen“, so fasst Rainer Eckert die
entgegengesetzten Pole der Kritik zusammen. Wolfgang Schmidt fragt: „Ist diesem Film
tatsächlich der Durchbruch zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Geschichte der
DDR gelungen?“ und als offene Antwort darauf könnte man die Aussage von Jens Gieseke
anfügen: „Doch ob sie (Filme wie Sophie Scholl, Der Untergang, Das Leben der Anderen)
die öffentliche Reflexion über Geschichte wirklich befördern, ist noch nicht entschieden. Die
Authenzität des nahen Blicks ist nur scheinbar und hinterlässt ein historisches Bewusstsein,
das durch die Eindringlichkeit der Bilder kontaminiert ist.“71
Zur Frage der Deutungshoheit gibt es so kontroverse Meinungen wie die von Schmidt: „Eine
angemaßte Deutungshoheit mündet zwangsläufig in Entmündigung eines Teils der
Gesellschaft“72, womit er die bevorzugte Sichtweise aus der Position der Opfer meint.
Dagegen konstatiert das NPD-Blatt „Deutsche Stimme“: „Vor allem das Publikum ist
dankbar, daß mit diesem Film die vielleicht entscheidende politische Schlacht im Kampf um
die Deutungshoheit über die DDR geschlagen ist.“73 – entschieden im Sinne der nationalen
Rechtsaußen, weil die DDR in dem Film als nicht lebenswertes Land und damit auch nicht
als erstrebenswertes Gesellschaftsmodell erscheint.
Zum Umgang mit Geschichte meint Anke Westphal, Berliner Zeitung: „Denn längst wird die
DDR-Geschichte als ein einziges großes Materiallager begriffen, aus dem sich jeder bedient,
so gut es sich eben auszahlt.“ Aber: „ob es einem nun passt oder nicht: Auch dieser Umgang
mit Geschichte ist Ausdruck einer Demokratie.“74 – soweit die Anerkennung künstlerischer
Freiheit und Ausdrucksformen. Rüdiger Suchsland bescheinigt dem Film einen Umgang mit
Historie, der nichts zur kritischen Reflexion der Gegenwart beiträgt: „Während die
71 Gieseke, a.a.O.
72 Interview mit Robert Allertz, Junge Welt v. 1.4.2006
73 Rita Hoffmann: „Keine Sonate vom schlechten Menschen“; Deutsche Stimme, Mai 2006; http://www.deutschestimme.
de/Ausgaben2006/Sites/05-06-Film.html
74 Anke Westphal: „Unsere liebe Stasi“; Berliner Zeitung vom 22.3.2006
22
Vergangenheit für die Gegenwart völlige Verfügungsmasse ist, darf die Vergangenheit die
Gegenwart nicht in Frage stellen, darf die DDR keinesfalls wieder zur „Alternative“ werden.“75
Soll heißen: „Das Leben der Anderen“ hinterläßt den Zuschauer mit dem Gefühl: „das mit der
bösen Stasi ist ja jetzt zum Glück vorbei“, ohne die Perspektive auf eine Kritik der
gegenwärtigen Verhältnisse in der Bundesrepublik zur eröffnen (z.B. die jüngsten Skandale
des Bundesnachrichtendienstes oder die Überwachung von Politikern wie Oskar Lafontaine
durch den Verfassungsschutz). Denn, so Suchsland: „Ein Film über die Überwachung könnte
uns etwas über die Verhältnisse, in denen wir leben, erzählen, in denen im „Kampf um die
innere Sicherheit“ die Freiheit des Bürgers ausgehöhlt wird.“
Als Ausblick auf zukünftige Filme möchte ich noch ein Zitat von Ralf Schenk anbringen: „Es
bleibt zu wünschen, dass es ihnen (den zukünftigen Filmen über die DDR) gelingt,
differenziert und gerecht über Menschen zu erzählen, die in Aufstieg, Stabilisierung und
Verfall jenes Halb-Landes integriert waren (…). Filmische Abbilder der DDR, die weniger auf
Äußerlichkeiten und Klischees zurückgreifen, sondern innere Prozesse des Landes und
seiner Bewohner subtil rekonstruieren, haben weiterhin Seltenheitswert.“76
75 Suchsland, a.a.O.
76 Schenk, a.a.O.; Der Text wurde nach der Fertigstellung, aber noch vor dem Filmstart von „Das Leben der
Anderen“ verfasst.
23
Literatur- und Quellennachweis
Tim Bergfelder, Erica Carter, Deniz Göktürk (Hrsg.): The German Cinema Book. The British
Film Institute Publishing, London 2002
Florian Henckel von Donnersmarck: Das Leben der anderen; Filmbuch; Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 2006
Filmheft „Das Leben der Anderen“; Hrsg. Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Bonn,
März 2006; erhältlich als PDF-Dokument unter http://www.bpb.de/files/NSUEAK.pdf
Jens Gieseke: Der traurige Blick des Hauptmanns Wiesler. Ein Kommentar zum Stasi-Film
„Das Leben der Anderen“, in: Zeitgeschichte-online. Zeitgeschichte im Film, April 2006,
http://www.zeitgeschichte-online.de/zol/portals/_rainbow/documents/pdf/gieseke_lbda.pdf
Pressestimmen zum Kinofilm „Das Leben der Anderen“
Pressedossier, zusammengestellt von der Redaktion „Zeitgeschichte-Online“,
Stand 21.4.2006; aktualisierte Fassung als PDF unter http://www.zeitgeschichteonline.
de/portals/_rainbow/documents/pdf/presse_leben_der_anderen.pdf
Ralf Schenk: Die DDR im deutschen Film nach 1989; in: „Film und Gesellschaft“.
Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 44/ 2005 vom 31. Oktober 2005, S. 31 – 38; Hrsg.
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn (Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“)
Stefan Wolle: Stasi mit menschlichem Antlitz;
Günter Jeschonnek: Die Sehnsucht nach dem unpolitischen Märchen;
Rainer Eckert: Grausige Realität oder schönes Märchen?
in: Deutschland Archiv; Zeitschrift für das vereinigte Deutschland Nr. 3/2006;
Hrsg. W. Bertelsmann Verlag im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn;
Inhaltsverzeichnis und Begleittext unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/
id=257&count=1&recno=1&ausgabe=2784
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Hausarbeit über den Film "Das Leben der Anderen"?
Diese Hausarbeit analysiert die Rezeptionswirkung und Beurteilung des Films "Das Leben der Anderen" in Deutschland anhand von Rezensionen, beschäftigt sich mit dem gesellschaftspolitischen Kontext der Filmerzählung und beleuchtet Schwächen des Filmplots. Sie untersucht kulturelle Bezüge und beinhaltet Elemente von Medienanalyse und Medienästhetik.
Welche anderen DDR-Filme werden in der Einleitung erwähnt?
Die Einleitung erwähnt "Sonnenallee", "Helden wie wir" und "Goodbye Lenin" als erfolgreiche deutsche Filme, die in der DDR oder deren Endphase spielen, im Gegensatz zu "Das Leben der Anderen", der die grausamere Seite des DDR-Regimes thematisiert.
Was sind die Rahmendaten des Films "Das Leben der Anderen"?
"Das Leben der Anderen" ist der Debütfilm von Florian Henckel von Donnersmarck, der Regie führte und das Drehbuch schrieb. Der Kinostart war am 23. März 2006, und der Film erhielt zahlreiche Preise, darunter bayerische Filmpreise, Deutsche Filmpreise und den Friedenspreis des Deutschen Films.
Was ist der Inhalt des Films?
Der Film spielt 1984 in Ost-Berlin. Der Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler wird beauftragt, den Schriftsteller Georg Dreyman zu überwachen. Im Laufe der Überwachung entwickelt Wiesler einen Gewissenskonflikt und beginnt, Dreyman zu schützen. Jahre später entdeckt Dreyman nach dem Fall der Mauer, dass Wiesler ihn geschützt hat.
Wie wird der Film im Kontext des "Post-Wall Cinema" verortet?
Der Film wird als ein Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung durch Unterhaltungskino gesehen. Er wird in den Kontext anderer Nachwende-Filme über die DDR eingeordnet und diskutiert, warum er im Vergleich zu anderen Filmen, insbesondere Komödien, ein breiteres Publikum erreicht hat.
Welche Argumente werden von Kritikern genannt, die den Film positiv bewerten?
Positive Kritikerstimmen loben den Film als den bisher besten Nachwende-Film über die DDR, der ein Gefühl für die DDR vermittelt, wie man es im Kino noch nicht erlebt hat. Sie betonen, dass der Film die Mechanik der Macht offenlegt und eine wichtige Diskussion in Bewegung setzt.
Welche Kritikpunkte werden von Kritikern geäußert, die den Film negativ bewerten?
Negative Kritikerstimmen bemängeln sachlich-historische Fehler im Plot, mangelnde Authentizität und eine Verharmlosung des Stasi-Terrors. Sie kritisieren die Darstellung der Stasi-Mitarbeiter als zu gutmütig und die persönliche Motivation des Ministers als unglaubwürdig.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Film und der aktuellen Stasi-Debatte?
Der Filmstart und der Eklat in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, bei dem ehemalige MfS-Offiziere auftraten und jede Schuld abstritten, haben sich gegenseitig verstärkt und zu einer neuen Stasi-Debatte geführt.
Wie reagieren Opferverbände auf den Film?
Opferverbände kritisieren den Film, da er ihrer Meinung nach ein falsches Signal aussendet und suggeriert, dass Stasi-Verbrecher im Grunde bedauernswerte Leute sind. Sie sehen darin eine Demütigung und Beleidigung der Opfer.
Welche Parallele gibt es zwischen dem Film und dem Privatleben des Hauptdarstellers Ulrich Mühe?
Ulrich Mühe fand Jahre nach dem Fall der Mauer heraus, dass seine frühere Frau, Jenny Gröllmann, als "IM" für die Stasi gearbeitet hatte. Diese beklemmende Parallele zur Thematik des Films verleiht dem Film in der öffentlichen Wahrnehmung eine besondere Authentizität.
Welches Fazit zieht die Hausarbeit über den Film?
Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss, dass "Das Leben der Anderen" trotz seiner künstlerischen Stärken historisch gesehen ein Märchen mit einem westdeutschen Blick auf ein fiktives Einzelschicksal in der DDR-Geschichte ist. Ob der Film tatsächlich zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR beiträgt, bleibt fraglich.
- Arbeit zitieren
- M.A. Bettina Goebel (Autor:in), 2006, Die öffentliche Wahrnehmung des Films "Das Leben der Anderen", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/110672