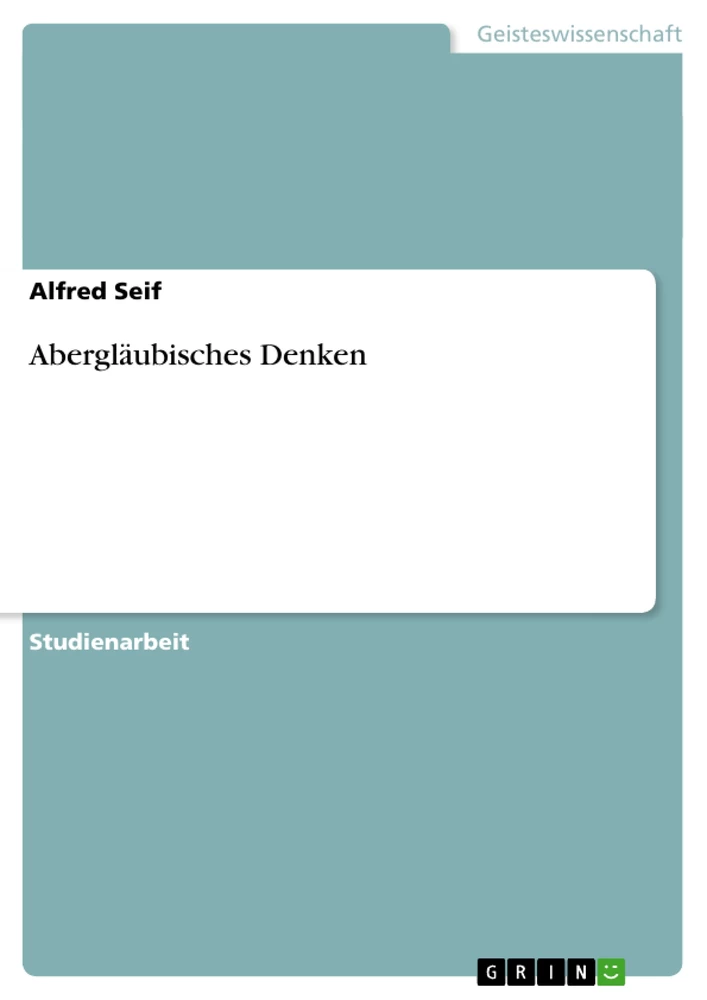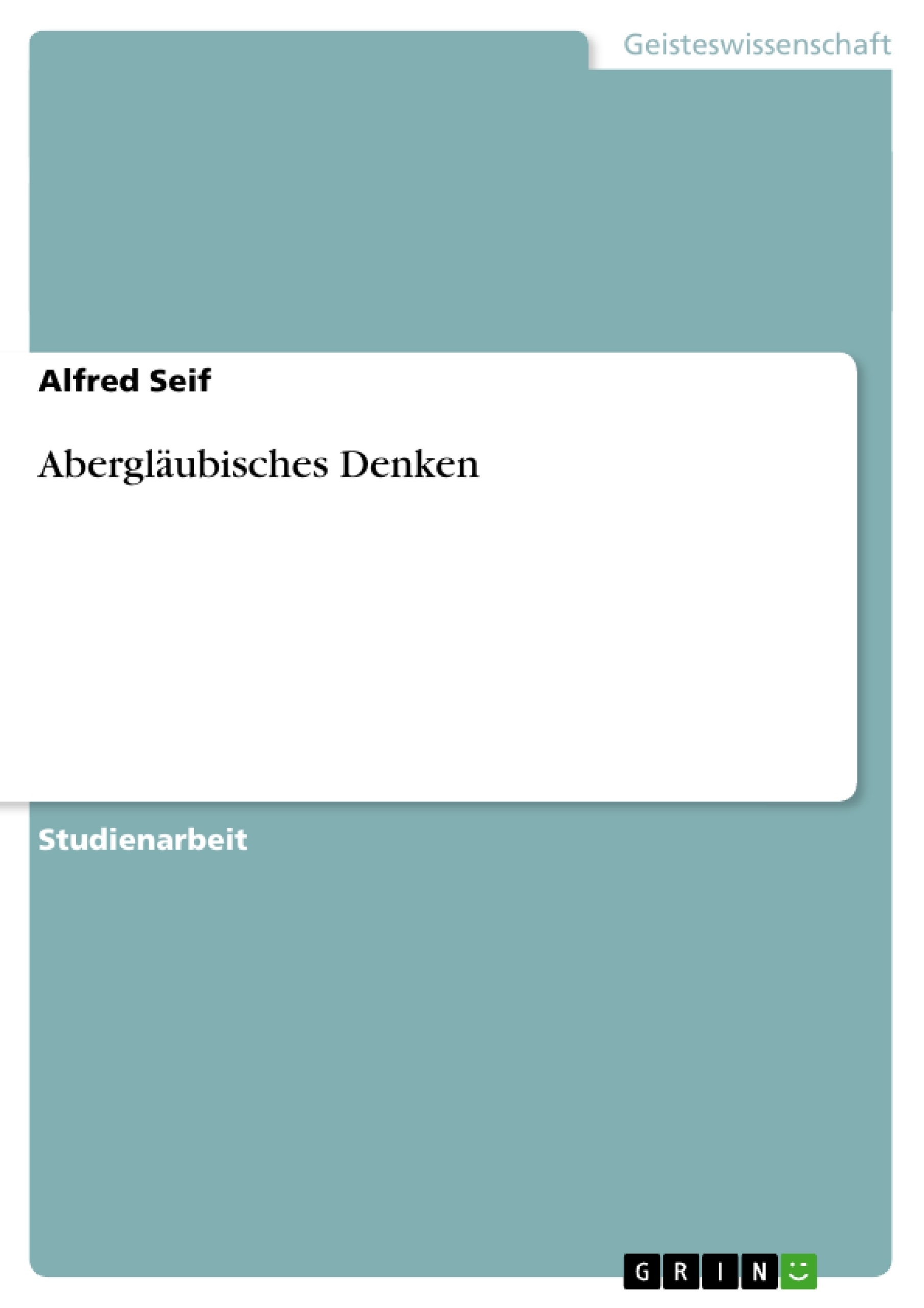Haben Sie jemals einem schwarzen Kater aus dem Weg gehen, dreimal auf Holz klopfen oder ein vierblättriges Kleeblatt gehütet? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Aberglaubens, ein tief verwurzeltes Phänomen, das seit Jahrhunderten menschliches Verhalten und Denken prägt. Dieses Buch enthüllt die psychologischen Mechanismen, die unserem Glauben an Glücksbringer, Unglückszahlen und verborgene Kräfte zugrunde liegen. Es analysiert, wie Kontrollüberzeugungen, Persönlichkeitsmerkmale und kognitive Verzerrungen uns anfällig für abergläubische Vorstellungen machen. Entdecken Sie, wie wir zufälligen Ereignissen eine Bedeutung beimessen, Scheinkorrelationen erkennen, wo keine sind, und wie der Placebo-Effekt unsere Wahrnehmung beeinflusst. Erforschen Sie die Rolle von Heuristiken, Scheinkontrolle und dem Barnum-Effekt bei der Aufrechterhaltung abergläubischer Überzeugungen, selbst angesichts widersprüchlicher Beweise. Lernen Sie, wie logische Denkfehler und unsere geistige Verfassung unser irrationales Verhalten verstärken. Dieses Buch bietet eine tiefgründige Analyse der Psychologie des Aberglaubens, beleuchtet seine Ursprünge, seine Auswirkungen auf unser Leben und wie wir uns von seinen Fesseln befreien können. Es ist eine fesselnde Lektüre für alle, die verstehen wollen, warum wir an Dinge glauben, die sich der rationalen Erklärung entziehen – ein unverzichtbares Werk für Skeptiker, Wissenschaftler und jeden, der die menschliche Natur ergründen möchte. Ergründen Sie die geheimnisvollen Pfade des menschlichen Geistes und entschlüsseln Sie die irrationalen Überzeugungen, die unsere Welt prägen. Erfahren Sie mehr über kognitive Dissonanz, Wahrscheinlichkeitsfehler und die Macht des Zufalls, während Sie die verborgenen Triebkräfte hinter unserem Aberglauben aufdecken. Lassen Sie sich von diesem aufschlussreichen Werk in die faszinierende Welt der menschlichen Psyche entführen und entdecken Sie die überraschenden Mechanismen, die unser Denken und Handeln beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist Aberglaube ?
2. Aberglaube und Kontrollüberzeugung
3. Aberglaube und Persönlichkeitsmerkmale
4. Aberglaube und die Mathematik der Kognition
5. Aberglaube und die psychologische Macht des Zufalls
6. Aberglaube und Scheinkorrelationen
7. Aberglaube und sein Fortbestehen
8. Aberglauben und Heuristik
9. Aberglaube und Scheinkontrolle
10. Aberglaube und Barnum-Effekt
11. Aberglaube und Placeboeffekt
12. Aberglaube und logische Denkfehler
13. Aberglaube und geistige Verfassung
1. Was ist Aberglaube ?
Es gibt eine Reihe von Definitionen des Begriffes „Aberglauben“. Das Random House Dictionary of the English Language definiert ihn als eine „nicht auf Vernunft oder Wissen beruhende Überzeugung oder Vorstellung, bestimmte Dinge, Umstände oder Ereignisse, Verfahrensweisen u.ä. besäßen eine bedrohliche Bedeutung.“ Um die Definition nicht allein auf eine Bedrohung zu beschränken, eignet sich wohl folgende 1956 in der Encyclopedia Britannica formulierte Definition des Psychiaters Judd Marmor besser: „Glaubenssätze oder Praktiken, die eigentlich unbegründet sind und nicht dem Kenntnisstand entsprechen, den die Gesellschaft, zu der man gehört, erreicht hat.“
Natürlich sind Unsicherheit, Bedrohung oder sogar Angst eine unabdingbare Voraussetzung für die Entstehung von Aberglauben. Dennoch ist beispielsweise der Aberglauben von Spielern ( im Glücksspiel oder Sport) besser mit Hoffnung auf Gewinn als mit Furcht vor der Niederlage zu deuten , geht doch ein Spieler, der wirklich Angst vor der Niederlage hat, dem Spiel vermutlich ganz aus dem Weg. Einige abergläubische Überzeugungen, wie die Angst, unter einer Leiter durch zu laufen, sind jedoch tatsächlich von der Furcht motiviert, negative Folgen zu vermeiden.
Von Angst bedingten abergläubische Reaktionen und konservativen Einstellungen kann man vermuten, dass sie ihren Ursprung in einer allgemeinen Abneigung des Menschen gegen Unsicherheiten jeglicher Art haben. Die grundlegendste aller Ängste ist wohl die Angst vor dem Tod. Und man könnte somit in dieser besonderen Form der Angst auch die Grundlage für das starre Festhalten an religiösen Dogmen oder nach Jerome Tobacyk (Tobacyk 1984, S. 31) auch den Hintergrund für das Glauben an Übersinnliches sehen.
2. Aberglaube und Kontrollüberzeugung
Manche Menschen gehen in dem Glauben durchs Leben, sie seien den Geschehnissen hilflos ausgeliefert und sehen bei guten und schlechten Ereignissen sich selbst nicht als Subjekt, sondern als Objekt (externale Kontrollüberzeugung). Andere wiederum glauben, sie könnten ihr Schicksal selbst gestalten und übernehmen für Erfolg und Misserfolg Verantwortung (internale Kontrollüberzeugung).
Durch diese Beziehungen zwischen den Kontrollüberzeugungen und der Anfälligkeit für Beeinflussung von außen könnte man durchaus folgern, ein abergläubischer Mensch sei jemand mit einer externalen Kontrollüberzeugung, jemand, der die Ereignisse in seinem Leben geheimnisvollen, nicht kontrollierbaren Kräften zuschreibt. Einen Beweis dafür liefert eine Studie von Tobacyk und Milford aus dem Jahre 1983 zur paranormalen Auffassung (Psi-fähigkeit, Hexerei, abergläubische Vorstellungen, Hellsehen, Spiritismus) von Studenten der Lousiana Tech University. Die beiden Forscher ermittelten dabei die Kontrollüberzeugung der Studenten und entdeckten dabei, dass die Studenten, bei denen die Kontrollüberzeugung eher external war, stärker an übersinnliche Phänomene glaubten als die anderen Studenten.
3. Aberglaube und Persönlichkeitsmerkmale
Die Entdeckung eines Zusammenhangs zwischen Aberglauben und neurotischem Verhalten (Epstein untersuchte 1991 mit verschiedenen Messtechniken Persönlichkeit, Gefühle und abergläubisches Denken und entdeckte dabei eine Reihe zusätzlicher Wesenszüge abergläubischer Menschen; s. Epstein 1991) lässt darauf schließen, dass diejenigen, die einem typischen Aberglauben anhängen, Anzeichen persönlicher Instabilität zeigen. Die übrigen mit Aberglauben verbundenen Persönlichkeitsmerkmale waren ähnlich negativ (Depression, Angst, geringes Selbstwertgefühl, mangelnde Ich-Stärke).
Insgesamt zeichnen Epsteins Forschungen das Bild eines abergläubischen Menschen, der im Vergleich zu seinen rationaleren Mitbürgern passiver, isolierter, ängstlicher und psychisch instabiler ist. Epstein sieht den Aberglauben als etwas, zu dem die Menschen Zuflucht nehmen, wenn sie nicht wissen, wie sie kritische Lebensereignisse bewältigen sollen (Epstein 1992, S. 106). Abergläubisches Denken entsteht laut Epstein, wenn Menschen durch eine psychische Funktionsschwäche überfordert sind und unter Bedingung aufwachsen, die Gefühle der Hoffnungslosigkeit begünstigen.
4. Aberglaube und die Mathematik der Kognition
Da menschliches Denken nicht ohne Schwächen ist, neigen wir in einer Reihe von Situationen dazu, irrational statt rational zu handeln. Wir ziehen falsche Schlüsse, urteilen voreingenommen und übersehen wichtige Informationen. Seit den 50er Jahren haben Kognitionspsychologen viele dieser „geistigen“ Schwächen, die zu abergläubischem Denken und Verhalten führen, entdeckt. Besonders das abergläubische Denken entsteht aus einem Missverstehen von Zufällen und Wahrscheinlichkeiten, aus Irrtümern bei logischen Schlussfolgerungen und aus kognitiven „Abkürzungen“, die auf Kosten der Genauigkeit gehen.
Wo unser Leben Ungewissheit bietet, wenden wir mathematische Grundkonzepte wie größer als ( >), kleiner als ( < ) und gleich ( = ) , sowie formlose Wahrscheinlichkeitsrechnungen sei es in der Form von Analysen von quantitativen Informationen (z.B. Börsenberichte) oder einfachen Beurteilungen und Einschätzungen an. Somit besteht ein großer Teil unser alltäglichen Gedanken aus quantitativen Einschätzungen und Entscheidungen, sehr oft davon als Teilnehmer am Wirtschaftleben. In vielen Fällen ist solche Art von Denken durchaus rational und unsere auf Regeln beruhenden Beurteilungen äußerst vernünftig. Doch manchmal verlässt uns die Vernunft und wir gelangen zu mathematischen Fehlern und Irrtümern in den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeit. Ferner begehen wir Fehler, wenn das Umfeld eines Problems unser Denken beeinträchtigt oder einseitig ausrichtet.
5. Aberglaube und die psychologische Macht des Zufalls
Probleme mit der Mathematik der Wahrscheinlichkeit sind die wichtigste Ursache dafür, dass zufälligen Ereignissen eine unangemessene Bedeutung beigemessen wird. Doch beeinflussen auch psychische Faktoren unsere Einschätzungen zufälliger Ereignisse, wobei die Umstände des Geschehens unsere Überraschung vergrößern und damit unseren Aberglauben verstärken können.
Auch Nicht-Psycholgen wissen, dass unser Gedächtnis selektiv wirkt. Wer einsam und von Liebeskummer geplagt ist, denkt gerne an die Freuden verflossener Beziehung nach und wer mitten in einer unglücklichen Beziehung steckt, denkt nur an die Konflikte und nicht an den
Spaß. Die magische Qualität von Zufällen beeinflusst unser Gedächtnis einseitig, so dass wir im Alltag dazu neigen, uns an die Ereignisse zu erinnern, die sich bedeutungsvoll miteinander verbinden lassen, aber die vergessen, die unserem Gefühl einer Übereinstimmung widersprechen, selbst wenn sie den anderen recht ähnlich sind. Ist man beispielsweise überrascht, wenn man jemanden trifft, der den gleichen ungewöhnlichen Nachnamen hat wie der Lehrer; den man im ersten Schuljahr hatte, dann denkt man nicht mehr an die vielen Menschen mit anderen Namen, die man in der Zwischenzeit getroffen hat. Die einseitige Erinnerung verleitet uns, zu glauben, dass es sich hier um mehr als einen Zufall handeln müsse (Hintzman, Asher, Stern 1978, Kallai 1985).
6. Aberglaube und Scheinkorrelationen
Abergläubische Handlungen wie die Konsultation von Astrologen oder das Tragen von bestimmten für magisch gehaltenen Kleidungsstücken geschehen zum Teil, weil man glaubt, dass dies einen positiven Einfluss auf den Lauf der Dinge habe. Man glaubt an eine Beziehung (Korrelation) zwischen eigenen Handlungen und künftigen Geschehnissen und so wird die alltägliche Wahrnehmung von Korrelationen anfällig für Voreingenommenheiten. Oft sehen wir dabei nicht alle bedeutsamen Informationen und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf Ereignisse, die das Vorhandensein einer Korrelation zu bestätigen scheinen. Kognitionspsychologen haben herausgefunden, dass wir in vielen Fällen anfällig sind für Scheinkorrelationen – eine Voreingenommenheit, die uns dazu verleitet, zwischen Dingen Beziehungen zu sehen, die gar nicht bestehen.
Die erste Ursache dafür ist die einseitige Aufmerksamkeit (Baron 1994). So wurden in einem Experiment eine Gruppe von Krankenschwestern gebeten, 100 Karten auszuwerten, die
jeweils Auszüge aus der Krankengeschichte von Patienten erhielten (Smeldslund 1963). Sie sollten dabei feststellen, ob zwischen einem bestimmten Symptom und einer bestimmten Krankheit ein Zusammenhang bestand. In Wirklichkeit bestand dieser Zusammenhang nicht vorhanden und bei den Personen, die das Symptom aufwiesen, war die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken genau so groß wie die Wahrscheinlichkeit, nicht zu erkranken. Umgekehrt erkrankten auch die Hälfte derjenigen, die das Symptom nicht zeigten. Dennoch behaupteten 85 % der Krankenschwestern eine Beziehung zwischen beidem. Weitere Tests ergaben, dass dafür die Zahl der Ja/Ja-Fälle (Symptom / Krankheit) den Ausschlag gab. War nämlich in diesem Feld die Zahl ziemlich groß, dann waren die Versuchsteilnehmerinnen von einem Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen überzeugt – ungeachtet der in den anderen Feldern genannten Zahlen. Daraus wäre abzuleiten, dass wir nur auf Dinge achten, die sich gemeinsam ereignen und sehen somit eine Korrelation, wo gar keine besteht.
Die zweite Form der Scheinkorrelation besteht, wenn sich vorgefasste Meinungen auf unsere Motivation auswirken und wir somit bei Einschätzungen von Situationen nicht unparteiisch sind. Dies zeigt sich eindrucksvoll an einer Studie an klinischen Psychologen, die projektive Tests wie den Personenmaltest und den Rorschach-Farbklecks-Test verwenden. Wissenschaftler baten klinische Psychologen, durch Prüfung einer Gruppe von Tests herauszufinden, ob zwischen einer bestimmten Patientenreaktion und einer psychischen Verfassung eine Beziehung bestand. Die Psychologen neigten dazu, einen Zusammenhang zwischen einer Testreaktion und einer Diagnose zu sehen, wenn sie ohnehin schon von einer solchen Beziehung überzeugt waren. Eine Erklärung für die ungebrochene Beliebtheit projektiver Tests (die laut den meisten wissenschaftlichen Befunden beschränkt tauglich bis wertlos sind) ist die Scheinkorrelation: Die klinischen Psychologen glauben, Testergebnisse stünden in Beziehung zu Diagnosen von Patienten und nehmen dann wahr, was sie glauben ( Chapman, L.J., und Chapman, J.P., the results are what you think they are in: Psychology Today, November 1971). Scheinkorrelationen spielen beim Fortbestehen vieler magischer Vorstellungen eine wichtige Rolle (Chapman 1967). In der Hoffnung, die Unberechenbarkeiten des Lebens zu bewältigen, suchen abergläubische Menschen oft hochmotiviert nach etwas, das „wirkt“. Dabei schenken sie einem positiven und erhofften Ausgang auf die Anwendung eines Aberglaubens meist zu viel Beachtung und ignorieren die übrigen Fälle.
7. Aberglaube und sein Fortbestehen
Die Verwendung eines Glück bringenden Gegenstandes hat manchmal Erfolg und manchmal nicht. Bei anderen Gelegenheiten ereignen sich glückliche Dinge auch ohne magische Hilfe. Wenn der Aberglaube unter diesen wechselhaften Umständen bestehen bleibt, dann erklärt sich dies oft durch selektive Aufmerksamkeit und einen vorgefassten Glauben an seine Wirkung. Abergläubische Vorstellungen bestehen oft auf ganz hartnäckige Weise fort, auch wenn alle Indizien dagegen sprechen. Der amerikanische Philosoph Charles Pierce nennt diese von ihm am wenigsten empfohlene Vorgehensweise, um zu Verständnis zu gelangen, die Methoden der Beharrlichkeit - ein Festhalten an gewohnten Vorstellungen, nur weil diese vertraut und angenehm sind. Diese vertrauten, oft abergläubischen Vorstellungen werden von Menschen, auch von Wissenschaftlern nur sehr widerwillig aufgegeben.
Eines der eindrucksvollsten Beispiele für die Aufrechterhaltung eines Glaubens trotz widersprüchlicher Informationen wurde von Leon Festinger mit Hilfe der Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt. Zusammen mit Henry Riecken und Stanley Schachter veröffentlichte er 1956 das Buch When prophecy fails ( Festinger, Riecken, Schachter 1956). Es handelt sich dabei um den Bericht einer kleinen Sekte, die für einen bestimmten Termin den Weltuntergang durch Überflutung vorausgesagt hatte. Die Anführer der Sekte behaupteten, ihre Anhänger würden durch Raumfahrer gerettet werden, die unmittelbar vor der Apokalypse erscheinen würden. Als die Flut am angekündigten Tag nicht eintrat, glaubten viele Sektenmitglieder ihren Anführern noch mehr, anstatt sie anzuzweifeln. Da sie sich sehr stark für diese Gemeinschaft engagiert hatten, fiel es ihnen leichter, die kognitive Dissonanz durch die Bestärkung ihrer eigenen Überzeugung zu vermindern anstatt sich einzugestehen, sich geirrt zu haben. In der Realität geschah genau dasselbe bei den Zeugen Jehovas, die trotz mehrerer angekündigter Weltuntergänge (zuletzt für 1975) immer noch bestehen und trotz der vielen fehlgeschlagenen Prophezeiungen bis heute an Mitgliederzahlen sogar noch zulegen konnten.
8. Aberglauben und Heuristik
Flugangst ist weit verbreitetet, auch bei denjenigen, die wissen, dass Flugzeuge im Gegensatz zu Autos zu den sichersten Verkehrsmitteln zählen. Obwohl Autofahren statistisch wesentlich gefährlicher ist, sind Autophobien recht selten, weil Bilder von Flugzeugabstürzen spektakulärer in den Medien dargestellt werden und die Zahl der Todesopfer dabei meist in die Hunderte geht. Da Erinnerungen an spektakuläre Flugzeugabstürze viel besser verfügbar sind (Verfügbarkeitsheuristiken), beeinflussen sie die mit dem Fliegen verbundene Gedanken und Gefühle stärker.
Wann immer die Information, die wir erhalten, einseitig ist, beeinflusst die Verfügbarkeitsheuristik unser Denken und damit unser Urteilsvermögen. Für Informationen zu Aberglauben, Parapsychologischem und Übersinnlichem sind wissenschaftliche und mathematische Erklärungen nicht immer schnell und einfach verfügbar und würden viele Menschen zudem intellektuell völlig überfordern. Somit sucht der Verstand oft die Erklärungsursache für Ereignisse im „Glück“, „Schicksal“ oder „Zufall“. Leider beliefert uns die Massenmedien mehr mit abergläubischen und übernatürlichen Theorien, als wir brauchen, während wir über wissenschaftliche und mathematische Erkenntnisse und Erklärungsansätze nur wenig erfahren.
9. Aberglaube und Scheinkontrolle
Wirtschaftswissenschaftler analysieren riskante Entscheidungen wie den Kauf eines Lottoscheins mit dem Begriff Erwartungwert und multiplizieren dabei die zu gewinnende Summe mit der Wahrscheinlichkeit, diese zu gewinnen. Viele Lottospieler setzen beim Tippen der Zahlen auf eine Vielzahl persönlicher Strategien und das Gewerbe der Lottoberater, Buchautoren und Tippsysteme blüht. Die Anziehungskraft solcher Methoden ist zum großen Teil auf das Gefühl der Kontrolle, das sie vermitteln, zurück zu führen.
Wenn reine Glücksspiele vom Spieler bestimmte Handlungen verlangen, verwischt sich bald die psychologische Grenze zwischen Zufall und Geschick und die Würfler und Lottospieler beginnen, an Magie oder eigene übernatürliche Fähigkeiten zu glauben. Bei einer Untersuchung zur Scheinkontrolle fanden Ellen Langer und Jane Roth heraus, dass ein Missverstehen des Zufalls Menschen dazu bringen kann zu glauben, sie könnten den Zufall beeinflussen ( Langer, E.J., und Roth, J. 1975).
Studenten der Yale-Universität mussten die Ergebnisse von 30 Münzwürfen in zwei Serien voraussagen. Beide Münzwurfserien erhielten 15 Gewinne und 15 Verluste betreffend der Vorhersagen, doch traten die Gewinne bei der einen Serie zu Beginn des Werfens auf, bei der anderen am Ende. Langer und Roth entdeckten, dass die Studenten, die bei den ersten Münzwürfen richtig getippt hatten, wesentlich stärker an ihre Voraussagen glaubten als die, die am Anfang weniger Erfolg hatten - obwohl beide Gruppen die gleiche Gesamtzahl von Erfolgen erzielten. Langer und Roth folgerten daraus, dass die Studenten ihre Fähigkeit zur Voraussage gleich zu Beginn des Werfens der Münze beurteilten und dann trotz Erfolglosigkeit am Ende des Versuchsdurchgangs an ihrer ursprünglichen Auffassung festhielten und möglicherweise glaubten, sie hätten übersinnliche Fähigkeiten.
Der allumfassende menschliche Wunsch nach Kontrolle ist eine wichtige Motivation für abergläubisches Verhalten, das ein Gefühl von Kontrolle über das Unkontrollierbare vermittelt. Weiterer Beleg dafür, dass illusionäre Kontrolle einen persönlichen psychologischen Wert besitzt, erbrachten mehrere Laborstudien, die zeigten, dass Spieler, wenn sie unter Stress standen, Spiele bevorzugten, die eine Illusion von Kontrolle vermittelten (Friedland, Keinan, Regev, 1992) . Wissenschaftler stellten Probanden vor die Wahl, Würfelergebnisse vor dem Würfeln vorherzusagen oder nach dem Würfeln zu erraten (die Ergebnisse war für die Probanden nicht ersichtlich). Die Probanden neigten dazu, die Ergebnisse erst im Nachhinein zu erraten. Als man sie jedoch unter Stress setze, indem man ihnen für jedes falsche Raten einen Elektroschock androhte, zogen die meisten es vor, das Ergebnis schon vor dem Würfeln vorherzusagen – eine Entscheidung, die wohl ein stärkeres Gefühl der Kontrolle vermittelte.
Dieses Ergebnis stützt die Auffassung, abergläubische Verhaltensweisen seine eine zweckmäßige Anpassung an eine Kombination aus Stress und Mangel an objektiver Kontrolle. Wenn wir unter Druck stehen und uns nicht zu helfen wissen, kann das Gefühl von Kontrolle, das der Aberglaube vermittelt, eine positive Illusion darstellen. Die Forschungen zur Scheinkontrolle führen zu einer allgemeinen Erkenntnis über uns Menschen: Wir müssen das Gefühl haben, Dinge und Geschehnisse in uns und um uns herum zu verstehen, vorherzusagen oder zu beeinflussen, das heißt die Kontrolle zu besitzen (kognizierte Kontrolle).
13. Aberglaube und Barnum-Effekt
Die Persönlichkeitsbeschreibungen in Horoskopen sind meist recht mehrdeutig und wenig konkret: Einige Ihre Ziele sind etwas unrealistisch Manchmal sind Sie extravertiert, umgänglich und gesellig, während sie zu anderen Zeiten introvertiert und zurückhaltend sind Es kommen Ihnen oft Zweifel, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben oder das Richtige getan haben... Die meisten Menschen würden sagen, Persönlichkeitsprofile wie das obige seien absolut korrekt, wenn man Ihnen erzählen würde, es sei von Fachleuten extra für sie erstellt worden. Der Psychologie Paul Mehl nannte dies den „Barnum-Effekt“, nach der berühmten Maxime des Zirkusdirektors „Für jeden etwas“ (Mehl 1956).
Verschiedene Studien haben den Barnum-Effekt auf den Glauben an die Astrologie untersucht. In einem Fall entwarfen die Versuchsleiter, die sich als Astrologen ausgaben, Horoskope für zwei Gruppen von Versuchspersonen (Snyder und Shenkel 1975). Bevor sie die Ergebnisse bekannt gaben, fragten die „Astrologen“ die Mitglieder der einen Gruppe nach
Jahr, Monat und Tag ihrer Geburt. Die andere Gruppe wurde nur nach Jahr und Monat gefragt. Die Teilnehmer beider Gruppen erhielten das selbe handgeschrieben Horoskop, das natürlich nicht individuell erstellt war, sondern aus Aussagen des Bestsellers Astrologie sonnenklar von Linda Goodman (Goodman 1969) zusammengesetzt war. In Übereinstimmung mit dem Barnum-Effekt glaubten die Angehörigen beider Gruppen, das Horoskop sei eine genaue Beschreibung ihrer Persönlichkeit, doch diejenigen, die man zusätzlich um Angabe des Tages ihrer Geburt gebeten hatte, hielten es für noch zutreffender als die anderen. Die Bitte um spezifische Information über sich selbst nährte also die Illusion, es werde eine ganz persönliche Beschreibung des Betroffenen erstellt.
Das WDR-Fernsehen (WDR, Quarks) wiederholte mit Erfolg diesen Versuch im Jahre 1997. Als Eclipse-Astro-Forschungsgruppe getarnt, verschickte die Redaktion an mehr als 200 Interessierte statt eines persönlichen Horoskops ein für den am 25.10.1879 um 18 Uhr in Hannover geboren Mörders Fritz Haarmann erstelltes Horoskop. 74 % der Teilnehmer fanden ihren Charakter „korrekt beschrieben“, weitere 15 Prozent jubelten sogar: „Perfekt, alles stimmt“.
14. Aberglaube und Placeboeffekt
Der Placeboeffekt wird durch die Erwartung einer Reaktion hervor gerufen (Kirsch, 1985). Wer überzeugt ist, eine Arznei oder eine Heilbehandlung verbessere sein körperliches oder seelisches Befinden, ist empfänglich für den Placeboeffekt. So berichteten bei einem Versuch Studenten, sie fühlten sich wacher und angespannter, nachdem sie koffeinfreien Kaffee getrunken hatten, den sie für koffeinhaltig hielten. Die getäuschten Kaffeetrinker zeigten sogar starke Blutdruckveränderungen (Kirsch und Weixel, 1988). Der Placeboeffekt spielt eine entscheidende Rolle beim Glauben an Geistheilung und an jede wissenschaftlich nicht belegte Therapie wie beispielsweise die Homöopathie. Wenn die Aussagen und die Überzeugungskraft eines Heilers positive Wirkungen beim Patienten hervorrufen, kann es tatsächlich zu bedeutsamen Heilerfolgen kommen.
Es sind jedoch zahlreiche Fälle bekannt geworden von Menschen, die die Schulmedizin zugunsten wissenschaftlich nicht fundierter Heilmethoden aufgaben und für die Entscheidung sogar mit ihrem Leben bezahlten. Der spektakulärste Fall ist der Krebstod (2004) des 10-jährigen Dominik Feld, dessen Eltern sich gegen eine Chemotherapie und für eine wissenschaftlich sehr umstrittene Vitaminpräparatbehandlung nach Dr. Mathias Rath entschieden. Dessen Eltern waren auch nach Dominiks Tod aufgrund der entstandene kognitiven Dissonanz überzeugt, dass er nicht an Krebs gestorben sei, sondern an „ärztlichen Kunstfehlern“.
15. Aberglaube und logische Denkfehler
Hat sich ein Aberglaube durch die Sozialisation des Betreffenden oder durch operante Konditionierung erst einmal im Bewusstsein verankert, dann wird es durch voreingenommenes oder logisch falsches Denken immer wieder genährt. Wenn wir mit Informationen konfrontiert sind, die zuverlässig erscheinen, aber einer liebgewonnen Überzeugung oder Denkweise widersprechen, wäre eine Infragestellung unseres Glaubens die rationale Reaktion darauf. Niemand gibt jedoch gerne zu, dass er sich geirrt hat und je enger dieser Irrglaube mit unserem Selbstwertgefühl verbunden ist, desto schwieriger wird es, ihn aufzugeben. Wenn wir bisher aus Überzeugung gehandelt haben (z.B. einen Aberglauben praktiziert) haben , dann kann die Änderung dieses Aberglaubens eine unangenehmen Missklang zwischen bisherigem Handeln und der neuen Erkenntnis schaffen (kognitive Dissonanz). Es kann sogar sein, dass man sich weiterhin etwas vormacht, anstatt den alten Glauben aufzugeben (Baron, 1994).
Viele der Denkfehler, die Aberglauben am Leben erhalten, erfüllen genau diese Funktion. Wenn man etwas, das ein glücklicher Zufall zu sein scheint, der Wirksamkeit eines Talisman zuschreibt, dann kann diese Missverstehen der Wahrscheinlichkeit ganz einfach durch fehlenden mathematischen Sachverstand verursacht sein, doch hilft dies dem Zufall beigemessene besondere Bedeutung, den Aberglauben (an die Kraft des Talisman) aufrecht zu erhalten oder zu verstärken.
16. Aberglaube und geistige Verfassung
Aberglaube entsteht häufig aus Denkfehlern, doch sind dies Irrtümer (Scheinkontrolle, Missverstehen von Zufall und Wahrscheinlichkeit), die wir alle immer wieder begehen. Ein Aberglaube, der seine Ursprung in den Schwächen des menschlichen Denkens hat, ist normal und meistens kein Anzeichen intellektueller Schäden oder Defizite. Durch Aberglauben bedingte Denkfehler sind ein natürliches Merkmal des Menschen, beeinträchtigen jedoch manchmal unsere Fähigkeit, effektiv zu denken und zu handeln, indem es so den Vorgang des Problemlösens stört und unsere kognitiven Fähigkeiten einschränkt.
Literatur:
Die Psychologie des Aberglaubens, Stuart A. Vyse, Birkhäuser 1999
Häufig gestellte Fragen
Was ist Aberglaube laut dem Text?
Aberglaube wird als eine Überzeugung oder Vorstellung definiert, die nicht auf Vernunft oder Wissen beruht und bestimmte Dinge, Umstände oder Ereignisse als bedrohlich oder bedeutsam ansieht. Eine umfassendere Definition besagt, dass es sich um Glaubenssätze oder Praktiken handelt, die unbegründet sind und nicht dem Kenntnisstand der Gesellschaft entsprechen.
Welche Rolle spielt die Kontrollüberzeugung im Zusammenhang mit Aberglauben?
Menschen mit einer externalen Kontrollüberzeugung, die glauben, dass sie den Geschehnissen hilflos ausgeliefert sind, neigen eher dazu, abergläubisch zu sein. Sie schreiben Ereignisse in ihrem Leben geheimnisvollen, nicht kontrollierbaren Kräften zu. Studien haben gezeigt, dass Personen mit einer externalen Kontrollüberzeugung stärker an übersinnliche Phänomene glauben.
Welche Persönlichkeitsmerkmale sind mit Aberglauben verbunden?
Aberglaube wird oft mit neurotischem Verhalten, persönlicher Instabilität, Depressionen, Angst, geringem Selbstwertgefühl und mangelnder Ich-Stärke in Verbindung gebracht. Abergläubische Menschen sind im Vergleich zu rationaleren Menschen oft passiver, isolierter, ängstlicher und psychisch instabiler.
Wie beeinflusst die Mathematik der Kognition abergläubisches Denken?
Abergläubisches Denken entsteht oft aus einem Missverstehen von Zufällen und Wahrscheinlichkeiten, aus Irrtümern bei logischen Schlussfolgerungen und aus kognitiven "Abkürzungen", die auf Kosten der Genauigkeit gehen. Menschen neigen dazu, irrational statt rational zu handeln und falsche Schlüsse zu ziehen.
Welche Rolle spielt der Zufall bei der Entstehung von Aberglauben?
Probleme mit der Mathematik der Wahrscheinlichkeit führen dazu, dass zufälligen Ereignissen eine unangemessene Bedeutung beigemessen wird. Psychische Faktoren und die Umstände des Geschehens können die Überraschung vergrößern und den Aberglauben verstärken. Selektive Erinnerung an bedeutungsvolle Ereignisse verstärkt diesen Effekt.
Was sind Scheinkorrelationen und wie tragen sie zum Aberglauben bei?
Scheinkorrelationen sind Voreingenommenheiten, die dazu verleiten, Beziehungen zwischen Dingen zu sehen, die gar nicht bestehen. Dies entsteht durch einseitige Aufmerksamkeit und vorgefasste Meinungen, die unsere Motivation bei der Einschätzung von Situationen beeinflussen. Abergläubische Menschen suchen oft hochmotiviert nach etwas, das "wirkt" und schenken einem positiven Ausgang zu viel Beachtung, während sie die übrigen Fälle ignorieren.
Wie bleibt Aberglaube bestehen, selbst wenn es Beweise gegen ihn gibt?
Aberglaube bleibt oft durch selektive Aufmerksamkeit, vorgefassten Glauben und die Methode der Beharrlichkeit bestehen. Die Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt, wie Menschen an ihren Überzeugungen festhalten, selbst wenn sie widerlegt werden, um die innere Spannung zu reduzieren.
Wie beeinflusst die Heuristik das Denken über Aberglauben?
Die Verfügbarkeitsheuristik beeinflusst das Denken, wenn Informationen einseitig sind. Erinnerungen an spektakuläre Ereignisse, wie Flugzeugabstürze, beeinflussen die mit dem Fliegen verbundenen Gedanken und Gefühle stärker. Aberglaube wird durch die Massenmedien verstärkt, die mehr über abergläubische Theorien berichten als über wissenschaftliche Erkenntnisse.
Was ist Scheinkontrolle und wie hängt sie mit Aberglauben zusammen?
Scheinkontrolle ist die Illusion, Zufallsereignisse beeinflussen zu können. Dies führt dazu, dass Spieler an Magie oder eigene übernatürliche Fähigkeiten glauben. Der menschliche Wunsch nach Kontrolle ist eine wichtige Motivation für abergläubisches Verhalten, das ein Gefühl von Kontrolle über das Unkontrollierbare vermittelt.
Was ist der Barnum-Effekt und wie beeinflusst er den Glauben an Astrologie?
Der Barnum-Effekt beschreibt die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Persönlichkeitsbeschreibungen als zutreffend für sich selbst zu erachten. Astrologen nutzen diesen Effekt, indem sie Horoskope erstellen, die für viele Menschen zutreffend erscheinen, wodurch der Glaube an die Astrologie verstärkt wird.
Welche Rolle spielt der Placeboeffekt beim Aberglauben?
Der Placeboeffekt wird durch die Erwartung einer Reaktion hervorgerufen. Wer überzeugt ist, dass eine Arznei oder Heilbehandlung sein Befinden verbessert, ist empfänglich für den Placeboeffekt. Dieser Effekt spielt eine Rolle beim Glauben an Geistheilung und andere wissenschaftlich nicht belegte Therapien.
Welche logischen Denkfehler tragen zum Aberglauben bei?
Voreingenommenes oder logisch falsches Denken nährt den Aberglauben. Menschen vermeiden es, zuzugeben, dass sie sich geirrt haben, insbesondere wenn der Irrglaube mit ihrem Selbstwertgefühl verbunden ist. Denkfehler wie das Zuschreiben von Glück einem Talisman verstärken den Aberglauben.
Beeinträchtigt Aberglaube die geistige Verfassung?
Aberglaube entsteht häufig aus Denkfehlern, die wir alle begehen. Er ist ein natürliches Merkmal des Menschen, beeinträchtigt jedoch manchmal die Fähigkeit, effektiv zu denken und zu handeln, indem er den Vorgang des Problemlösens stört und kognitive Fähigkeiten einschränkt.
- Arbeit zitieren
- Alfred Seif (Autor:in), 2006, Abergläubisches Denken, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109977